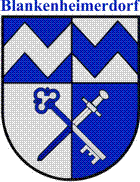|
Säächmöll (weiches ö)
Die „Sägemühle,“ früher ein allgemein gültiges Wort für ein Sägewerk. Unter Ausnutzung der Wasserkraft wurde häufig die normale Mahlmühle mit einem Sägewerk kombiniert. Das war beispielsweise bei der Eischer Müll (Escher Mühle) zwischen Jünkerath und der Ortschaft Esch in Rheinland-Pfalz der Fall. Hier gab es außerdem noch eine Schreinerei und ganz früher auch eine Schmiede. Mein Vater hat in jungen Jahren bei Meister Reifferscheid in der Schreinerei gearbeitet, wo unter anderem speziell auch Butterfässer hergestellt wurden. Im Jahr 1956 sollte ich für einen von Vaters Kunden ein Butterfass in der Eischer Müll abholen, fand mich nicht zurecht und ein freundlicher Bauersmann auf einem Feld bei Esch wies mir den Weg: Fahr eenfach hie et Dall eraff, hener dem Böschelche do önne siehste de Müll. Die Wiesen waren gemäht, hinderliche Zäune gab es nicht, also zockelte ich mit meinem Moped durchs Grünland und sichtete am Ende der Talsenke hinter einem Wäldchen tatsächlich die Eischer Müll, wo mich Meister Reifferscheid begrüßte: Dou bes also Hein senge Jong, - er erinnerte sich noch sehr gut an seinen früheren Mitarbeiter. Eine „Escher Mühle“ gab es übrigens auch am heutigen „Erftradweg“ zwischen Bergheim und Bedburg.
Säät
Ein typischer „Dörfer“ Ausdruck. Die Säät war der Behälter, in dem der Sämann die Saatkörner mit sich führte. Das war ganz früher oft ein entsprechend bemessener Tuchbeutel, der an Bändern über die Schulter oder vor dem Bauch getragen wurde. Die echte Säät war unterdessen ein von Hand aus Stroh geflochtener, etwa 80 mal 30 Zentimeter großer und 20 Zentimeter tiefer Korb, häufig auch Säkorf (Säkorb) genannt. Die Säät gab es auch als leicht nierenförmigen Metallbehälter, der vor dem Bauch getragen wurde. Die Strohsäät besaß in der Regel einen stabilen Henkel aus Haselholz zum Einhängen in die Armbeuge. Das Kornsäen war beinahe ein Ritual, nicht selten schlug der Sämann über der gefüllten Säät das Kreuzzeichen und bat in Gedanken um gutes Gedeihen. Jeder Sämann hatte seinen ganz speziellen „Säschritt“ und darauf abgestimmt den „Säwurf,“ wenn beide Faktoren übereinstimmten, wurde die Saat auf dem Acker so gleichmäßig gestreut, wie es die Sämaschine kaum besser kann. Der Sämann war in unserem Schullesebuch das Symbol für den deutschen Bauern. In Blankenheimerdorf war die gut mit Heu gepolsterte Säät unser Sammelbehälter beim Maieiersammeln am Vorabend zum 1. Mai.
Sackdooch
Das „Sacktuch,“ der früher übliche Ausdruck fürs Taschentuch. Sackdooch gilt heute allgemein als grob und unfein, man hat es längst in Teischendooch umgewandelt. Der Gossensprache zuzuordnen waren deftige Wörter wie Rotzfahn oder Schnuddelslomp, als unfein wurde unter anderem auch Nasenlumpen erachtet. In Österreich ist die Hosentasche der „Hosensack,“ und darin steckt das Nasentuch, aus dem somit ein „Sacktuch“ wurde. Das Eifeler Sackdooch ist unterdessen eher auf das niederländische „Zakdoek“ (gesprochen = Sakduuk) zurückzuführen. Im Mittelalter gab es noch kein Taschentuch, man schnäuzte sich mit Daumen und Zeigefinger und zwar „vornehm“ mit der linken Hand, – weil man mit der Rechten das Essen zum Mund führte – und wischte die Finger am Gewand ab. Fürs Schnäuzen kannte man verschiedene Ausdrücke, in Nettersheim beispielsweise war „horxe“ gebräuchlich in Anlehnung an das Schnäuzgeräusch. Heute noch ist ene Knödde em Sackdooch (Ein Knoten im Taschentuch) eine häufig angewandte Gedächtnisstütze. Das große rote Sackdooch des Eifelbauern wurde nicht selten zur Kopfbedeckung umfunktioniert, wenn etwa bei der Heuernte die Stechfliegen den Kopf umschwirrten. In die vier Tuchecken wurde ein dicker Knoten gemacht und das Ganze über die schweißnassen Haare gezogen.
Sackschüez
Was dem Arbeiter unserer Tage der Blaulenge (Blauleinen = Wort für den Arbeitsanzug), das war für unsere Eltern, besonders in der Landwirtschaft, die Sackschüez (Sackschürze), eine vor den Bauch gebundene Arbeitsschürze aus grobem Sackleinen. Oft war es tatsächlich ein Kartoffel- oder Getreidesack, den man sich mit einem dünnen Strick um den Leib band oder ganz einfach hinter die Jüed (Leibriemen, Gurt) klemmte. Gebraucht wurde die Sackschüez zum Schutz der Kleidung bei groben und schmutzigen Arbeiten, beim Maarfahre (Jauche ausfahren) etwa oder beim Kolerawe schrappe (Reinigen der Rüben von Hand). Auch die Frauen bedienten sich der Sackschüez, wenn sie bei der Getreideernte die Garben aufnahmen: Nicht selten steckten sperrige Felddisteln zwischen den gemähten Halmen, eine unangenehm stachelige Angelegenheit. Zum Schutz der Haut vor den Disteln, wurden zwei alte Rocksmaue (Jackenärmel, siehe: Mau) über die nackten Arme gestreift. Aus einem Sack ließ sich auch im Handumdrehen ein kapuzenartiger Umhang herstellen, - Regenschutz beispielsweise bei einem kurzzeitigen Guss während der Feldarbeit. Sackschürzen in moderner Form kann man heutzutage kaufen, Mehlsack- oder Kartoffelsackschürzen in diversen Formen, Farben und Größen.
Säng
Als im Eifeldorf noch jeder Handwerker, jeder Eisenbahner oder Werksarbeiter im Nebenberuf Kleinlandwirt war, zwei Köhcher em Stall (zwei Kühe im Stall) hatte und ein Schwein für die Kirmesschlachtung mästete, da gab es noch die Hausschlachtung, und die Säng war noch ein Alltagsbegriff. Es gab einen schönen alten Brauch: Wenn ein Schwein geschlachtet wurde, lud man den Nachbarn zur Kostprobe und Begutachtung von Fleisch und Wurst des Schlachttieres ein, und diese Kostprobe war die Säng. Wenn beispielsweise am Wuëschdaach (Wursttag) der Nachbar am Haus vorbei ging, lud man ihn ein: Komm eren, Nikla, on holl dir de Säng mot. „Nikla“ oder „Klöös“ waren übliche Namen für Nikolaus. Auf die Beurteilung der Säng legte man damals großen Wert. Noch sehr gut erinnere ich mich an das eine oder andere Schlachtfest im Landgasthof Schmitz / Cremer: Wenn aan Krämesch Hausschlachtung war, servierte Gastwirt Erwin Schmitz seiner Stammkundschaft in der Regel eine ansehnliche Säng in Gestalt einer verlockenden Schlachtplatte mit diversen Happen aus der eigenen Wurstproduktion. Eine solche Säng musste naturgemäß begossen werden und das dauerte seine Zeit. Von alledem ist heute (2017) nur noch die Erinnerung da, es gibt keine Kleinbauern mehr, keine Hausschlachtung und damit keine Säng, es gibt ja nicht einmal mehr die Kneipe von Krämesch Erwin. Wir leben im Wohlstand, – und sind trotzdem arm.
Sänzel (weiches ä)
Unser Wort für die Sense, das unverzichtbare Werkzeug des Bauern unserer Kinderzeit. Es gab sie in verschiedenen Größen und Ausführungen, die hauchdünn gedengelte Grassense beispielsweise, das etwas gröbere Sensenblatt fürs Haverjeschier (Getreidesense) oder auch die kurze und sehr robuste Strausänzel (Strau = Heidekraut als Stallstreu), die auch zum Freischneiden der Forstpflanzen gebraucht wurde. Der Sensenstiel, Wurf genannt, war aus Metall oder wurde vom Dorfschreiner und Stellmacher aus Holz gefertigt. Der Stiel wurde mit dem Sänzelsreng (Ring) an der „Hamme“ (Flansch) des Blattes festgeschraubt, den Innen-Vierkantschlüssel trug der Mähder (Mäher) ständig bei sich. Zur Sensenausrüstung gehörten schließlich noch das Haarjeschier (Dengelwerkzeug = kleiner Amboss und Hammer) sowie das Schlotterfass (Wetzsteinbehälter) mit dem zugehörigen Schliefstejn (Schleifstein, Wetzstein). Meistens gab es einen ortsfesten und einen zweiten, zum Mitführen beim Mähen bestimmten Haarstock (Amboss). Der geübte Mäher nämlich behob im Bedarfsfall den Schaden direkt vor Ort durch ein paar Dengelschläge. Die Grassense war so empfindlich, dass schon das Durchschneiden eines im Gras versteckten Ameisennestes und erst recht die Berührung mit Holz, etwa einem Aststück, der Schneide den „Schliff“ nahm. Ein Stein oder Metallteil konnte sogar zur Beschädigung der Sänzelsbahn (hauchdünn gedengelte Schneide) führen. Steinewerfen auf Heuwiesen war für uns Kinder eine Freveltat, ich habe dafür einmal von Ohm Mattes fürchterliche Uhrwatsche (Ohrfeigen) bezogen. Dabei war es noch nicht mal unsere eigene Wiese.
Sänzel kloppe
Was in unserer Standardsprache vornehm mit „Dengeln“ bezeichnet wird, beschreibt der Eifeler naturgetreu und allgemeinverständlich mit Sänzel kloppe (Sense klopfen). Sänzel kloppe ist eine, heute fast vergessene Handarbeit, die maschinell kaum zu ersetzen ist. Vor Jahren kaufte ich mir eine handbediente „Dengelmaschine“ aus dem Werkzeugkatalog, – nach etlichen fruchtlosen Versuchen habe ich sie zum Alteisen getan und wieder zu Haarstock (Dengelamboss) und Hammer gegriffen. Beim Sänzel kloppe erhält die Sensenschneide eine, dem Mähgut (Gras, Getreide, Strau) entsprechende mehr oder weniger dünne „Bahn,“ den so genannten „Dengel.“ Der muss beispielsweise für den Grasschnitt hauchdünn sein und sich beim Berühren mit dem Daumennagel leicht wölben: Die „Nagelprobe.“ Sänzel kloppe erfordert eine Menge Fingerspitzengefühl, Zeitaufwand und Geduld, ein einziger falscher Hammerschlag kann die Sensenschneide arg beschädigen. Wernn beispielsweise der Dengel durch einen unkorrekten Hammerschlag einen Basch (Riss) bekommt, so ist das ein nur noch schwer zu behebender Schaden. Eine detaillierte Beschreibung des Sänzel kloppe wäre an dieser Stelle zu umfangreich, grob gesagt: Es gab zweierlei Dengelarten, einmal das Schlagen mit der Hammerbahn (stumpfes Ende) auf spitzem Haarstock, zum anderen das Klopfen mit der Hammerfinne (spitzes Ende) auf flachem Haarstock. Der Sänzelshamer (Dengelhammer) besaß einen kurzen Stiel, der das präzise Dosieren und Platzieren der Schläge erleichterte. Der Hammer war das Heiligtum des Mähers und durfte ausschließlich nur fürs Sänzel kloppe gebraucht werden. Während der Erntezeit war der Feierabend im Dorf geprägt vom vielfachen Klopfen, wenn die Bauern ihr Mähgerät für den Einsatz am nächsten Morgen rüsteten.
Sarchnääl
Was ein „Sargnagel“ ist, weiß jeder von uns, – sollte man annehmen. In den 1970er Jahren war das aber offensichtlich noch nicht so selbstverständlich. Da nämlich drückte unser „Boss“ dem Bahnhofsarbeiter eine D-Mark in die Hand: Dä Pitter, jank mir ens jät Sarchnääl holle. Der Zigarettenautomat hing gleich um die Ecke an der Hauswand, 50 Schritte vom Bahnhof entfernt. Zehn Minuten vergingen, eine Viertelstunde, – ja wo bliev dä Pitter dann – 20 Minuten, eine halbe Stunde – jetz wiëd et mir äwwer baal ze jeck – nach 35 Minuten erschien Pitter, knallte dem Boss ziemlich wütend eine Tüte auf den Tisch und meinte: Dä Chef, nächstens jehste äwwer selever, ech han en all Jeschäfter jefrooch, kejner hat Sarchnääl. Retter in der Not war schließlich der Dorfschmied, der hatte Pitter schmunzelnd für eine Mark Pappnägel verkauft. Sarchnääl, ein verballhornendes Wort für die Zigarette, das unterdessen den Nagel genau auf den Kopf trifft und die Bösartigkeit des „Glimmstengels“ beschreibt. In meinen „besten“ Jahren habe ich selber täglich so um die 30 bis 40 Sarchnääl konsumiert, seit 1979 habe ich das Laster absolut aufgegeben und mir in einer stillen Stunde einmal ausgerechnet, wie viel Stück da so im Lauf von fast 30 Jahren zusammengekommen waren. Und wie viel Geld ich dafür ausgegeben hatte. Es waren Unsummen, noch heute sträuben sich mir die Haare. Ich habe einen Mann gekannt, dem mußte ein Raucherbein amputiert werden. Er saß im Rollstuhl, rauchte aber weiter. Ihm wurde auch das zweite Bein abgenommen, da gab er das Rauchen auf, saß noch eine Weile im Rollstuhl und starb wenig später, – Sarchnääl!
Sätz
Wenn es Anfang Mai ans Jrompere setze (Kartoffeln pflanzen) ging, musste zunächst das Saatgut vorbereitet werden. Das bedeutete: Die Sätz mussten aus dem Keller geholt, nötigenfalls entkeimt und sortiert und schließlich in Säcke gefüllt werden. Sätz war das übliche Wort für die Saat-, Pflanz- oder Setzkartoffeln, die bei der Ernte im vergangenen Herbst bereits beim Jrompere raafe (Kartoffeln auflesen, aufsammeln) auf dem Feld aussortiert und im Keller getrennt von Deck Jrompere (Dicke = Speisekartoffeln) und Söüsjrompere (Schweinekartoffeln = Tierfutter) gelagert worden waren. Eine einzelne Saatkartoffel war ein Satz, analog dazu Sätz als Plural. Angefaultes oder zu stark geschrumpeltes und ausgekeimtes Saatgut wurde bei der Vorbereitung aussortiert, die fahlen „Dunkelkeime“ wurden entfernt. Ein guter Satz war fünf bis sechs Zentimeter groß, wies keine Missbildungen oder Beschädigungen auf und besaß eine, der Sorte entsprechende Form. Unsere Sätz daheim mussten möglichst rund sein: Wir pflanzten seit ewigen Zeiten „Ackersegen“ und das war eine ziemlich rundliche Kartoffelsorte. Ovale oder flache Knollen wurden also bei uns als ungeeignet eingestuft. Das Aussortieren der Sätz nach diesen Kriterien aus der Feldernte bewährte sich über Jahrzehnte hinweg, für den Ankauf von neuem Saatgut fehlten unseren Eltern die Groschen.
Sauledder
Ein Sauledder ist ein „Sauleder,“ was immer man sich darunter auch vorstellen mag. Man könnte in buchstabengetreuer Übersetzung auf „Schweineleder“ kommen, doch entspricht das in keiner Weise unserem mundartlichen Sauledder. Das nämlich ist gleichbedeutend mit Saunickel und bezeichnet ganz allgemein einen unsauberen, gemeinen oder unanständigen Menschen. Einen solchen nennen wir auch Schweinickel, was wiederum im Hochdeutschen mit „Schweinkerl“ umschrieben wird. Ein weibliches Sauledder, eine unsaubere liederliche Frau also, heißt bei uns Saumensch, mehrere Weiber dieser Sorte sind Saumenscher. Zur Zeit unserer Eltern galt schon ein etwas tief ausgeschnittenes Kleid als „unanständig,“ einer derart gekleideten Frau wurde nachgesagt: Dat Sauledder löüf halev nackich eröm. Zum Glück kannten die Eltern kein Internet, – gewisse Seiten hätten ihnen glatt die Sprache verschlagen. Wo häß du Sauledder wier eröm jematsch erboste sich Mam, wenn ich mal wieder am Lohrbach einen „Staudamm“ gebaut hatte. Wasser, Matsch und Schlamm, das waren – und sind – bevorzugte kindliche Beschäftigungsobjekte. Sauleder hat sogar Zugang zur Musikwelt gefunden, unter anderem gehört „Sauleder Du“ zum Repertoire der Kärntener Musikgruppe „Die jungen fidelen Lavanttaler.“ (Siehe auch: Sou).
Schaaf
Schaaf ist ein sehr häufiger Familienname auch bekannter Persönlichkeiten, der Fußballtrainer von Werder Bremen beispielsweise heißt (2010) Thomas Schaaf. Der Name Schaaf wird wie „Schaf“ gesprochen, der Eifeler kennt den Ausdruck aber auch mit gedehntem a, wie beispielsweise bei „Maria Laach.“ Damit ist dann der Schrank gemeint, der in unserem Dialekt geschlechtslos wird: Et (das) Schaaf. Es gab beispielsweise das Köcheschaaf (Küchenschrank), in dem neben Steintöpfen mit Schmalz, Salz und Butter, das Alltagsgeschirr untergebracht war. Das joot Jeschier (gutes Geschirr) wie Goldrandteller und Porzellantassen, wurden im Wandschaaf (Wandschrank) in der guten Stube aufbewahrt. Den Kleiderschrank nannte man Klejderschaaf und ein kleines Wandschränkchen war et Schääfje. Nach dem Krieg lebte in Blankenheimerdorf Hermann Schaaf, ein Junggeselle aus ärmlichen Verhältnissen. Wegen eines Sprachfehlers wurde er belächelt, auf manchem Wissensgebiet steckte er aber den „Gescheiten“ spielend in die Tasche. Seine Spezialfächer waren die Mathematik und die Optik. Die Familie Schaaf wohnte zuvor in Nonnenbach, ich erinnere mich noch aus meiner Kindheit an Schaafs Hüüsje, ein kleines Wohnhaus beim Anwesen Plützer (Hausname „Knubbe“). Auch Schaafs Dröggche (Gertrud) ist mir noch in Erinnerung, die Mutter von Hermann. Schaaf (gesprochen: s-chaf) ist übrigens das holländische Wort für Hobel, davon abgeleitet ist beschaafd und das bedeutet „gebildet.“
Schaav
Dieses Mundartwort wird wie „Schaf“ ausgesprochen, ist aber von schave (schaben, das v wird wie w gesprochen) abgeleitet und bedeutet wörtlich „Schabe.“ Damit wird nicht etwa das Ungeziefer gleichen Namens bezeichnet, vielmehr ist der große hölzerne Gemüse- oder Krauthobel gemeint, den früher die Leute bei der Zubereitung von Suëre Kappes (Sauerkraut) brauchten. In Miniformat gibt es das Gerät auch heute in der modernen Küche. Die Schaav unserer Eltern war ein gut meterlanges und 40 Zentimeter breites Holzbrett mit drei oder vier schräg angeordneten Messern und einem in Führungsnuten laufenden Hobelkasten, Schledde (Schlitten) genannt, der einen ganzen Kappes (Kohlpflanze) aufzunehmen vermochte. In jedem Dorf gab es zumindest eine Schaav, die in Privatbesitz war, die aber reihum durchs ganze Dorf ausgeliehen wurde. In Blankenheimerdorf wurde das Gerät bei Scholle Pitter (Peter Reetz, der Gemeindediener) aufbewahrt. Im großen Dorf war in der Kappeszitt (Erntezeit des Kohlgemüses) die Nachfrage entsprechend groß, oft konnte man die Schaav nur für Stunden ausleihen. Das Kappes schaave (Kohl hobeln) war eine anstrengende Arbeit, zumal auch stets größere Mengen zu verarbeiten waren: Der Wintervorrat an Sauerkraut war immer ein Holzbottich oder ein großes Stejndöppe (Keramiktopf) voll.
Schaaz
In unserem 21. Jahrhundert hüllt sich die modebewusste Frau in mehr oder weniger kostbare Schulter-, Kopf- und Halstücher ein. Das Gleiche tat auch die Oma unserer Kinderjahre mit der Schaaz. Dieses meist dunkel gefärbte große Wolltuch war weniger auf optischen Blickfang, als vielmehr auf wärmende Nützlichkeit zugeschnitten, die Frau von damals tat keinen Schritt aus dem Haus, ohne zuvor die Schaaz über Kopf und Schultern geschlagen zu haben. In Anbetracht dessen kam bald auch der Ausdruck Möhnedooch (Alte-Frauen-Tuch) auf, und das wiederum wurde zum Charakteristikum beim Eifeler Möhnenzug am Weiberdonnerstag. Ursprünglich war die Schaaz eine ziemlich grobe Wolldecke, die aber eine gute Wärmeisolierung besaß und sehr häufig als Bettdecke benutzt wurde. Wenn im strengen Eifelwinter im ungeheizten Schlafzimmer die Eiskristalle an der Wand glitzerten, zog man sich im Bett die Schaaz über die Ohren, – heute hält man das für Angeberei, ich habe es aber selber erlebt. Auch die braune oder graue Satteldecke der Soldatenpferde nannte man Schaaz (siehe: Päëdsdeck). Diese Decken waren in der armen Nachkriegszeit ein begehrter Artikel. Das Wort Schaaz brachte man früher automatisch mit „Wärme“ und „Zudecken“ in Verbindung, die als Oberbett benutzte Steppdecke beispielsweise war für uns eine Schaaz. Der Begriff ist inzwischen weitgehend aus dem Eifeler Wortschatz verschwunden.
Schachtel
Eins der relativ weniger Wörter, die mundartlich genau so gesprochen werden wie im Hochdeutschen, und die auch die gleiche Bedeutung haben. Die Schachtel ist bekanntlich ein Aufbewahrungs- oder Verpackungsbehälter aus Pappe oder ähnlichem Material. Die Kunststoffschachtel unserer modernen Welt kannten unsere Eltern noch nicht, sie kannten auch noch nicht unsere zeitnahen gängigen Begriffe wie „Box“ oder „Container.“ Die Holländer sagen ganz einfach „doos,“ und diese „Dose“ ist ja auch bei uns ein Begriff. Der Schachteln gibt es eine beachtliche Anzahl, die Pappendeckelsschachtel beispielsweise, die Zijaretteschachtel, die Pralineschachtel und nicht zuletzt die Hootschachtel, deren Material, Umfang und Bauart Auskunft über die wirtschaftliche Lage ihrer Besitzerin gibt. Da gibt es auch die aal Schachtel (alte Schachtel), die man tunlichst mit einer guten Portion Vorsicht ins Gespräch bringen sollte. So betitelte Fränz irgendwann einmal seine Frau als „betagter Karton“ und begründete diesen Sinneswandel seinem Freund gegenüber: Wenn ech für die ‘aal Schachtel’ sare, häut die mir jedesmool de Pann üwwer dr Kopp. Die gusseiserne Eifeler Herdpfanne mit dem langen Stiel eignete sich in der Tat hervorragend als Schlagwaffe. Ein Schächtelchen ist eine Schachtel im Miniformat, ein Streichholzdöschen zum Beispiel. Als es noch keinen elektrischen Strom gab, lagen in jedem Schlafgemach auf dem Näächskommödche ein faustgroßer Ball und ein Päckchen Strichholz parat: Mit dem Ball warf man vom Bett her die brennende Kerze auf dem Weischdesch (Waschtisch) aus, und mit einem Streichholz schaute man nach, ob man auch getroffen hatte.
Schädem
Was für den Engländer „the shadow“ und für den Holländer „de schaduw“ ist, das ist für uns Eifeler dr Schädem, und das bedeutet „Schatten.“ Ein weises Wort unserer Vorfahren besagt: Wo Liëch os, do os och Schädem (Kein Licht ohne Schatten), – offensichtlich kannte man damals das Streulicht noch nicht. Dafür aber kannten unsere Eltern sehr genau den Maischädem (wörtlich: Maischatten), ein bei uns heute fast ausgestorbenes Wort aus der Pflanzenkunde. Maischädem ist der „Giersch,“ den viele von uns als schwer zu beseitigendes Gartenunkraut kennen, der aber auch als Gemüse verwendet wird und früher sogar als Heilmittel gegen Gicht und Rheuma galt. Von einem etwas einfältigen Mitmenschen sagt man: Dä hät ene Schädem (Der hat einen Schatten), und Schädem öm de Oure (Schatten um die Augen) hält unsere Damenwelt für optisch vorteilhaft. Wer ungewöhnlich beleibt ist, gerät leicht in den Ruf: Dem senge Schädem allejn wooch jo ad fuffzich Kilo, – allein der Schatten wiegt also einen Zentner, was bringt da die Person selber auf die Waage! Vom Gegenteil eines solchen Menschen wird unterdessen behauptet: Dä os esu dönn, wenn dä en dr Sonn steht, siehste kejne Schädem. Als Hütebub besaß man zu meiner Kinderzeit keine Uhr, für den Heimtrieb orientierte man sich nach Möglichkeit am Schatten markanter Punkte. Wenn zum Beispiel an der Maiheck der Schädem des Fichtenbestands neben unserer Wiese die Straße nach Nonnenbach erreicht hatte, war die Zeit für den „Feierabend“ gekommen. Wenn allerdings die Sonne nicht schien, stand man „auf dem Schlauch,“ da erfragte man die Uhrzeit beim zufällig vorbeikommenden Feldhüter oder orientierte sich am „vollgefressenen“ Bauch der Weidetiere.
schalekich
Die wörtliche Übersetzung des ziemlich seltsamen Ausdrucks lautet „schalkig“ und wird im Standarddeutsch eher mit „schalkhaft“ oder „schelmisch“ umschrieben mit der Bedeutung „lustig, scherzhaft, witzig.“ In diesem Sinne wird es in der Südeifel und im Moselraum auch gebraucht. Das Blankenheimerdorfer schalekich besagt unterdessen beinahe das Gegenteil: böse, brutal, hinterlistig, heimtückisch. Wer beispielsweise anderen Leuten oder auch Tieren gern Schmerzen zufügt, ist ene schalekije Hond (ein bösartiger Hund). Vor einem brutalen Schläger wurde gewarnt: Holl dech vüër dem en Ääch, dä häut schalekich (Nimm dich vor dem in Acht, der schlägt gemein zu). Ein besonders scharf geschliffenes Messer war e schalekich Metz. Eine perfekt gedengelte Sense besaß ene schalekije Schnedd (einen „giftigen“ Schnitt). Eine mächtige Blutblase an der Hand des Mitspielers erregte Aufmerksamkeit in der Skatrunde: Jung Manes, do häßte dech äwwer schalekich jequadd (schlimm gequetscht), und der Unglücksrabe kommentierte: Ijoo, dat dejt och schalekich wieh (Jawohl das tut auch jämmerlich weh). Für das Einschlagen von Zaunpfählen mit dem Zehnpönner (Zehnpfünder, Vorschlaghammer) waren kräftige Armmuskeln erforderlich, man musste ene schalekije Schlaach am Liev haben (mächtig zuschlagen können).
Schalingsei
Ein ohne feste Schale abgelegtes Vogelei in der elastischen Schalenhaut. Die offizielle Bezeichnung ist „Windei“ (Bünting, Deutsches Wörterbuch 1996), wobei allerdings das Windei auch ein Begriff aus der Medizin ist. Unsere Hühner daheim produzierten relativ häufig Schalingseier, meistens fanden wir die schwabbeligen Gebilde in einem der zahlreichen Legenester, gelegentlich aber auch im Stall oder sogar draußen im Hof, wo das Federvieh seinen Futterplatz hatte. In aller Regel blieb ein Schalingsei heil, sofern es nicht zertreten wurde, die dünne Haut war beinahe durchsichtig, aber erstaunlich elastisch und stabil. Schalingseier wurden bei uns vorsichtig mit der Hand oder besser noch mit einem Löffel aufgenommen und in die Pfanne getan: Als Spiegelei waren sie durchaus verwertbar. Vermehrt fanden wir Schalingseier, wenn unsere Pölle (Junghennen) mit dem Eierlegen begannen, und hierbei gab es auch öfter zwei Dotter in einem Ei. Das sei bei Junghennen nicht selten, las ich bei Wikipedia, und ganz allgemein seien Windeier ein Zeichen von Kalkmangel. Das muß wohl stimmen, denn unsere Hühner waren geradezu erpicht auf zerkleinerte Eierschalen. Nur gab es die bei uns nicht allzu oft: Die meisten Eier wurden im Kaufladen gegen Waren eingehandelt, und also waren besonders wir Pänz dankbar für jedes Schalingsei.
Schall
Das Wort steht in keinem Zusammenhang mit dem hochdeutschen „Schall“ (Klang, Hall), von dem es sich auch durch die Aussprache unterscheidet: Das Mundartwort wird mit kurzem scharfem a gesprochen (Beispiel: der Ort Kall). Unser Schall ist weiblichen Geschlechts: De Schall, bezeichnet aber ein Maskulinum, nämlich den Riegel (Sperrvorrichtung, Verschluss). Auf den ersten Blick scheint ein Zusammenhang beider Begriffe kaum erklärbar, vermutlich geht aber die mundartliche Schall auf das mittelhochdeutsche „schalten“ zurück, das soviel wie „schieben, stoßen“ bedeutete. „Schalter“ war das Wort für „Riegel, Schieber,“ die Eifeler Schall könnte man auch als Schalte bezeichnen, damit wäre auch das weibliche Wortgeschlecht begründet. De Schall ist eins der fast völlig vergessenen Dialektwörter unserer Heimat, unsere Eltern verwendeten es für jede Art von Riegel, wobei dessen Größe und Beschaffenheit bedeutungslos war. Die klassische Eifeler Schall gab es früher an jeder Stalltür, deren Ober- und Unterteil jeweils durch eine massive eiserne Schall verschließbar war. Eine Schall als Verschluss gab es im Übrigen an sämtlichen Außentüren, Luken und Läden im ländlichen Anwesen, oft waren diese Riegel zusätzlich durch ein Vorhängeschloss gesichert. Ganz früher bestand die Schall aus einem Holzschieber, was in der niederländischen Sprache anschaulich zur Geltung kam: Der Holzriegel war das „dwarshout,“ und das hieß „Querholz.“
Schällmetz
Etwas zaghaft fragte ich vor Jahren beim Landhandel in Blankenheim nach, ob es wohl noch ein Schällmetz zu kaufen gebe. Wievill Stöck wellste dann han? lachte der Verkäufer und griff ins Regal. Schällmetz bedeutet in der Standartsprache „Schälmesser“ und bezeichnet ein Kartoffel- oder Obstschälmesser im Haushalt. Das Eifeler Schällmetz dagegen war ein Schäleisen, das der Waldarbeiter zum Entrinden der Nadelbäume brauchte. Mit dem Aufkommen der Holzerntemaschinen wurde das Schälwerkzeug weitgehend überflüssig, daher meine zaghafte Frage beim Händler. Der Forstbeamte hatte mir ein paar Läuterungsfichten geschenkt, die wollte ich fällen. Schällmetzer (Mehrzahl) gab es in den verschiedensten Ausführungen. Ich kaufte mir damals ein dreieckiges „Dauner Schäleisen,“ dessen schräge Seiten ebenfalls klingenartig geschliffen und zum Abhacken von Geäst geeignet waren. Die Handhabung des Geräts erforderte eine gute Portion Geschicklichkeit und Muskeleinsatz. In langen Streifen wurde die Rinde vom Baum gelöst. Wenn dabei der „Ansatzwinkel“ des Eisens nicht stimmte, hakte es im Holz oder glitt aus der Bahn. Dünne Äste wurden mit der Rinde abgehoben, massive Zweige mussten zuvor mit der Axt dicht am Stamm abgehackt werden. Etwa stehen gebliebene Aststümpfe waren ein massives Hindernis beim Schälen. Bei uns daheim besaß Ohm Mattes ein Schällmetz, der lange Stiel war vom jahrzehntelangen Gebrauch und vom Fichtenharz schwarz geworden.
Schandarm
Das Wort kennt jeder als landläufige Bezeichnung für den Polizisten. Die Betonung liegt auf der Silbe „darm,“ gehässige Zeitgenossen trennen aber die beiden Silben und legen die Betonung auf „Schand,“ woraus sich dann der „Schand-arm“ ergibt, ein ziemlich nichtssagendes Wort. Früher gab es in jedem Dorf einen Schandarm, er zählte in der Regel zur Dorfprominenz, wie auch der Lehrer und der Pastor. Nebenbei galt er auch ein wenig als wirksamer Kinderschreck: Paß op, dr Schandarm kret dech konnte gelegentlich wahre Wunder wirken. Der letzte Dörfer Schandarm nach dem Krieg hieß Drangosch, den Vornamen weiß ich nicht mehr. Er wohnte im Haus von Peter Schlich vor der Bahnbrücke und war für die Leute mit sauberer Weste ein umgänglicher Mensch. Es gab aber auch Zeitgenossen, die ihn fürchteten. Einmal hat er das halbe Dorf vernommen, weil an einem Haus dreimal ein „Esel“ gemalt worden war (Der Bewohner hatte die Herausgabe von „Maieiern“ verweigert). Herr Drangosch hat den oder die Täter nie ermittelt, – vielleicht wollte er das ja auch gar nicht? Sein Vorgänger wohnte ebenfalls im Hause Schlich, er hieß August Sünnemann und hat sich aus unbekannten Gründen am 07. April 1938 das Leben genommen. Im Krieg war der Schandarm ein gefürchteter Mann, er trug braune Gamaschen, kam überfallartig mit dem Motorrad und forschte im Eifelhaus nach „schwarzen,“ dem „Führer“ vorenthaltenen Lebensmitteln.
Schanditz
Wer von uns erinnert sich nicht gerne an Räuber und Schanditz (Räuber und Gendarm), jenes mit Sööke spelle (Suchen spielen) verwandte Versteckspiel aus Kindertagen? Die „Räuber“ mussten sich verstecken und wurden vom Schanditz gesucht. Das Wort ist abgeleitet vom mundartlichen „Schandarm“ (Gendarm) und bedeutet also „Polizist.“ Der Hintergrund des Spiels: Die Räuber hatten etwas verbrochen, mussten stifte john (stiften gehen, fliehen) und wurden von der Polizei gesucht. Dazu gibt es ein selbsterlebtes Anekdötchen. Es war im Oktober 1952, unser Pastor Hermann Lux war vor wenigen Tagen nach Kempen umgezogen. Der Seelenhirte war ein großer Imker vor dem Herrn, in seinem jetzt leerstehenden Bienenhaus suchten ein Kumpel und ich als „Räuber“ Unterschlupf vor dem Schanditz. Im Häuschen war es ziemlich dämmerig. Auf dem Wandbrett stand eine gewichtige Zigarrenkiste, der nach Öffnen des Deckels ein intensiver „Duft“ entströmte. Da hatte einer etwas hinein getan, dessen man sich ansonsten auf dem gewissen „Örtchen“ entledigte, - offensichtlich waren schon vor uns „Räuber“ dagewesen. Ich stellte die anrüchige Sache ins Regal zurück. Mein Kumpel griff in der Dämmerung in die Kiste, roch und fühlte Unheil, wischte sich an einer alten Schaaz (Decke, Tuchplane) die Finger ab, begab sich in die entfernteste Ecke und rief von dort: He, kick ens, wat do en der Zijarekoß os (Schau mal nach, was in der Zigarrenkiste drin ist). Diese Aufforderung überhörte ich angelegentlich.
Schang
Ein heute noch gebräuchliches Relikt aus der Franzosenzeit : Die Verdeutschung des französischen Männernamens Jean. Der Eifeler Dialekt kennt allerdings überwiegend den Ausdruck Schäng. Der letzte Bürgermeister der selbständigen Gemeinde Blankenheimerdorf hieß Johann Leyendecker, an der Oberahr kannte man ihn aber nur als Schang, ganz einfach Schang ohne den Familiennamen oder Wohnort. Das war sozusagen sein Markenzeichen, Schäng war geradezu unmöglich und hätte absolut nicht zu der markanten Persönlichkeit gepasst. Schang war ein Begriff an jedem Ratstisch, in jeder Verwaltung, sogar im Kreistag, einen zweiten Schang gab es nicht. Leyendeckesch Schang war vom 02.11.1948 bis zur kommunalen Neugliederung 1969/70 Bürgermeister im Dörf, und dass er sein „Handwerk“ verstand, beweisen fast 22 Amtsjahre. Schang starb am 11. Juni 1971 im Alter von 77 Jahren. Der Platz an der Nürburgstraße gegenüber seinem damaligen Wohnhaus ist nach ihm benannt: Jean-Leyendecker- Platz. Ich erinnere mich noch gut an das Wohnzimmer im Giebel zur Ortsdurchfahrt hin, das gleichzeitig das Büro des Bürgermeisters war. Dort empfing Schang den Amtsdirektor oder sonstigen „höheren“ Besuch. Der Durchschnitts-Dörfer wurde in die Wohnküche rechts neben der Haustür geführt. Dort stapelten sich auf der langen Holzbank hinter dem ebenso langen Tisch die aktuellen Dorfakten. Mich hat immer beeindruckt, wie zielsicher Schang aus diesem Aktenberg stets die im Augenblick benötigten Papiere herauszufischen verstand.
schänne
Was in weiten Teilen der Eifel mit „schänge“ bezeichnet wird, heißt an der Oberahr schänne und bedeutet „schimpfen, zanken, sich beschweren.“ Ein ähnliches Wort ist schenne, das aber mit weichem e gesprochen wird und „schinden, verletzen“ bedeutet. Wenn ech net pünktlich sen, schännt menge Feldwebel, ist eine gängige Begründung für das vorzeitige Verlassen der Frühschoppenrunde. Im Streit wegen Nachbars Hundegebell fielen harte Worte und Fränz stellte fest: Die schännen sech üß wie de Läppere (Die beschimpfen sich wie die Kesselsflicker). Bei kindlichen Zankereien griff man nicht selten zu einer Drohung als Argument: Dat sohn ech denger Mam, dann kreßte se van der jeschannt (Das sage ich deiner Mutter, dann schimpft die mit dir). Schänne war gelegentlich auch ein Dialektausdruck für „schänden,“ wird aber kaum noch in dieser Bedeutung angewandt. „Schänden, verunstalten“ wird heute meist mit verschängeliere umschrieben. Am Stammtisch wurde laut und wortreich über den anhaltenden Regen gewettert, bis es schließlich Krämesch Pitter (der Wirt) zu bunt wurde: Ihr Muulräppeler, all schännt ihr üwwer dä Rään, äwwer kejner dejt jät drjähnt (Ihr Maulhelden, ihr schimpft alle über den Regen, aber keiner tut etwas dagegen). Der Gastwirt war wegen seines hintergründigen Humors allenthalben beliebt.
nach oben
Schanze
Schanze ist im Dialekt die Mehrzahl von Schanz und bezeichnet die Reisigbündel zum Beheizen des hauseigenen Backofens, den es früher in fast jedem Bauernhaus gab. Das Wort ist unverkennbar von den „Schanzen“ zur Befestigung von Kampfstellungen im Krieg abgeleitet. Eine gefällte Buche wurde früher „mit Stumpf und Stiel“ verwertet: Der Stamm war Nutz- oder Brandholz, die stärkeren Äste kamen als Knöppele (Knüppel) zum Brandholz. Aus dem Geäst sortierten sich dann die Leute noch ihr benötigt Quantum an Äezerieser (Erbsenreiser, Kletterhilfe für die Erbsen) heraus, das schwache Geäst und Reisig wurde zu armlangen Schanze zurecht gehackt und gebündelt. Die Bündel waren in ihrem Umfang so bemessen, dass sie ungeöffnet gut durch die niedrige Backofentür passten. Als Bindematerial dienten dünne Wegge- (Weiden-) oder Noßheckejusche (Haselnussruten), die mit verbrannten. Die Schanze wurden unter dem weit vorspringenden Schuppendach gelagert, wo sie von der Sonne ausgedörrt wurden. Im Backofen entfachte das trockene Material im Handumdrehen ein Höllenfeuer. Es verbrannte unterdessen auch rasch und man musste häufig nachlegen. Besondere handliche Schanzenbündel wurden gelegentlich auch zum Herdanheizen verwendet.
Schauß
Das „Dörfer Platt“ ist beinahe eine Wissenschaft für sich, für die es unterdessen keine Regeln gibt. Man muß eben einfach nur Vokabeln lernen und beispielsweise wissen, dass ein Schauß eine Schublade ist. Was in der nächsten Nachbarschaft, etwa in Nonnenbach,“ ein Schoss (hartes o) ist, das wird im „Dörf“ eben zum Schauß. Ein kleines Schublädchen ist ein Schäußje und mehrere Schubladen sind Schausser. Ähnliche Dörfer Beispiele: Aus Rost wird Rauß, aus Schloß (Verriegelung) wird Schlauß, aus Moos wird Mauß, aus Post wird unterdessen nicht etwa Pauß sondern Poss. Der Schausser gab es eine ganze Menge im Eifelhaus, in erster Linie natürlich das klassische Deschschauß (Tischschublade). In unserem langen Stubentisch daheim gab es zwei Schausser, in einem davon wurde das Essbesteck aufbewahrt, in dem Zweiten fand sich alles Mögliche, vom alten Taschenmesser über Bleistiftstummel und einen halben Zollstock bis zum Pflasterstreifen und Hosenknopf. In die Stubenwand eingelassen war ein zweitüriges Wandschaaf (Schrank) und darunter zwei Wandschausser zum Aufbewahren wichtiger Papiere und Akten. Küchenherd und Stubenofen besaßen ein Eischeschuß (Aschenkasten), und im massiven Küchentisch gab es zwei geräumige Spöölschausser (Spülschubladen), die aber nie gebraucht wurden und mit altem Küchenkram gefüllt waren. Et Schäußje war ein fester Begriff für die Hausbewohner und bezeichnete das lange schmale Schubfach unter dem Nähmaschinentisch. Ein weiteres Schäußje gab es an der mechanischen Kaffeemühle: Das kleine Schubkästchen zum Auffangen des Kaffeepulvers. Wenn im Haus irgendein kleiner Gegenstand gesucht wurde, half in vielen Fällen der allgemeine Rat: Kick ens em Schauß (Schau mal in der Schublade nach), und wenn es Zweifel am Verstand eines Mitmenschen gab, hieß es hinter der Hand: Dä hät se net all em Schauß oder auch Dä hät et Schauß op (Der hat die Schublade offen).
Schauter
Das Wort ist heute noch gebräuchlich, es hat zweierlei Bedeutung und zwar gegensätzlicher Art. Bei uns in Blankenheimerdorf bezeichnet man mit Schauter einen zwar etwas „verdrehten,“ im Übrigen aber lustigen und ob seiner Spässe und seines Humors allenthalben im Dorf beliebten Zeitgenossen. Ein ähnlicher Begriff ist Dollschlaach, der den Schauter noch treffender charakterisiert (siehe: Dollschlaach). Wie die Kölner Originale „Tünnes un Schäl,“ so gab es früher in fast jedem Eifeldorf zumindest eine Person, deren „Künstlername“ auch über die Ortsgrenzen hinaus guten Klang besaß. Stombs Wellem war beispielsweise ein solcher Schauter in Blankenheimerdorf (siehe: Stombs Wellem). Gelegentlich möchte man den Gesprächspartner schonend darauf hinweisen, dass man seinen Worten nicht so recht glauben kann. Um nicht kränkend zu wirken, bedient man sich gutmütigen Spotts: Du solls mir wahl en dolle Schauter sen. Gelegentlich vertauscht man zusätzlich noch die Anfangsbuchstaben, und so entsteht dann der „scholle Dauter.“ Solche Worte werden in der Regel nicht übel genommen. Regional ist auch Schaute gebräuchlich, und damit wird dann ein Angeber tituliert, der große Sprüche klopft und mehr scheinen möchte als er tatsächlich ist.
Schavuën (stimmloses e)
Das Wort kommt in unserer Eifel in mehrfacher Form zur Anwendung: Schavu, Schavuë, Schavuër oder, wie bei uns in Blankenheimerdorf üblich, Schavuën, die Betonung liegt in allen Fällen auf dem u. Mit dem Ausdruck Schavuën bezeichnen wir den Wirsing, der sich vom Weißkohl durch krause grüne Blätter unterscheidet. Der Weißkohl ist bekanntlich unser Kappes (siehe: Kappes), aus seinen festen weißen Blättern wird unser Sauerkraut hergestellt. Die Verschiedenartigkeit beider Gemüsesorten muss wohl bereits im vierten Jahrhundert bekannt gewesen sein, denn eine nicht so ganz ernst zu nehmende Abänderung des Sankt Martin-Liedtextes besagt: Sankt Martin ritt durch Kappes und Schavuën… Während das Sauerkraut (siehe: Suëre Kappes) sozusagen als „Nationalspeise“ angesehen wird und uns bei den Amis den Spitznamen „Krauts“ eintrug, wird aus Schavuën nicht weniger leckeres Gemüse fabriziert, beispielsweise Schavuën önerenanner (untereinander), wie es bei uns daheim genannt wurde: Wirsing mit gestampften Kartoffeln vermischt, schön mit brauner Butter übergossen, dazu geräucherter durchwachsener Speck oder eine Mettwurst, – eine deftige Mahlzeit, die sich auch heute noch sehenlassen kann und ihre Liebhaber besitzt. Bei uns daheim wurde die Schavuën zusammen mit Kappes und Kolerawe (weiße Rüben) vom Feld geerntet. Ein kleiner Teil wurde zum alsbaldigen Verbrauch im kühlen Erdkeller gelagert, der größte Teil wurde unterdessen eingemacht, weil es bei uns keine Gefriergeräte gab.
Schellemstöck (weiches ö)
Das Schelmenstück, auch Schelmenstreich genannt, war ursprünglich das Charakteristikum von Till Eulenspiegel, der im 14. Jahrhundert in der Gegend von Braunschweig gelebt haben soll. Schellemstöcker (Mehrzahl) waren unterdessen auch im Eifeldorf noch nach dem Krieg an der Tagesordnung, wobei „an derNachtordnung“ eigentlich treffender wäre. Wenn sich gegen Abend mehrere Dorfburschen an zentraler Stelle zusammenfanden, wurden die Leute wachsam: Paß op, dies Nääch were wiër Schellemstöcker jespellt (diese Nacht werden wieder Streiche gespielt). Bei uns im „Dörf“ war Hammesse Eck ein solcher Treffpunkt, man hockte bequem auf der eisernen Schutzstange vor dem Schaufenster, – bis Hammesse Hein spitze Eisendorne aufschweißen ließ. Ein beliebtes Dörfer Schellemstöck war das Zusammentragen von Hausrat am Denkmalplatz unter der Riesen-Kastanie. Das geschah stets in der Samstagnacht und war mit einigem Aufwand verbunden: Aus dem ganzen Dorf wurden Gartentörchen, mobile Hofbänke, Melkstühle oder Schubkarren zusammengeschleppt. Wenn die Leute am nächsten Morgen zur Frühmesse kamen, türmte sich ein Berg aus Hausgerät an der Kastanie. Nach der Messe schleppte man dann, – der Eine in Erinnerung an eigene Schellemstöcker verstohlen grinsend, der Andere zähneknirschend – sein Eigentum mit nach Hause. Ein anderer Streich war das Zustopfen der aus der Hauswand ragenden Spülsteinabflüsse (es gab noch keine Kanalisation). Im Computerzeitalter von heute gibt es keine harmlosen Schellemstöcker mehr, heute werden Gartenzäune umgerissen, Blumenkübel zerdeppert und Grabanlagen beschädigt, – und das sind Straftaten.
Schepp
Das Hauptwort Schepp ist von scheppe abgeleitet, was „schöpfen“ bedeutet. Die Schepp ist somit eine „Schöpfe,“ ein Schöpfgerät, eine Schöpfkelle. „Scheppen“ ist auch das holländische Wort für „schöpfen.“ Früher gab es über oder neben dem Küchenherd im Eifelhaus das weiß emaillierte „Löffelblech,“ an dem neben Bratenwender, Fleischgabel und Schüümleffel (Schaum-, Sieblöffel) auch die Zuppeschepp (Suppenkelle) hing. In der Kannebank (Holzregal zur Aufnahme von Töpfen, Kannen, Eimern) standen die gefüllten Wassereimer, und dabei hing am Nagel die Wasserschepp zum Durstlöschen. Häufig anzutreffen war auch die Melechschepp (Milchgefäß), ein kannenartiger Behälter mit Deckel, Griff und Ausguss. Der Inhalt war dem täglichen Bedarf im Haushalt angemessen. Die Melechschepp war keine Kelle, ebenso nicht die ovale, flache und meist weiß emaillierte Weischschepp (Waschschüssel). Sie wurde morgens mit Wasser beschickt und diente während des ganzen Tages den Hausbewohnern als Handwaschbecken, - es gab ja noch keine Wasserleitung. Schließlich kannte man früher noch die Maarschepp, ein Zinkeimer an langem Stiel zum Düngen des Gartenbodens mit dem Inhalt der Jauche- oder Fäkaliengrube, - damals ein übliches Verfahren.
schilze
Die eigentliche Bedeutung ist „schielen,“ weitere Anwendungen sind unterdessen „scharf ins Auge fassen, lauern, beäugen, spähen.“ Ein gleichartiges Wort ist spenkste, das in erster Linie für „spionieren“ gebraucht wird. Dä schilz dauernd noo menger Kaat (Der schielt dauernd nach meinen Karten) beschwerte sich einer in der Skatrunde über seinen Nachbarn. Wer ein Schielauge besaß, wurde hinter der Hand Schilzer genannt, ein solcher Mensch konnte sich mot dem räechte Ouch en de lenk Westenteisch kicke (mit dem rechten Auge in die linke Westentasche schauen). Ein hinterlistiger oder unsympathischer Mitmensch war für seine Umwelt e schilzich Loder oder auch ene schilzijen Hond. Das unangenehme Empfinden, beobachtet zu werden, drückte man so aus: Et os mir, als wüer ech andauernd beschilz. Der Ausdruck schilze hatte in jedem Fall einen unguten Beigeschmack. Das die jungen Burschen heute wie damals noo de Mädcher schilze, ist eine ganz natürliche Angelegenheit, wenn aber einer die heimlich Verehrte gar nicht mehr aus den Augen lässt, lästern seine Altersgenossen: Du schilz dir noch de Oure vüer dr Kopp (wörtlich = …die Augen vor den Kopf).
Schlabberläppche
Der Normalbürger geht davon aus, dass generell nur Kleinkinder und alte Leute sich beim Essen und Trinken „beschlabbern“ (siehe auch: besejwere). Dem Knigge-kundigen und damit „kultivierten“ Zeitgenossen sollte eigentlich jegliches Beschlabbern fremd sein, ein Missgeschick kann aber selbst dem kultiviertesten Esser widerfahren, also braucht auch er ein Schlabberläppche, das er allerdings vornehm als Serviette bezeichnet. Wenn Baby sein Fläschchen oder Breichen bekommt, geht häufig etwas daneben und wird vom Schlabberläppche aufgefangen, das wir auch Sejwerläppche nennen. Unsere Standardsprache kennt nur das „Kinderlätzchen,“ und das gibt es in zahllosen Variationen, Farben und Größen und mit den mannigfachsten kindlichen Motiven ausgestattet. Das Schlabberläppche unserer Kinderzeit war von Mam oder Jött selbst gehäkelt oder gestrickt und zur Verschönerung mangels Bilder mit einem schönen leuchtend farbigen Rand versehen. Das Tafelläppchen an unserer Schiefertafel war von gleicher „Bauart.“ Für uns heranwachsende Kinder war es bei Tisch oberstes Gebot, nicht zu schlabbern. Wenn dennoch etwas daneben ging, geriet man leicht als Schlabberdönes oder Schlabberbotz in Misskredit, und Jött hatte wieder einmal einen Grund zum Meckern: Nächstens hangen ech dir Schlabbertünnes e Sejwerläppche öm.
nach oben
Schladerbotz (weiches o)
Ein Kinder-Kleidungsstück für Jungen aus Omas Tagen. Eine Schlader ist eine Klappe oder jedenfalls eine Einrichtung, die durch Auf- und Abwärtsbewegungen zu schließen oder zu öffnen ist. Die Botz ist bekanntlich das Wort für „Hose,“ die Schladerbotz ist somit eine „Klapp- oder Klappenhose.“ Ich selber habe im Vorschulalter noch von Mam selbstgefertigte Schladerbotze getragen. In der Regel war die Schladerbotz hinsichtlich ihrer Machart mit einem „Blaumann“ vergleichbar: Ober- und Unterteil waren aus einem Stück gefertigt, die Hosenbeine reichten bis auf die Knie, der Hosenboden bestand aus der eigentlichen Schlader, die im „Ruhezustand“ hochgeklappt und mit zwei Knöpfen am Oberteil befestigt war. Das Herunterlassen im „Bedarfsfall“ ging in Sekundenschnelle vonstatten, und das wirkte sich bei Dönnflitsch (Durchfall) äußerst vorteilhaft aus, zumal man selten Unterwäsche trug. Ein alter Frontkämpfer hat mir einmal erzählt, dass er sich oft im massiven Feindfeuer eine Schladerbotz gewünscht hätte. Er verhehlte nicht, dass auch der tapferste Soldat manchmal Todesangst verspürt. Meine eigenen Schladerbotze waren zweiteilig: Das Oberteil war eine Art Leibchen mit halblangen Ärmeln, Das Unterteil, die eigentliche Hose, war mit mehreren Knöpfen rund um den Leib am Oberteil befestigt. Das Vorderteil der Hose besaß weder einen Schlitz noch sonst eine, eigentlich notwendige Öffnung. Bei Bedarf wurde hier das Hosenbein hoch gestreift. Die Hosenbeine waren extra wegen dieser Funktion weiter als üblich geschnitten, – es mußte ja ein gewisser „Freiraum“ für die Prozedur vorhanden sein. Mit dem Beginn der Schulpflicht wurde bei mir die Schladerbotz abgeschafft.
Schleckstöck (weiches e und ö)
Wörtlich „Schluckstück,“ bezeichnet also die Kehle. Ein ähnliches Wort ist Schleckes. Die Ausdrücke wurden und werden meist in negativen Redewendungen angewandt: Jeff dech en de Rouh soß kreste eene vüer et Schleckstöck (Gib Ruhe oder es kracht). Pitter hatte Halsschmerzen und knurrte vor sich hin: Ech wejß net, wat mot mir loss os, et Schleckes dejt mir wieh. Als Kinder hatten wir bei jeder kleinen Erkältung Halsschmerzen, et em Hals han (es im Hals haben) war unser Ausdruck dafür. Wenn uns also et Schleckes wieh doot (weh tat), griff Jött zum Wundermittel: Abends vor dem Zubettgehen wurde unser linker Strumpf – auch wir Jungens trugen lange Strümpfe – um den kranken Hals gebunden. Warum es unbedingt der Strumpf vom linken Bein sein musste, das wussten wahrscheinlich nur die Götter und unsere Jött. Dabei musste das Fußteil des Wickels auf dem Schleckstöck und damit an der Kehle plaziert werden. Am nächsten Morgen wurde der Strumpf wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt, bei Bedarf wurde die Prozedur am Abend dann wiederholt, was aber oft nicht erforderlich war. Es klingt absurd, aber die ziemlich „rustikale“ Halskur war nicht immer, aber oft erfolgreich, ich habe es am eigenen Schleckstöck erfahren.
Schlejf
Etwas hinter sich her ziehen, schleppen also, bezeichnen wir im Dialekt als schlejfe, der geschleppte Gegenstand ist die Schlejf, was übersetzt „Schleife“ bedeutet, aber nicht mit der hochdeutschen Schleife in Zusammenhang steht. Die nämlich heißt bei uns Schleif, und das Schleifen (Schärfen, Polieren) nennen wir schliefe. Bei uns gibt es den seltsamen Namen Bähneschlejf, was „Wiesenhobel“ bedeutet. Mit einer selbstgebauten Bähneschlejf versuchte seinerzeit Bürgermeister Toni Wolff vergeblich, unser Wiesenfestgelände zu „rekultivieren“ (siehe: Bähneschlejf). Eine Schleifspur im Gelände, etwa beim Holzrücken, nennt man schlicht en Schlejf. Wenn beim Viehhüten eine Kuh ins Kornfeld geraten und eine „Gasse“ hinein getrampelt hatte, hab es nicht selten ob einer solchen Schlejf gewaltigen Ärger mit dem Eigentümer. Am alten Forsthaus Salchenbusch stand jahrzehntelang die Nonnenbacher Schlejf, ein selbst gebauter hölzerner Schneepflug aus starken Eichenbohlen, mit massivem Eisenbeschlag und einem Sitz für den Lenker. Die Spurbreite war verstellbar und betrug ausgefahren etwa drei Meter. Zu meiner Kinderzeit, als es bei uns noch keine Räumfahrzeuge gab, wurde die Straße nach Blankenheimerdorf mit der Schlejf mehr schlecht als recht befahrbar gemacht. Das von zwei Pferden gezogene Gerät war, trotz der massiven Bauweise, für größere Schneeverwehungen viel zu leicht, die gezogene Gasse war außerdem für eine Begegnung zweier Fahrzeuge zu schmal, in bestimmten Abständen mussten von Hand Ausweichstellen angelegt werden. Die alte Schlejf dürfte inzwischen weitgehend vermodert sein, vor etwa 15 Jahren lag sie bereits fast völlig versteckt unter dichtem Brombeergeranke.
schlejfe
Die Holländer sagen sehr treffend „slepen,“ was unserem „schleppen“ entspricht. Die im vorhergehenden Beitrag erwähnte Schlejf heißt in Holland „sleep.“ Regional kennt unsere Mundart auch Schleef und schleefe. Heutzutage hat dank der Technik der Begriff schlejfe viel an Bedeutung verloren, moderne Maschinen erledigen im Handumdrehen vieles, was früher für unsere Eltern mühselige Plackerei bedeutete. Da mussten unter anderem täglich die schweren Wassereimer vom Lohrbach herauf jeschlejf werden, weil es bei uns keine Wasserleitung gab. Brennholz musste aus dem Holzschuppen eren (herein, ins Haus) und die Kartoffeln aus dem Keller erop (herauf) jeschlejf werden. Wenn Drinche im März op Kasseler Drout senge Namensdaach reiste, begutachtete Mattes kopfschüttelnd den schweren Koffer und meinte: Moste wiër et halev Huus mot schlejfe (Musst du wieder das halbe Haus mit schleppen). Der Transport des Karrenpflugs am Heck des Ackerwagens war ein geradezu klassisches Beispiel fürs Schlejfe: Der Pflug lag auf der Ploochschlejf und die schleifte im Sinne des Wortes über den Boden. Einer aus der Wandergruppe stöhnte erschöpft: Losse mir ens e Päusje maache, mir schlejfen de Fööß öwwer dr Boddem (…meine Füße schleifen über den Boden). Wer sich um nichts kümmert und seiner Pflicht nicht nachkommt, der läät alles schlejfe (lässt alles schleifen), und ein umständlicher, behäbiger Zeitgenosse ist für seine Mitmenschen en Schlejfbotz.
Schlenne (weiches e)
Der Schlehdorn ist geradezu ein Charakteristikum unserer Eifel, herb und anspruchslos wie unsere Heimat. Seine Früchte, die Schlehen, sind sauer und bitter, werden aber nach ein paar Frostnächten wohlschmeckend und weich. Schlenne nennen wir die tiefblauen Kügelchen, die zum Großteil aus einem dicken und harten Kern bestehen, daheim in Nonnenbach sagten wir Schlinne. Bei uns in Schlemmershof gab es dicht bei jedem der vier Häuser ein ausgedehntes Schlehdorngebüsch, de Heck (die Hecke) genannt. In den mannshohen stacheligen Gewächsen bauten wir Kinder uns unser „Büdchen.“ Das ging nicht ohne diverse Schrammen und blutige Hautkratzer, doch das war unerheblich und gehörte dazu. Am Weidefeuer hielten wir einen Schlehenzweig in die Flamme – Brootschlenne (Bratschlehen, hartes o) waren köstlich, auch wenn sie meistens schwarz angesengt waren. Echt wohlschmeckend werden Schlenne nach ein paar Frostnächten, wenn sie aufgeplatzt sind und das frostrot gewordene Fruchtfleisch seine Bitterkeit verloren hat. Als Kinder sammelten wir die steinhart gefrorenen Früchte und lutschten „Eisschlehen.“ Wenn früh im März de Schlenne blöhe (die Schlehen blühen), lange bevor der Strauch grün wird, kündet die weiße Pracht vom Frühlingserwachen und erfreut unsere wintermüden Augen. Eine Bauernregel besagt: „Je eher im April der Schlehdorn blüht, desto früher der Gärtner zur Ernte zieht.“ Aus Schlenne lässt sich übrigens ein köstlicher und sehr „feuriger“ Aufgesetzter herstellen.
Schlennebüß (weiches e)
Regional, beispielsweise in Nonnenbach, auch Schlinnebüß, ein selbst gebasteltes Spielzeug unserer Kindertage: Die „Schlehenbüchse,“ im Grunde ein sehr einfaches Druckluftgewehr, mit dem sich Papierkugeln – ursprünglich Schlehen, daher der Name – ein paar Schritte weit verschießen ließen. Das besonders Reizvolle an dem primitiven Spielzeug war der beim „Schießen“ hörbare leichte Knall. Die Schlennebüss bestand aus einem 20 bis 30 Zentimeter langen Stück Holunderholz, aus dem das weiche Mark entfernt wurde. Unser Holunderbaum im Garten hat manchen Ast für den Bau einer Schlennebüss hergeben müssen. Dazu gehörte ein Stößel, den wir uns aus einem Haselstecken zurecht schnippelten und der in den „Holunderlauf“ hinein passte. Aus den Seiten des „Westdeutscher Beobachter“ wurden kleine Papierkugeln geformt, angefeuchtet und an beiden Enden in den „Lauf“ gesteckt. Ein kräftiger Stößelschub, und die vordere Kugel flog davon. Mit dem harmlosen Spielzeug war kein Schaden anzurichten, unsere Schlennebüss wurde unterdessen nach dem Krieg durch selbstgebaute „Pistolen“ ersetzt, die mit richtigem Schießpulver aus Gewehrmunition betrieben wurden und sehr wohl gefährlich werden konnten.
Schlopp
Der Schlopp ist eine Schlaufe, Schleife oder Schlinge und heißt regional auch Schläup oder Schlööp. Zu meiner Kinderzeit waren Schlöpp en de Hoor (Schleifen im Haar) ein gängiger und beliebter Kopfschmuck der Schulmädchen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Haartracht meiner beiden älteren Schwestern, die auch noch auf alten Fotos zu bewundern ist: Die halblangen Haare wurden in zwei kräftige Zöpfe geflochten, deren Enden mit einem Spängche (kleine Haarspange) stabilisiert und mit einem Schlöppche (Schleifchen, meistens aus rotem Gewebe) dekoriert wurden. Unser Nesthäkchen trug im Vorschulalter einen gewaltigen Schlopp mitten auf dem Kopf, die riesigen Schlaufen erinnerten an ein Windrad. Der normale Schlopp besteht aus einem so genannten „Kreuzknoten“ mit beliebig großen Schlaufen, durch leichten Zug an einem der beiden Enden lässt sich der Knoten auch bei Belastung leicht öffnen. Die Schürzenbändel der Frauen und Mädchen war im Rücken durch einen Schlopp gebunden, der sich leicht und unbemerkt „aufziehen“ ließ. Tunlichst ließ man sich unterdessen bei diesem Opschlöppe (Schleife lösen) nicht erwischen. Das Zeitwort zu Schlopp heißt bei uns schlöppe und bedeutet somit „einen Schlaufenknoten herstellen.“ De Schohreeme schlöppe bedeutet also die Schnürsenkel binden (siehe auch: Reeme).
Schlotterfass
Mundartausdruck für den Wetzsteinbehälter oder Wetzsteinhalter, der beim Sensenmähen am Hosenbund im Rücken mitgeführt wurde. Auf alten Zeichnungen trägt ihn der Schnitter auch vor dem Bauch, wo er aber bei der Arbeit hinderlich war. Das klassische Schlotterfass war aus einem möglichst schnack (gerade) gewachsenen Rinderhorn gefertigt und mit einem Metallbügel zum Einhängen in den Gürtel versehen. Oft wurde der Behälter auch aus einem ausgehöhlten Weichholzstück oder aus Metall hergestellt. Das war aber nicht „standesgemäß“, Ohm Mattes beispielsweise hätte niemals ein Schlotterfass aus Zinkblech benutzt. Ganz früher besaß das beim Mähen unentbehrliche Gerät die Gestalt eines länglichen und an einem Ende offenen Holzfässchens, das im Rhythmus der Körperbewegungen beim Mähen am Gürtel schaukelte. Der Schliefstejn (Schleifstein) schlackerte und schlotterte deutlich hörbar mit, daher der Name Schlotterfass. Um „griffig“ zu bleiben, musste ein guter Schleifstein immer möglichst feucht gehalten werden, das Schlotterfass enthielt also immer gerade so viel Wasser, dass es nicht überschwappte. Das Wasser verhinderte ein „Verschlammen“ des Steins durch Grasreste und Abrieb. Schlotterfass ist kein eifelspezifischer Ausdruck, das Wort kennt man beispielsweise auch im Hunsrück.
nach oben
schluddere
Ein umfassender Mundartausdruck für alles, was irgendwie unordentlich, nachlässig, unaufmerksam oder unvollkommen vor sich geht. Schluddere ließe sich in etwa auch mit „schlottern“ umschreiben: Kick ens, wie dä aanjeschluddert kött (schau mal, wie der angeschlottert kommt) bemängelt man beispielsweise den lässig daherkommenden Fußgänger. Für jeden akkuraten Chef und Arbeitgeber ist schluddere ein rotes Tuch, bej os wiëd net jeschluddert lautet die Zurechtweisung, die sich der Mitarbeiter wegen unordentlicher Arbeit an den Hut stecken muss. Mancheiner ist unterdessen unbelehrbar und bringt sich damit selber als Schludderpitter in Misskredit. Ein in seinem gesamten Wesen und Lebensstil nachlässiger Mitmensch handelt sich den allgemeinen Beinamen Schludder ein und ist wenig beliebt. Das Eigenschaftswort schludderich kommt in unserem Dialekt relativ häufig vor. So ist ein vernachlässigter Betrieb oder ein unordentlich geführter Haushalt als schludderich Wiëtschaff verrufen, ein Haufen unbrauchbares Zeug ist Schludderkroom (Kram) und eine unleserliche Handschrift ist Schludderschreff. Mit schluddere fast immer verbunden ist der Begriff „Schlamperei.“ So wird zum Beispiel auf mancher Baustelle durch schlampigen Umgang mit dem Material onnüëdich Jeld verschluddert (unnötig Geld verschleudert), das dem Auftraggeber später als „Materialverlust“ auf die Rechnung geschrieben wird.
Schluffe
On wenn die Aal op Schluffe kött, nach Hause gehen wir nicht, – Schluffe sind Pantoffeln, im weitesten Sinne Hausschuhe. Op Schluffe geht man an erster Stelle morgens früh, wenn man dem Bett entstiegen ist und den häuslichen Alltag beginnt. Wenn also die Aal op Schluffe kött, so bedeutet das den Tagesbeginn, und trotzdem gehen „standfeste“ Zecher noch nicht nach Hause… Einem verschwenderischen Luftikus prophezeiten früher die Leute: Dä kött ejnes Daach och op de Schluffe und das sollte zum Ausdruck bringen: Der hat bald keine Groschen mehr. Es soll auch heute noch häusliche Hieb- und Schlagwaffen geben, der Besenstiel beispielsweise, das Nudelholz oder die Riev (Küchenreibe), und zu diesem Arsenal zählen dem Vernehmen nach hier und da auch die Schluffe. Dem Spät- oder auch Frühheimkehrer beispielsweise drohen e paar mom Schluff honner de Uhre (ein paar Pantoffelhiebe hinter die Ohren). Wer eine Arbeit mit großer Ruhe und Besonnenheit verrichtet, der tut das Schlüffje vür Schlüffje. Der Ehemann, der getreulich und ohne Widerworte jeglichen häuslichen Auftrag erfüllt, ist ene treue Schluff, keineswegs aber auch ein Schluffes. Das nämlich ist ein Mensch, der müde und schlurfend einher geht, ein so genannter „Loß-mech-john“ (Laß-mich-gehen), dem die ganze Welt egal ist. Wer den Alkohol liebt, dem hängt leicht der Spruch dat os ene aale Schluffe, dä kann jo bloß noch suffe an. Und ein leichtes Mädchen wird gelegentlich Schlüffje genannt.
schlüppe
Das Wort erzeugt auf Anhieb eine angenehme Situation, bedeutet es doch soviel wie „mit Genuss und Wohlbehagen trinken,“ man könnte es auch mit „zufrieden schlürfen“ übersetzen. Wenn beispielsweise die Rede auf einen alten Bekannten kommt, dem man lange nicht begegnet ist, erinnert man sich spontan an erfreuliche Thekenrunden: Och joo, mir zwei han mänech Bierche zesame jeschlüpp. Der clevere Stammkneipenwirt lud gelegentlich zu einer Runde ein: Kott Männ, losse mir noch Ejne schlüppe (Kommt Männer, lasst uns noch Einen schlürfen) und daraus folgte, dass in der fröhlichen Runde anschließend noch intensiv dr Lappe nass jemääch (die Zunge angefeuchtet) wurde. Bei den Ausschachtungsarbeiten fürs neue Pfarrheim führten seinerzeit die Dorfsenioren Keschesch Lud (Ludwig Rosen) und Berchs Mattes (Matthias Berg) die „Bauaufsicht.“ Von Zeit zu Zeit zog Lud die „Baustellenflasche“ aus dem Versteck: Komm Mattes, schlüppe mir Ejne, und Mattes lachte: Jajaja, dat os en joot Idee. Früher, beim Flegeldreschen auf der Scheunentenne, stellte die Dreschmannschaft manchmal fest, dass et hie onjewööhnlicvh drüch (ungewöhnlich trocken) sei, worauf der Hausherr mehr oder weniger bereitwillig eine Runde „Flegelwasser“ spendierte: Hie, schlüppt ens düchtich, dann flupp et besser. Und beim Plausch mit der Nachbarin über den Gartenzaun hinweg, lud die Hausfrau unvermittelt ein: Wejßte wat, Drinche, komm jät eren, mir schlüppe flott e Köppche Kaffee. Das wurde oft ein ausgedehntes Schlüppe.
Schluußkorv
Der „Schließkorb“ war früher ein allgemein übliches Verpackungs- und Transportmittel für Gegenstände aller Art, er wurde bevorzugt auch als Reisegepäckstück verwendet und war meistens so gewichtig, dass zwei Personen ihn tragen mussten. Örtlich hieß der Behälter Schleeßkorv, bei uns war Schluußkorv bevorzugt, wie auch Schluuß anstelle von „Schloss.“ Der Schluußkorv war aus geschälten weißen Weidenruten geflochten und sah daher recht sauber und vorteilhaft aus, er war durch einen Decken und ein zusätzliches Kluuster (Vorhängeschloss) abschließbar, daher auch sein Name. Diebstahlsicher war der Korb selbstredend nicht, aber immerhin nur mit Gewaltanwendung zu öffnen. Obwohl nur Flechtwerk, war der Schluußkorv ein stabiles Behältnis, das maachliëchs (durchaus, sehr wohl) eine Zentnerlast aufzunehmen vermochte und zu diesem Zweck auch zwei stabile Handgriffe besaß, – ähnlich wie die Mang im bäuerlichen Betrieb. Unser Schluußkorv daheim war rechteckig, etwa 80 mal 50 Zentimeter groß und einen halben Meter hoch. Der Deckel war nicht aufklappbar, er wurde vielmehr aufgesteckt wie bei einer Schachtel, und war durch eine in Ösen steckende Metallstange und das Kluuster verschließbar. Er wurde eigentlich nie als Transportmittel benutzt, vielmehr stand er auf dem Kämerche (kleines Zimmer) herum und war mit alten Kleidungsstücken gefüllt. Aus meiner Bahnzeit ist mir noch in Erinnerung, dass damals häufig Schluußkörv (Mehrzahl) als Expressgut verschickt wurden.
schmaache
Essen hält bekanntlich liev on Siël bieënanner (Leib und Seele beieinander). Wenn ein Mitmensch nach längerer Krankheit wieder auf dem Damm ist, stellen die Leute fest: Et schmääch em wiër (es schmeckt ihm wieder) und das soll heißen: Er isst wieder, also ist er gesund. Schmaache ist mit dem holländischen „smaken“ identisch und heißt „schmecken,“ die Vergangenheitsformen sind schmooch und jeschmääch, regional auch schmaad und jeschmaad. Nach dem gemeinsamen Tischgebet eröffnete bei uns daheim Ohm Mattes das Mittagessen mit den Worten: Dann loot et öch schmaache (Dann lasst es euch schmecken, = Guten Appetit). Fürs Kochen war bei uns unsere Jött zuständig und sie kochte in aller Regel auch recht passabel. Einmal war ihre Suppe irgendwie „daneben geraten“ und die Tischgemeinschaft fand: Die Zupp schmääch wie affjestanne Spölwasser. Ihre Suppe schmeckte wie abgestandenes Spülwasser! Jött war eine ganze Woche lang beleidigt. Auch Martin Luther soll sich angeblich einmal in seinen Tischreden beschwert haben: „Warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmachet!“ Das waren derbe Tischsitten damals! Das Substantiv „Geschmack“ wird im Dialekt in einigen Fällen zum Jeschmaach, beispielsweise klagt die Hausfrau: Nu han ech ad zweimol noojewürz, - ech krejje ejnfach kejne Jeschmaach aan die Zupp. Bei anderer Gelegenheit bleibt das Standardwort unverändert: Dat os net noo mengem Jeschmack (Das gefällt mir nicht).
Schmackes
Die Herkunft von Schmackes ist nicht so ganz sicher nachweisbar, vermutlich geht der Ausdruck auf das frühere mundartliche Zeitwort schmacke zurück, das heute nicht mehr gebräuchlich ist und soviel wie „werfen, schmeißen, schlagen“ bedeutete. Artverwandt ist schmecke (weiches e), unser Wort für „mit der Peitsche schlagen, peitschen.“ Schmackes ist eine Art substantiviertes Zeitwort, unser Dialekt kennt diverse Formbildungen dieser Art, etwa Kriesches (von kriesche = weinen), Schennes (von schenne = schimpfen) oder Steiches (von steiche = stechen). Schmackes bedeutet auch „massives Zuschlagen, Hinwerfen, und damit im übertragenen Sinne „Prügel.“ Wenn ich in unserer Kinderzeit meine Schwester geärgert hatte, beschwerte die sich bei unserer Jött (Tante) und kam mit der Drohung zurück: Wenn Jött käm, jääf et Schmackes. In der Diskussion über eine Wirtshausprügelei fiel nicht selten das Wort Jung do hät et noch ens Schmackes jejenn. In diesem Zusammenhang war allerdings auch oft von Kasalla die Rede. Dieses Wort bedeutet etwa „Rabatz, Aufruhr, Ärger, Krawall,“ seine Herkunft konnte ich bisher allerdings nicht ergründen. Die Holländer kennen den Ausdruck „smakken,“ der einerseits „schmeißen“ bedeutet, ebenso aber auch das Zungenschnalzen beschreiben kann.
nach oben
Schmanddöppe (weiches ö)
Das Schmanddöppe ist der „Rahmtopf“ und der spielte in den Kriegsjahren eine bedeutende Rolle. Die Trommeln der Milchzentrifugen und die Flügeleinsätze vom Butterfass waren „requiriert,“ der Eifelbauer hatte die gesamte Vollmilch abzuliefern und bezog dafür von der Molkerei sein genau berechnetes Quantum Butter und Magermilch. Kein guter Bauersmann, der nicht Abhilfe gesucht und gefunden hätte. Schwitt, Minka und Schweizer (Tiernamen) lieferten manchen Liter „schwarze“ Milch, die wurde in Töpfe gefüllt und abgewartet, bis sich der Rahm an der Oberfläche absetzte. Daher stammt auch die in Süddeutschland und Österreich übliche Bezeichnung „Obers.“ In bestimmten Abständen wurde der Rahm abgeschöpft und im Schmanddöppe gesammelt. Bei ausreichender Menge wurde mit dem Briebeißem (Breibesen) im Stejndöppe (Steintopf) Butter geschlagen. Das war Verrat an Führer, Volk und Vaterland und eine massive Straftat, der durch überfallartige motorisierte Blitzkontrollen Einhalt geboten werden sollte. In jedem Haus gab es aber kontrollsichere Geheimverstecke (siehe: Eischekuhl) und der dorfinterne Nachrichtendienst funktionierte ausgezeichnet: Wir Pänz wurden beim Auftauchen der gefürchteten Beiwagenmaschine unverzüglich mit der Nachricht auf Trab gebracht: Dr Kontrollör os do, und dann verschwanden die verbotenen Schmanddöppe blitzartig im Geheimversteck, beispielsweise hinter dem Altar im kleinen Brigida-Kapellchen.
Schmeck (weiches e)
Der Ausdruck geht vermutlich auf das frühere Wort „Schmicke“ zurück, mit dem man eine biegsame Gerte oder Rute bezeichnete. Ich erinnere mich noch, dass ältere Leute zu meiner Kinderzeit eine Noßhecke-Jusch (Haselnuss-Gerte) als Schmick bezeichneten. Die Schmeck ist ganz simpel eine Peitsche, ein Gerät also, mit dem der Fuhrmann oder Kutscher seine Zugtiere lenkt und dirigiert. Die eigentliche Schmeck ist der Peitschstiel, bei uns früher Schmeckestomp (Peitschenstumpf) genannt, an dessen Spitze die Schmeckekoëd (Peitschenschnur) mit dem Klaatschköedche (dünne Schnur zum Erzeugen des Peitschenknalls) befestigt ist. Sehr verbreitet war bei uns die „Harzer Fuhrmannspeitsche,“ die einen geflochtenen Stiel mit einem Ledergriff aufwies. Auch Ohm Mattes besaß eine Harzer Schmeck, die bei der Arbeit mit unserem Kuhgespann unerlässlich war, mit der er aber nur selten empfindliche Schläge austeilte. Sie diente hauptsächlich zum Erteilen „optischer“ Befehle, die Tiere kannten und befolgten die Zeichen problemlos. Eine besondere Schmeck war beim Pflügen erforderlich: Die Ploochschmeck (Pflug-Peitsche) besaß einen entsprechend langen Stil in Gestalt einer einfachen Jusch (Gerte), damit der Pflüger über den Pflug hinweg die Tiere erreichen konnte. Schließlich kannten wir Kinder auch noch die Dilldoppschmeck, mit der wir unseren Dilldopp (Kreisel, einfaches Holzspielzeug) in Bewegung hielten. Diese Unterhaltung wurde Dilldopp schmecke genannt (siehe: Dilldopp).
Schmecklecker
Ein rundum erfreulicher Ausdruck, der keinerlei negative Aspekte zulässt. Der Schmecklecker nämlich ist eine Person, die sich mit leiblichen Genüssen jeglicher Art, besonders auch mit Süßigkeiten bestens auskennt und sich ihrer zu bedienen weiß, in der Umgangssprache also ein „Leckermaul“ oder verniedlichend ein „Leckermäulchen“ oder eine „Naschkatze.“ Im Standarddeutschen würde man den Schmecklecker als „Feinschmecker, Genießer, Genussmensch“ bezeichnen, der beim Studieren der Speisekarte äußerst wählerisch verfährt. Im übertragenen Sinne ist auch der „Gourmet“ ein Schmecklecker, der sich als sachkundiger Genießer erlesener Speisen erweist. Die Holländer kennen den Ausdruck „Lekkerbek,“ was soviel wie „Leckermaul“ bedeutet. Hier wird übrigens auch die Bedeutung von „bek“ ersichtlich, wenn wir beispielsweise sagen: Rieß dä Beck net esu op (Reiß den Mund nicht so auf). Als Schmecklecker bezeichnen wir auch ein wenig hintergründig den eleganten älteren Genießer, der sich erfolgreich in der Damenwelt zu bewegen versteht. In meiner Jugenderinnerung lebt noch ein Junggeselle gesetzteren Alters, der in den Tanzlokalen und Kirmessälen an der Oberahr bei den Tänzerinnen Hahn im Korb war, was die männlichen Jugend ziemlich ärgerlich kommentierte: Nu kick dir doch blos ens dä ahle Schmecklecker aan.
schnack
Noch heute sehe ich meinen unvergessenen Fahrlehrer Paul Pfeiffer neben mir am Steuer seines „Käfers“ sitzen und mich durch die Ortschaft Höfen dirigieren. Dabei erzählt er schmunzelnd, wie er hier einen Jungen nach dem Weg fragte und zur Antwort bekam: Wenn Sie willen, können Sie hier schnackaus fahren, Sie können aber auch da unten links erüm fahren. Paul „willte“ und fuhr also schnackaus. Unser schnack ließe sich folgendermaßen definieren: Wat net kromm os, dat os schnack (Was nicht krumm ist, das ist gerade), wobei schnack auch als Charaktereigenschaft gelten kann: „Wahrheitsliebend, geradeheraus, ohne Hintergedanken.“ Jemandem etwas schnack vüer dr Kopp oder auch schnack vüer de Schrööm sagen, bedeutet: Jemandem unverblümt die Meinung sagen. Käezeschnack ist unser Wort für „kerzengerade,“ ene schnacke Wäech ist ein gerader Weg und ene schnacke Käel ist ein aufrechter Mann (Kerl). Alte krumme Nägel wurden früher zwecks Wiederverwendung schnack jeklopp, und mit der Handsäge ene schnacke Schnodd (einen geraden Schnitt) herstellen, ist eine Kunst, die früher der Dorfschreiner beherrschen musste. En schnack Zahl maache bedeutet das Vermeiden von Pfennigsbeträgen beim Zahlungsvorgang, wobei allerdings schnack maache in aller Regel „nach oben aufrunden“ heißt.
Schnedd (weiches e)
In Blankenheimerdorf und in weiten Teilen der Eifel ist Schnedd das Wort für „Butterbrot,“ in den südlichen Ortschaften der Gemeinde Blankenheim sagt man Schnidd (siehe auch: Stöck). Generell ist die Schnedd eine Schnitte, eine dünne Scheibe von Nahrungsmitteln mannigfacher Art, – Fleisch, Wurst, Brot, Obst. Im Blankenheimerdorfer Dialekt wird das i in vielen Fällen zum o, Beispiele: Kiste – Koss, Wind – Wond, Spiel – Spoll. Bei der Schnedd wird diese Regel nicht angewandt. Es gibt bei uns zwar den Schnott (weiches o), doch ist das der „Schnitt,“ etwa der Sägeschnitt. Früher trugen die Leute ihre Verpflegung – Mittchen (Henkelmann), Schnedde und Möüt (Metallflasche, Feldflasche) in einem Leinenbeutel mit zur Arbeitsstelle, der somit zum Schneddesack erklärt wurde. Die Brote waren in Schneddepapier eingepackt, Pergamentpapier, das nicht aufweichte, aber bis zum Geht-nicht-mehr verwendet wurde und bald vom Fett des Brotbelags durchtränkt war (siehe auch: Hasebruët). Später kam die bequemere Schneddedos auf, ein Brotbehälter aus Metall oder Kunststoff, der das Vertrocknen der Brote zumindest hinauszögerte, wenn nicht ganz verhinderte. Die „Selbstversorgung auf der Arbeitsstelle gehört längst der Vergangenheit an und wurde durch Werksküchen und Imbissbuden ersetzt. Dabei hat die Eifeler Schnedd, mit Schinken oder Wurst belegt, mit Rübenkraut, Schmalz oder Klatschkäs (Quark) bestrichen, absolut noch nichts an Vorzüglichkeit eingebüßt.
Schnegger (weiches e)
Der Eifeler Schnegger ist der hochdeutsche „Schneider“ und der war früher eine unentbehrliche Institution in jedem Dorf oder auch als über Land ziehender Wanderschneider. Ein solcher war beispielsweise Hubert Kutsch aus Waldorf, allgemein dr Waldörfer Schnegger genannt, der alljährlich nach Nonnenbach kam (siehe: Nähdesch). Den Schnegger unserer Kinderzeit ersetzen heute supermoderne computergesteuerte Maschinen. Eren wenn et kejne Schnegger os (Herein wenn`s kein Schneider ist) wird fälschlicherweise oft als Ausdruck der Unbeliebtheit eines Schneiders ausgelegt. In der Schule lernten wir, dass in diesem Fall mit „Schneider“ der „Schnitter“ gemeint war, und das war auch ein Wort für den Tod, den selbstverständlich niemand gern zur Tür herein ließ. Interessanterweise war der Schnegger unserer Kinderzeit immer ein mickriges mageres Männlein, das mit gekreuzten Beinen auf dem Schneidertisch hockte. So auch im Märchen der Gebrüder Grimm, in dem aber das tapfere Schneiderlein schließlich dank seiner Klugheit zum König wird. Der Ziegenböck aus „Max und Moritz“ erinnert uns an die lustigen Zeichnungen von Wilhelm Busch, und nach der Film- und Bühnenfigur Schneider Wibbel, hervorragend dargestellt unter anderem durch Heinz Rühmann und Willi Millowitsch, ist eine Gasse in der Düsseldorfer Altstadt benannt.
schnuppich
Der Ausdruck ist eng verwandt mit dem hochdeutschen „verschnupft“ im Sinne von „wählerisch, kritisch.“ Schnuppich steht nicht im Zusammenhang mit dem Schnupfen, der nämlich heißt bei uns Schnopp. Das zu schnuppich passende Zeitwort ist schnuppe und bedeutet so viel wie „sich das Beste heraus suchen,“ im übertragenen Sinne also „naschen.“ Hier wird auch wieder einmal die Verwandtschaft unseres Eifeler Dialekts mit der holländischen Sprache deutlich: Snoepen (gesprochen: snupen) bedeutet „naschen.“ Wenn früher unsere Mutter vom Einkaufen zurück war, wurde sie von uns Kindern beinahe überfallen: Häste och jät ze schnuppe mot jebrääch (Hast du auch etwas zum Naschen mitgebracht). Soweit es beim schnuppe um Süßigkeiten ging, wurden oft auch die Ausdrücke schnütze oder schnöüse gebraucht. Wenn wir Pänz in unserem Teller herum stocherten, weil dessen Inhalt nicht nach unserem Geschmack war, hatte Jött wieder einmal Grund zum Meckern: Et wiëd jejeiße wat op dr Desch kött, bos net esu schnuppich (Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, sei nicht so wählerisch). Auch Tiere sind manchmal schnuppich, zum Beispiel verschmähte unsere Schwitt gelegentlich das „distelhaltige“ Heu einer bestimmten Wiese und Ohm Mattes wetterte: Dat schnuppich Loder friß doch dat Heu üß dr Jönzelbaach net. Im Krieg kannten die Leute keine Schnuppichkeit, weil es einfach keine Schnuppereien gab. Ich erinnere mich an einen seltsamen „Schokoladenersatz,“ der mehr nach Sand als nach Schoko schmeckte und trotzdem für uns eine kostbare Schnupperei bedeutete.
schnuuve
Unser Wort schnuuve ist mehr oder weniger als Sammelbegriff für mehrere „Tätigkeiten“ zu verstehen. Generell bedeutet schnuuve im Hochdeutschen „schnaufen,“ wir verwenden es jedoch auch anstelle von „schnauben“ oder „schnüffeln,“ nicht zuletzt sogar im Zusammenhang mit dem Tabakschnupfen und mit dem „Nasengeräusch“ beim echten Schnupfen. Eng verwandt mit unserem schnuuve ist das niederländische Wort „snuiven“ (gesprochen: sneuven). Als Kinder hatten wir gelegentlich einer Erkältung en Siefnaas (Tropfnase) und wurden ständig ermahnt: Schnuuv doch net dauernd esu jeckich, holl et Sackdooch (Schnaube nicht dauernd, nimm das Taschentuch). Keuchend eine steile Wegstrecke bewältigen nannten wir dr Berch erop schnuuve, und der oben Ankommende wurde dann ausgelacht: Du schnuuvs wie en aal Lok (Du keuchst wie eine alte Lokomotive). Mit schnuuve wurde unterdessen auch eine rasante Fortbewegung kommentiert: Dr Berch eraff, öm de Eck eröm, wie dr Bletz durch de Jäjend, öwwer dr Nürburgring schnuuve. Tabakschnupfen war mir als Kind immer eine unbegreifliche Tätigkeit. Hie Kobes, schnuuv ens bot man dem Nachbarn die geöffnete Schnüffjesdoos (Schnupftabakdose) an. War der Nachbar unbeliebt, unterblieb die Einladung selbstverständlich, der Dosenbesitzer nahm lediglich selbst eine Priese und der Nebenmann hatte das Nachsehen, er mußte dann kalt schnuuve (wie „kaltrauchen“).
Schochele
Heute noch gebräuchliches Wort für die menschlichen Gehwerkzeuge, meistens in etwas abfälligem oder geringschätzigen Sinn angewandt: Dohn ens deng Schochele jät op Sitt (Tu deine Beine mal etwas zur Seite, übertragen: Mach mal Platz). Vorwiegend bezeichnete man unterdessen die Füße als Schochele, beispielsweise streckte im Bahnabteil der rücksichtslose Fahrgast seine Schochele unter den Sitz seines Gegenüber, im nächsten Abteil legte ein ebenso dreister Reisender seng Dreckschochele op de Setzbank jähntüwwer (seine Schmutzfüße auf die Sitzbank gegenüber). Im dichten Gedränge auf dem Kirmesplatz trat man sich gegenseitig auf die Füße und wurde angeraunzt: Mensch du stehs mot denge Schochele op menge Ziëne (…auf meinen Zehen). In Blankenheimerdorf lebte vor Jahren ein Mann, der sich ungewöhnlich großer Füße erfreute. Über ihn wurde gelästert, er müsse an der Kirchentür drejmool zeröcksetze (dreimal zurücksetzen = rangieren), um ins Innere zu gelangen. Vom Substantiv abgeleitet ist das Zeitwort schochele, das ein schleppendes gemächliches Vorwärtsbewegen beschreibt. Im Krankenhaus beispielsweise: De Patiente schochele öwwer dr Jang, oder nach wiederholtem Klingeln kam endlich jemand aan de Huusdüer jeschochelt.
Schohbännel
Der „Schuhbändel“ zum Schnüren der Schuhe. Ein anderes Wort ist Schohreeme (Riemen). Der Schohbännel war zu unserer Kinderzeit ein ständiges Ärgernis, weil sich andauernd die Bundschlaufen lösten und die Bändelenden über den Boden schleiften. Dann kam gewöhnlich die elterliche Mahnung: Bon dir die Schoh, jlich lißte wier op dr Nas (Binde dir die Schuhe, gleich liegst du wieder auf der Nase). Gelöste Schohbännele waren tatsächlich die reinsten Stolperfallen. Um selbständiges Lösen zu vermeiden, versahen wir die Bindeschlaufen zusätzlich mit einem Sicherungsknoten. Der musste aber später eigens wieder gelöst werden und das war ziemlich umständlich. Schohbännele waren in der „Maggelzeit“ nach dem Krieg Mangelware und kosteten auf dem Schwarzmarkt eine Menge Groschen. Außerdem war das Material schlecht, nach einigem Gebrauch rissen die Senkel entzwei und wurden immer wieder aneinander geknotet. Dann aber passten die Knoten meistens nicht mehr durch die Ösen im Leder, das Binden wurde beschwerlich. Ich weiß noch, dass wir unsere Schuhe mit isoliertem dünnem Draht schnürten. Der aber brach nach wiederholtem Biegen und wurde unbrauchbar. Dann gab es fünf Millimeter dicke Lederstrippen als Schohbännel. Die waren zwar dauerhafter, aber auch sperrig und die unförmigen Bindeschlaufen missfielen der Geistlichkeit in Steinfeld, wenn wir externe Schüler am Hermann-Josef-Dienstag Messdiener spielen mussten (siehe: Reeme). Nun ja, gepflegte Klosterschuhe gab es bei uns daheim nicht. Das Wort „Schnürsenkel“ anstelle von Schohbännel war und ist mir auch heute noch „unsympathisch,“ ein Senkel nämlich ist ein Lot zum Ermitteln der Senkrechten.
Schohmächer
Unverkennbar ist hier der „Schuhmacher“ gemeint, der „Schuster,“ der im Eifeldorf eine sehr wichtige und unentbehrliche Person war. Den Dorfschuster gibt es heute nicht mehr, allenfalls existiert hier und da noch eine kleine private „Reparaturwerkstatt.“ Billiges Fabrikschuhwerk hat das solide Schusterhandwerk überrollt, handgefertigte Huh- oder Halevschohn (Hoch- oder Halbschuhe), wie sie beispielsweise Penn-Pittche (Peter Warler, der Dörfer Schuster, siehe Penn-Pittche) fabrizierte, sind in der Herstellung viel zu kostspielig, nur der Liebhaber kauft sie noch. Wir Schlemmershofer ließen unsere Schuhe beim Jöüser (Johann Geusen) in Blankenheimerdorf reparieren, zum Beispiel mit neuen Stößiese (Eisenplättchen an der Sohlenspitze) ausstatten. Später übernahm sein Sohn Peter Geusen das Geschäft des Vaters, Jöüsesch Pitter richtete seine Werkstatt im Haus seiner Schwiegereltern neben der alten Schule ein. Im Krieg war mancher Eifelbauer notgedrungen sein eigener Schohmächer, weil der Dorfschuster an der Front stand. Die abenteuerlichsten Fußbekleidungen wurden damals gebastelt, unter anderem säbelten sich die Leute Lappe (Schuhsohlen) aus alten Autoreifen heraus, mangels geeigneter Werkzeuge eine unheimlich mühselige Arbeit. Ein weiterer Dörfer Schohmächer war nach dem Krieg unser Nachbar Klobbe Köbes (Jakob Friederichs). Es faszinierte mich immer wieder, mit welcher Zielsicherheit Köbes aus dem Berg reparierter Schuhe stets das richtige Paar herauszufischen verstand.
Schohnääl
Im Krieg, als der Dorfschuster „eingezogen“ war, mussten die Leute sich ihr Schuhwerk selber reparieren. Dabei waren Schohnääl unentbehrlich, man fand sie in jedem Haus. Schuhnägel gab es in zweierlei Gestalt: Als kleine, etwa 15 Millimeter lange Nägelchen mit kantigem Querschnitt zum Befestigen der Sohle am Schuh, und als eine Art Spikes mit verdicktem Kopf. Das waren die eigentlichen Schohnääl, sie wurden in die Ledersohle eingeschlagen, verringerten deren Verschleiß und gaben dem Schuh eine stabile Rutschfestigkeit. Der gängige Eifeler Arbeitsschuh war damals auf diese Weise jenäält (genagelt), ebenso der „Knobelbecher“ des deutschen Landsers. Die eisernen Schohnääl unserer Kinderzeit sind heutzutage weitgehend durch Sekundenkleber und Profilsohlen ersetzt. Unsere Werktags-Kinderschuhe waren ebenfalls genagelt, und das war ein kratzendes Hindernis beim Iesbahnschlohn (Eisbahnschlagen) auf dem zugefrorenen Bach. Die genagelte Schuhsohle hinterließ markante Abdrücke im Boden, so konnte beispielsweise im Heimatfilm der Wilderer anhand des Abdrucks als „Neunnägel“ identifiziert und überführt werden. Aus einer Heim-Schusterwerkstatt stammt vermutlich eine runde Blechdose, die ich in den 1970er Jahren auf unserer Müllkippe am Weiherberg fand. Sie enthält, freilich arg verrostet und damit unbrauchbar, Schohnääl beider Formate und auch eine Anzahl Penncher (Holzstifte), die früher zum Besohlen der Schuhe verwendet wurden. Ein Heimschuster hat sie damals wohl „entsorgt,“ als der Krieg vorbei und der Wohlstand gekommen war. Und schließlich ist Aska mot Schohnääl ein nicht nur in der Eifel gebräuchliches Wort für „Hiebe, Prügel,“ dessen Herkunft ich nicht ermitteln konnte.
Scholtesse
Das Haus der Familie Karl-Heinz Schmitz in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auf dem Kippelberg, heißt seit Menschengedenken im Volksmund aan Scholtesse, was soviel wie „an Schultheißens“ bedeutet. Das geräumige Fachwerkhaus ist eins der ältesten, vermutlich sogar das älteste Gebäude von Blankenheimerdorf, der Name Scholtesse legt den Schluss nahe, dass hier der „Schultheiß“ wohnte, das Dorfoberhaupt. An Scholtesse gab es früher eine Gaststätte mit einem Tanzsaal. Unser verstorbener Pfarrer Ewald Dümmer, ein großer Heimatfreund, hat mir seinerzeit aus seiner Forschertätigkeit erzählt. Demnach war unser Kippelberg früher ein kleines Dorfzentrum und ein Rastplatz an der Ortsdurchfahrt, die damals über den Kippelberg führte. Das Haus Scholtesse war das Einkehrhaus für die Fuhrleute, unser Haus Muuße bot Schlaf- und Übernachtungsmöglichkeit, schräg gegenüber an Jasse gab es Unterstell- und Pflegemöglichkeit für die Zugtiere, die im Bedarfsfall auch gleich nebenan an Schmette frisch beschlagen werden konnten. Der Hausname besagt heute noch, dass es hier eine Schmiede gab. Die Mutter unseres verstorbenen Bürgermeisters Toni Wolff, Barbara Wolff geborene Hess, stammte aus dem Haus Scholtesse, ihr Bruder Paul Hess war noch Hausbesitzer, als wir 1949 nach Blankenheimerdorf kamen. Der in 1992 gegründete Dörfer Geschichts- und Kulturverein hat sich seinerzeit das Fachwerkhaus Scholtesse als Vereinslogo gewählt.
Schonk (weiches o)
Eine Eifeler Schonk war früher und ist noch heute eine echte Delikatesse: Der Räucherschinken. Wie so oft im Eifeler Dialekt, wird auch beim Schinken das Geschlecht umgewandelt: Die Schonk. Eine Kindheitserinnerung verursacht heute noch „Kinnwasser“: Hauchdünne Scheiben säbelt Mam mit dem breiten Brotmesser von der selbstgeräucherten Schonk ab, tiefrot und fest ist das Fleisch, rauchschwarz glänzt die Schwarte, Salzreste kleben noch dran. Eine Schnitte vom derben, selbstgebackenen Roggenbrot, dick mit goldgelber Butter aus der Hausproduktion bestrichen, Schonk drauf, reinbeißen… hmmh! Allgemein ist Schonk auch der Ausdruck für Oberschenkel und Hinterteil beim Menschen, eine „gutgebaute“ Frau beispielsweise wird taxiert: Dat hät e paar jehüerije Schonke. Beliebt war früher das Schonkekloppe (Schinkenklopfen), ein Ratespiel, bei dem es Schläge aufs Hinterteil gab und der „Täter“ erraten werden musste. Eine Art Schinkenklopfen war auch De Schöpp jenn (wörtlich: Die Schaufel geben), sozusagen die „Aufnahmeprüfung,“ eine Prozedur, die der Neuling auf der Arbeitsstelle über sich ergehen lassen musste. Dabei wurde eine normale Schaufel über das – bekleidete – Hinterteil gestülpt und kräftig mit dem Hammer drauf geschlagen. Das „zog“ und „brannte“ ganz widerwärtig, ich selber habe es im Oktober 1953 auf der Güterabfertigung Kall erfahren müssen.
Schöpp (weiches ö)
Die Schöpp ist schlicht und einfach eine Schaufel, also ein Arbeitsgerät. Schöpp kann auch ein Paddel oder Ruderblatt sein, ein breites Geweihende oder ein Teil von Baumaschinen. Und ein Schöppche war und ist ein klassisches Kinderspielzeug. Je nach Arbeitseinsatz gibt es die unterschiedlichsten Formen, im Haushalt kennen wir beispielsweise die Dreckschöpp (Kehrblech), die Kolleschöpp (Kohlenschaufel), die Füërschöpp (Feuerschaufel = zum Beschicken des Ofens mit Glut) oder auch die Koocheschöpp (Kuchenschaufel). Lange Fingernägel wurden zu unserer Kinderzeit als Schöppe bezeichnet, man lästerte unter anderem: Mot denge lange Schöppe könnste jlatt dr Jaade ömjrave (…könntest du glatt den Garten umgraben). Schöppe wurde und wird auch heute noch die Farbe Pik im Kartenspiel genannt, auch in den Niederlanden, wo zum Beispiel die Pickdame die „schoppenvrouw“ ist. Schöpp ist nicht zuletzt unser Ausdruck für den „Schmollmund.“ De Schöpp jenn (wörtlich: Die Schaufel geben) war eine Gepflogenheit bei der „Einweihung“ des Arbeitsneulings, die ich selber in 1954 auf der Güterabfertigung Kall über mich ergehen lassen musste: Ein normales Schaufelblatt wird auf das – bekleidete – Hinterteil des „Täuflings“ gedrückt und ein paar Mal kräftig mit dem Hammer drauf geschlagen. Das „zieht“ geradezu teuflisch, ist ansonsten aber harmlos. Über die Schöpp gibt es diverse Redewendungen. Wenn früher jemand zur Beichte ging, hieß es dä jeht de Schöpp affkratze (die Schaufel abkratzen), de Schöpp motbrenge (die Schaufel mitbringen) bedeutete „hier bleiben bis zum Tod, nicht mehr fortgehen). Und für de Wohrhejt ze bejrave, bruch mr vill Schöppe (zum Begräbnis der Wahrheit sind viele Schaufeln erforderlich) ließe sich mit dem bekannten Wort „Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch an das Licht der Sonne“ übersetzen.
Schottelspann (weiches o)
Die Schottel ist eine flache Schüssel, im Gegensatz zum Komp, bei dem es sich um ein größeres tiefes Behältnis (allgemein: Pott) handelt. Die Pann ist ganz schlicht eine Pfanne, die zur Diskussion stehende Schottelspann ist somit, wörtlich übersetzt, eine „Schüsselpfanne,“ und das war unser Wort für die früher allgemein gebräuchlichen Eifeler Dachpfannen, kurz auch einfach Schottele genannt. Die Schottelspann war muldenförmig und besaß anstelle eines Falzes nur eine halbrunde Überlappung, die niemals dicht schloss. Als zusätzliche Dichtung wurde ein passendes Strohbündelchen unter die Überlappung gesteckt (siehe: Poppe). Diese „Puppen“ wurden in mühsamer Handarbeit hergestellt, allein für ein einziges Dach waren viele hundert Poppe erforderlich: Glattes Stroh wurde auf doppelte Schottelslänge abgelängt, ein etwa daumenstarkes Päckchen davon entnommen, mittig umgeknickt und im oberen Teil mit ein paar Halmen zusammengeschnürt. Das Ganze hatte entfernt Ähnlichkeit mit einer kleinen gliederlosen Puppe. Trotz der Strohdichtungen war das Schottelsdaach (Dach) niemals richtig dicht, mit der Zeit verrottete auch das Stroh. In den wenigsten Fällen gab es eine isolierende Teerpappenschicht, die Schottelspanne lagen auf den blanken Dachlatten, der Wintersturm fegte den Schnee durch die Ritzen. Bei unserem Haus „Muuße“ in Blankenheimerdorf waren nach dem Krieg die Bodenbretter auf dem Speicher durch den Schnee morsch geworden, der Schornsteinfeger verweigerte bei uns den Dienst, weil ein Fehltritt neben den Trägerbalken gefährlich werden konnte. Wir mussten ihm von der Treppe bis zum Kamin einen provisorischen Brettersteg anlegen. Nach dem Krieg entstanden in unserer Eifel zahlreiche Dachziegelfabriken, die nach der Aufbauzeit fast alle wieder geschlossen wurden. Schottelspanne wurden aus Ton oder Zement hergestellt, die Zementpfannen waren enorm bruchsicher. So ging beispielsweise beim großen Hagel am 22. Juli 1950 auf unserem Hausdach keine einzige Schottel zu Bruch, während im Dorf tausende Tonpfannen in Trümmer gingen.
nach oben
schrappe
Das Wort ist identisch mit dem hochdeutschen „schrappen,“ das seltsamerweise auch „schrapen“ geschrieben werden kann, wie der Duden sagt. Schrappe bedeutet generell „schaben, abkratzen,“ es wird im Dialekt aber auch als Ausdruck für Kniestichkejt (Geiz) gebraucht. Von einem Kniesböggel (Geizhals) sagt man beispielsweise: Dä schrapp sech noch kapott (Der knausert sich noch zu Tode) und e schrappich Loder ist eine geizige Person, sowohl Frau als auch Mann. Allgemein bekannt ist die Bezeichnung Schrapnell (Schrappnell) für einen Querschläger oder Granatsplitter, was unterdessen nicht ganz zutreffend ist: Ein Schrapnell ist eine spezielle, mit Kugeln oder Eisenstücken gefüllte Granate. Als Schrapnell bezeichnen wir auch etwas böswillig ein in der Dorfgemeinschaft unbeliebtes, zänkisches und meist auch vom Äußeren her unansehnliches Weib. Schrappe bedeutet auch „scharren, rubbeln oder hobeln,“ und wenn der Eifeler sagt Ech moß mir et Jesiëch noch schrappe, dann will er damit sagen, dass er sich noch rasieren muss. Wenn das Garagentor „Zu schmal“ ist und das nagelneue Auto fies am Pfosten entlang schrappt, bleiben eklige „Spuren“ im Lack zurück. Und wenn bei uns daheim Schlacht- und Wurstfest war, saß unsere Jött in der Küche, das Schrappbrett auf den Knien, und reinigte stundenlang mit dem Messerrücken die linksgedrehten Därme des Schlachttiers fürs Wursten: Därm schrappe war ihre ureigenste Aufgabe, die ihr im Übrigen auch von den Hausgenossen liebend gerne überlassen wurde.
Schroom (hartes o)
Das Wort ist verwandt mit dem hochdeutschen „Schramme“ und bezeichnete ursprünglich einen Riss, Kratzer oder eine leichte Hautwunde. Davon abgeleitet ist Schroom generell zum Begriff für „Strich, Linie“ geworden. Ein geradezu klassischer Schroom ist der Strich, der den Verzehr des Kneipenbesuchers auf dem Bierdeckel anzeigt. Einmal malte der Wirt versehentlich zwei statt eines einzigen Strichs auf den Deckel. Vom Gast darauf angesprochen, meinte er treuherzig: Och dat hät nix ze sare, dat os nur ene Kontrollschroom. Unsere Jött beaufsichtigte seinerzeit intensiv meine Hausaufgaben, zur Übung diktierte sie mir einige Zahlen und befahl: Jetz määßte ene Schroom drönner on zälls zesame (Strich drunter und zusammenzählen). Beim Glasschneiden in Vaters Werkstatt hatte ich manchmal Probleme und Vater wetterte: Du solls net zweimool üwwer drselbe Schroom fahre, - jetz os ad wier e Rädche am Aasch. Tatsächlich ist nach einem zweiten Schnitt über eine bereits „angeschnittene“ Linie das Stahlrädchen im Glasschneider verdorben. Beim Diamantschneider kann sogar der Spezialstein ausbrechen, und dann sind etliche Euros im Eimer. Op (oder aan) seng Schrööm komme bedeutet „ein Geschäft vorteilhaft zu Ende bringen,“ und wenn einem etwas „über die Hutschnur“ geht, so beschwert er sich: Dat jeht mir äwwer üwwer de Schrööm. Ein beliebtes Kartenspiel ist Sebbe (oder siwwe) Schrööm, verschiedentlich auch „Eifelpoker“ genannt, was „sieben Striche“ bedeutet und bei dem die Minuspunkte in Schrööm abgezogen werden.
schuddere
Enä wat os dat höck e schudderich Wedder (…ein schauderhaftes Wetter) kommentieren wir auch heute noch eine Regen- und Kälteperiode. Schuddere bedeutet „schaudern“ und schudderich heißt somit „schauderhaft.“ Ein ähnliches Wort ist schuggerich, das aber in erster Linie bei „trockener Kälte“ zur Anwendung kommt: Hu et os esu schuggerich, ech könnt en dr Oëve kruche, – man möchte also vor Kälte in den Ofen kriechen. Nur klangverwandt ist auch der Ausdruck schludderich, der aber mit „unordentlich, nachlässig“ zu übersetzen ist. Unser schuddere ist sogar für die Engländer ein Begriff, die nämlich sagen „shudder“ (gesprochen: schadder). Die Erinnerung an ein schlimmes Ereignis ruft bei den meisten Menschen ein unangenehmes Frösteln hervor: Et schuddert mech noch, wenn ech dodraan denke (Der Gedanke daran lässt mich schaudern). Schuddere ist in der Regel ein Wort mit negativem Hintergrund: Vor Kälte, Frost, Fieber, Ekel oder Aufregung frösteln fassen wir in dem einzigen Ausdruck schuddere zusammen. Bie denge Schudderjeschichte stohn ejnem jo de Hoor ze Berch dämpft der Zuhörer die allzu drastische Schilderung etwa einer Geistergeschichte. Ein Schudderhohn ist ein Zeitgenosse, dem man nicht jedes Wort unbesehen „abkaufen“ sollte, oft wird auch ein unbeliebter Mitmensch als Schudderhohn bezeichnet. Das Wort ist aus dem ursprünglichen Schudderhoot (Schauderhut) entstanden. So nannte man früher einen Menschen in abgerissener und damit „Schauder erregender“ Kleidung.
Schuër
Do kött en Schuër Rään (Da kommt ein Regenschauer), stellte Bahne Mattes beim Heueinfahren fest und deutete besorgt auf die heranziehenden Wolken. Der Schauer ist in der Mundart weiblichen Geschlechts: Die Schuër. Das Wort gilt selbstredend auch für Schnee- oder Hagelschauer, nicht aber für den Schauer, der uns im Zusammenhang mit Angstgefühl oder Schrecken über den Rücken läuft (Gänsehaut). Hier spricht der Volksmund von Schudder. Die Schuër ist in jedem Fall eine kurzzeitige und vorübergehende Erscheinung oder Situation. Hierfür kennt der Eifeler Dialekt ganz spezielle Anwendungen. Wenn beispielsweise Schängche in geselliger Runde plötzlich reihenweise Witze vom Stapel lässt, freuen sich die Zuhörer: Jetz hätte wier seng Schuër (wörtlich: Jetzt hat er wieder seinen Schauer). Oder wenn der Haussegen wieder einmal etwas in Schieflage geraten war, hieß es hinter der Hand: Meng Alte hät ens wier ihr Schuër. Als Zeitwort war schuëre, neben dem Ausdruck puëse (pausieren), auch ein Begriff für eine kurze Rast oder Unterbrechung. Bei der Getreideernte beispielsweise ordnete Ohm Mattes nach zwei Stunden Koor afmaache (wörtlich = Korn abmachen) eine Arbeitspause an: Losse mir ens en Viedelstond schuëre. Und auch die Waldarbeiter legten bei ihrer Schwerarbeit ab und zu e Schüerche ein. (siehe: schuëre).
schuëre
Dieses Tätigkeitswort bedeutet „schauern“ und ist von Schuër hergeleitet. Mit et schuërt wird der plötzliche Niedergang etwa des Regenschauers bezeichnet, schuëre bedeutet aber auch das Schutzsuchen vor eben diesem Regenfall. Wir Kinder krochen beispielsweise unter den beladenen Heuwagen, wenn uns unvermutet ein Heudresser (Regenguss) überraschte, und der Wanderer schuërte unter dem dichten Laub- oder Nadeldach von Bööch (Buche) oder Dänn (Fichte, Tanne), bis der Regen nachließ. Ganz allgemein wurde auch das Einlegen einer kurzen Arbeitspause als schuëre bezeichnet, überwiegend sprach man allerdings bei solcher Gelegenheit von ens aanmaache (Raucher-, Zigarettenpause). Eine weitere Bedeutung von schuëre ist „scheuern.“ So war unter anderem dr Herd schuëre (die Herdplatte scheuern) mit Schmirjel und Herdwieß im Bauernhaus eine unvermeidliche Alltagsbeschäftigung, die glänzende Herdplatte war der Stolz der Hausfrau. Herdschuëre war besonders mühsam und schweißtreibend, wenn etwa de Melech üwwerjekauch (die Milch übergekocht) und auf der Platte festgebrannt war. Eine derbe, aber nicht wörtlich zu nehmende Eifeler Weisheit besagte früher: Dreck schuert dr Mare on reinicht dr Därm (Dreck scheuert den Magen und reinigt den Darm).
Schüerendreischer
Nicht nur bei uns in der Eifel ist die Redewendung Dä friß wie ene Schüerendreischer üblich, wenn beim Essen jemand tüchtig zulangt. Der Schüerendreischer ist ein Scheunendrescher, ein Mann also, der schwere körperliche Arbeit verrichtet und der entsprechende Nahrungsmengen zu sich nehmen muss. Allerdings gibt es diese Drescher nicht mehr, sie wurden längst durch die Dreschmaschine und schließlich den Mährdrescher abgelöst. Als diese Maschinen noch unbekannt waren, wurde jegliches Getreide von Hand mit dem Fläjel (Flegel) gedroschen. Das geschah auf dem festgestampften Lehmboden der Scheunentenne, daher der Name Schürendreischer. Das Flegeldreschen war in der Regel eine Winterarbeit, die den Eifelbauern „auf Trab“ hielt. Begüterte Bauern, die ene Stall Veeh (einen Stall voller Vieh) besaßen und bei denen naturgemäß auch große Mengen Getreide anfielen, leisteten sich eine Dreschmannschaft. Die setzte sich aus mehreren Männern zusammen, die mit ihren Handflegeln reihum über die Dörfer zogen und meistens einen festen Kundenstamm zu bedienen hatten. Sie arbeiteten für ein paar Pfennige, wichtig für sie war unterdessen die kostenlose Unterkunft und Verpflegung am Arbeitsplatz, die man auf diese Weise daheim einsparte. Die Schüerendreischer waren allenthalben als billige Arbeitskräfte gern gesehen. Zu ihrem Arbeitsablauf gehörte auch die Runde Fläjelwasser („Flegelwasser“) zum „Schmieren“ der Arm- und Handgelenke. Der kluge Arbeitgeber sparte nicht mit dieser „Arznei,“ denn sie hielt die Drescher bei Laune.
schürje
Hier handelt es sich um ein Dialektwort, für das es eigentlich keine hochdeutsche Übersetzung gibt, am zutreffendsten mag „schieben“ sein, denn unter schürje verstehen wir generell die mühsame oder schwerfällige Fortbewegung einer Last. Das Musterbeispiel hierfür ist der Transport mittels einer Schub- oder Schiebkarre, die man vor sich her schiebt und die daher bei uns auch vielfach Schürechkaar genannt wird. Ein weiteres Idealbeispiel ist Schnie schürje (Schnee räumen) mit dem Schneebrett, das bei uns Schnieschürjer heißt. Schneeräumkolonnen wurden früher scherzhaft als „staatlich geprüfte Schnieschürjer“ bezeichnet. Im erweiterten Sinne steht schürje auch für „fahren“ in allen denkbaren Anwendungen, mom Zoch noo Kölle schürje (Zugfahrt nach Köln) beispielsweise, ens schnell mom Rad noo Blangem schürje (eilige Radfahrt nach Blankenheim), oder auch, etwas makaber ein Begräbnis umschreibend, jemanden op de Komm schürje (weiches o, Komm ist unser Wort für den Friedhof). Wir kennen auch op Hejm aan schürje als Nachhauseweg eines nicht mehr so ganz standfesten Kneipenbesuchers. Bei der Kartoffelernte wurden daheim de Jrompere vam Feld jeschürch (Abtransport vom Feld), und nach einer längeren Trockenperiode mußte ich mit unserer Jött im Hochsommer et Holz erenn schürje (das Brennholz in den Schuppen karren).
Schurp
Die Schurp war eine senkrechte schmale Öffnung in der hinteren Wand gegenüber dem Scheunentor. Die Eifeler Tenne war derart eng bemessen, dass gerade mal ein beladener Heu- oder Getreidewagen hinein passte. Die Gespanntiere zogen den Wagen bis auf die Tenne und wurden dann ausgespannt und zurück geführt, wobei sie sich geradezu zwischen Wagenladung und Tennenwand hindurch „quetschen“ mussten. Dann wurde der Wagen von Hand ganz auf die Tenne geschoben, der Dießel (die Deichsel) wurde dabei durch die Schurp nach draußen geführt, damit der Wagen möglichst weit auf die Tenne kam und die gesamte Ladung unter Dach war. Zum leichteren „Einfädeln“ der Deichsel erweiterte sich die Schurp entsprechend der Mauerstärke nach innen wie eine Schießscharte. Das wurde in den 1950er Jahren einem von uns drei Tunichtguten beinahe zum Verhängnis. Unversehens mussten wir in der Abenddämmerung vor einem wütenden Bauersmann durch eine Schurp flüchten, weil es keinen anderen Ausweg mehr gab. Zwei von uns schafften „hochkant“ den schmalen Ausgang, der Dritte blieb mit dem Bauch in der Schurp stecken, hüben wie drüben ragte ein halber Tunichtgut aus der Wand, und während drüben das zappelnde Hinterteil mit einem Knüppel bearbeitet wurde, rissen wir hüben den Ärmsten gewaltsam durch den Engpass in die Freiheit. Den drei oder vier frischen Eierchen, die sich „zufällig“ in den Hosentaschen befanden, bekam die Prozedur unterdessen nicht besonders gut.
schurvele
Das Wort ist zum Teil mit schürje verwandt. Während schürje die Fortbewegung eines Gegenstandes beschreibt, bezieht sich schurvele auf das dabei entstehende Geräusch. Wenn wir beispielsweise eine Kiste über den Fußboden schieben, wird dabei ein unangenehmes Schlurfen oder Kratzen hörbar: Schurvele. Vielen von uns klingt die ständige Elternmahnung aus der Kinderzeit noch im Ohr: Heff de Fööß op, schurvel net dauernd über dr Boddem (Heb die Füße auf, schlurfe nicht dauernd über den Boden). Schurvele beschreibt in aller Regel einen negativen Vorgang, da meistens Schäden damit verbunden sind. Wird beispielsweise der Küchenschrank unvorsichtig von der Wand gerückt und über den Boden jeschurvelt, bleiben sehr leicht hässliche Schleif- und Kratzspuren im PVC-Belag zurück, und durch ständiges schurvele verschleißen auch die Sohlen der bereits erwähnten Kinderschuhe unangenehm rasch. Der über den Boden schabende Schneeschieber (siehe: schürje) verursacht ein ziemlich unangenehmes Schurvele, das je nach Bodenbeschaffenheit auch oft zum misstönenden Schrappe wird. Klassisches Schurvele macht sich auch bemerkbar, wenn ein bewegliches Teil, beispielsweise die Haustür, sich gesenkt hat und aus dem Lot geraten ist. Dann schleift die Außenkante über den Boden, und wenn da nicht umgehend der Schreiner für Abhilfe sorgt, zeigen sich sehr bals im Bodenbelag dauerhafte halbreisförmige Schurvelspuren.
Schuum
Der Schaum ist generell ein ziemlich unbeliebter Stoff, weil er aus lauter Luftbläschen besteht und sich in Nichts auflöst. Beim Bier allerdings ist die Schaumkrone unerlässlich, „schäumendes Gerstengetränke reicht der Wirt mir im Krug“ heißt es im Volkslied, das seinerzeit sogar Bundespräsident Walter Scheel gesungen hat. Ein Helles ohne Schuum wirkt und schmeckt schal und abgestanden und wird vom Kenner verschmäht. Beim Bier optisch vorteilhaft, sehen wir bei anderen Gelegenheiten den Schaum gar nicht so gerne, beispielsweise den unappetitlichen grau-weißen Konsdöngerschuum (Kunstdüngerschaum) beim Kartoffelkochen. Und wer hätte sich nicht schon einmal über den Melechschuum (Milchschaum) geärgert, der über den Topfrand auf die heiße Kochplatte quillt, hartnäckige Flecken hinterlässt und das halbe Haus mit markantem Geruch verseucht. Die negative Schaumseite kommt auch durch den Schuumschläjer (Schaumschläger) zum Ausdruck, der leere und prahlerische Reden hält. Der Schüümleffel (Schaumlöffel) ist auch in der modernen Küche noch unentbehrlich, früher hing er neben Bratenwender, Kelle und Fleischgabel am weiß emaillierten Löffelblech an der Herdwand im Eifelhaus. Das Zeitwort zu Schuum ist schüüme (schäumen). Wenn früher jemand gierig und hastig sein Essen verschlang, hieß es verächtlich: Dä friß, dat em de Muul schüümp (…dass ihm der Mund schäumt).
Schwaad
Die Schwarte ist die Haut oder auch das Fell bestimmter Tiere, im übertragenen, meist negativen Sinne wird auch die Menschenhaut als Schwaad bezeichnet. Wenn beispielsweise einer Prügel bezogen hat, so heißt es: Dä hät se äwwer joot öm de Schwaad krijje, und ein Mensch mit Sonnenbrand hat sech de Schwaad verbrannt. Den Bauch (bei fettleibigen Menschen) einziehen heißt de Schwaad eren dohn, und jemandem Prügel androhen umschreiben wir mit pass op, net dat ech dir aan de Schwaad komme. Analog dazu bedeutet schwaade „verprügeln,“ daneben allerdings seltsamerweise auch „dauernd reden:“ De Muul schwaade heißt soviel wie „unaufhörlich reden, tratschen.“ Die wohl bekannteste und beliebteste Schwaad ist die Haut des Schlachtschweins, und hier insbesondere die Speckschwaad. Bei der Hausschlachtung wurde die Schwarte des Schweins mit einer Strohfackel affjesengk (abgesengt), um die Borsten zu entfernen. An unzugänglichen Stellen, etwa in den Ohrwinkeln, blieben trotzdem meistens ein paar Haare stehen, – das war belanglos, die wurden beim späteren Verzehr einfach ausgezupft. Gekochte Speckschwaad, im Fleischwolf grob zerkleinert, ergibt als Zusatz der Erbsensuppe eine besondere Geschmacksnote. Und hauchdünne Scheiben, frisch vom hausgeräucherten Hinterschinken gesäbelt, tiefrot und mit Salzkristallen auf der dunklen Schwarte, sind an Wohlgeschmack kaum zu übertreffen.
Schwadem
Der Dunstabzug über dem modernen Küchenherd unserer Tage verhindert die Belästigung durch den beim Kochen unvermeidlich entstehenden Schwadem (Wasserdampf). Im Huus (Haus, im Eifeler Dialekt auch Küche) unserer Eltern waren die Wände meistens gekalkt, über dem Kohleherd nahm die Farbe durch den Schwadem mit der Zeit eine dunkle Tönung an, der Schwalek (Rauch, Qualm), der beim Nachlegen dem Feuerloch entströmte, tat ein Übriges, schwärzliche Rußspuren waren die Folge, im Huus mußte jährlich neu angestrichen werden. Wenn die Wände tapeziert waren, lösten sich durch den Schwadem die einzelnen Bahnen von der Wand ab, der Tapetenkleister von damals war nicht der Beste. Dat os äwwer ene Schwadem, mr sitt de Hand vüer Oure net beschreibt den dichten Nebel, bei dem man nicht die Hand vor den Augen sieht. Kaum ein Koch, der sich nicht wiederholt am heißen Schwadem Hand oder Arm verbrüht hätte, etwa beim Jrompere affschödde (Kartoffeln abschütten), wenn das Wasser noch kocht. In manchen nicht gelüfteten Küchen wird der Eintretende unverhofft von einem Schwadem „überfallen,“ der ihm geradezu den Atem nimmt. Das ist dann ein Gemisch aus Wasserdampf und Speisedüften. Manche Frittenbude verströmt einen beinahe penetranten Brat- und Fettschwadem, der sich in die Kleidung des Kunden einnistet und tagelang andauert. Ein ekelhafter Schwadem herrscht nicht selten in öffentlichen Toiletten, die nicht ordentlich gepflegt werden.
Schwalebere
Bis um etwa 2010 war es bei uns noch ein gewohntes Bild: In der warmen Septembersonne sammelten sich Hunderte von Schwalben auf den Drähten der Stromversorgung und rüsteten zum Abflug in den Süden. De Schwalebere sammele sech, et jeht op Kirmes aan, stellten die Dorfbewohner fest. Zwar flüchten die Schwalebere keineswegs vor der Dörfer Martinskirmes, wohl aber vor der oft winterlichen Witterung, die das Dorffest mit sich bringt. Seit dem genannten Zeitpunkt lässt sich in unserem Ortsteil Kippelberg keine Schwalbe mehr sehen, das Dorf wurde „verkabelt,“ die Stromleitungen sind verschwunden, die Schwalebere haben keine Versammlungsplätze mehr. Außerdem wird ihr Nistmaterial knapp, weil es kaum noch Schlammpfützen und Wasserlöcher gibt. Erfreulich dagegen: Am Eingang eines Supermarktes im Blankenheimer Gewerbegebiet sah ich im Sommer ein Mehlschwalbennest, sogar mit Nachwuchs darin. In unserem winzigen Kuhstall daheim, gab es zu meiner Kinderzeit alljährlich zwei Rauchschwalbennester am Balkenträger unter der niedrigen Decke. Die waren zwar im Frühjahr meistens beschädigt oder ganz verschwunden, wurden aber immer wieder neu gebaut. De Schwalebere han Jonge (Die Schwalben haben Nachwuchs) verkündete ich dann stolz, sobald es im Nest lebendig wurde. Die Stalldecke war so niedrig, dass man die Nester beinahe mit der Hand erreichen konnte. Das störte aber die Tiere absolut nicht, sie flogen uns geradezu öm de Köpp eröm (um die Köpfe herum). Die obere Hälfte der Stalltür blieb durchgehend offen, damit die Schwalebere beliebig ein- und ausfliegen konnten.
nach oben
schwazz
Die schwarze Farbe und alles, was damit in Verbindung gebracht werden kann, ist in vielen Fällen mit einem negativen „Beigeschmack“ behaftet. Schwarz steht für Trauer, Tod, Finsternis und verbotenes Tun. So wurde beispielsweise bei uns daheim im Krieg e schwazz Ferkel gemästet. Das Tier war keineswegs schwarz, es wurde aber schwazz (hier: Im Geheimen, nicht gemeldet) gehalten. Schwarzhören von Radio London konnte im Krieg mit dem Tod bestraft werden. Der Schwarzmarkt florierte in den Nachkriegs-Hungerjahren, und sogar heute noch ist Schwarzarbeit an der Tagesordnung. Die Küchendecke bei uns daheim war kollschwazz (kohlschwarz) vom Backofenruß und wurde nie gestrichen. Die schwazz Katz gilt bei abergläubischen Zeitgenossen als Unglücksbote. Im Eifeler Kleiderschrank hing früher der schwazze Aanzoch (schwarzer Anzug), der ausschließlich bei besonderen Anlässen – Beerdigung, Hochzeit, Jubiläum – zur Geltung kam. Der Schwazze Mann war und ist der Schornsteinfeger als Glücksbringer. Wer Schwazz drejt (Schwarz trägt), bringt seine Trauer zum Ausdruck. Schwazz Jewöleks (Gewölk) kündigt meistens ein Gewitter an, und wer in Ohnmacht fällt, dem wird es schwazz vüer Oore (schwarz vor den Augen). Wer den Chef geärgert hat, kommt postwendend auf die schwazz Less (schwarze Liste), und wer einmal darin vermerkt steht, der ist bei der Obrigkeit schwazz aanjeschrevve (schwarz angeschrieben). Schwazze Pitter (Schwarzer Peter) spielten wir schon als Kinder mit unserem abgegriffenen Kartenspiel, dessen „Bilder“ kaum noch erkennbar waren. Mancheiner ärjert sech schwazz, ein Anderer wird schwazz on blau jehaue und trägt tagelang e blau Ouch (ein blaues Auge, „Veilchen“) zur Schau.
schwazz Sejf
Wörtlich: „Schwarze Seife,“ unser Wort für die Schmierseife, die wegen ihrer Umweltfreundlichkeit auch „Grüne Seife“ genannt wird. Im und nach dem Krieg war schwazz Sejf bei uns das Reinigungsmittel schlechthin. Es gab ja auch wenig mehr zu kaufen, und für richtige wohlriechende Seife hatten die Leute ohnehin kein Geld. Schmierseife gibt es auch heute noch im Handel, in moderner und verbesserter Form. Damals war es eine braun-schwarze, etwas „streng“ riechende halbfeste Substanz, die bei uns daheim im Stejndöppe (Keramiktopf) aufbewahrt wurde. Schwazz Sejf war ein Allerweltsmittel, sie kam am Waschtag zum Einsatz, wenn die stark verschmutzte Arbeitskleidung zu reinigen war, sie diente zum Abwaschen von Wänden, Möbeln oder Steinfliesen, sie reinigte unsere arg verdreckten Kinderhände und ersetzte notfalls sogar die stinkende schwarze „Zugsalbe“ bei Furunkeln und Geschwüren. Dieses Hausmittel wurde damals auch bei mir erfolgreich angewendet. Ich erinnere mich noch, dass damals zweimal im Jahr der Vertreter einer Chemiefirma über die Dörfer zog und neben „Staufferfett,“ Schmieröl und Schuhtran, auch schwazz Sejf verkaufte. Kurz nach dem Krieg gab es bekanntlich rein gar nix, es sei denn auf dem Schwarzmarkt. Auch unsere schwazz Sejf ging zur Neige. Ein Kölner Schrotthändler, dem ich die Absturzstelle eines Flugzeugs zeigte, schenkte mir zwei Stangen „Kernseife,“ ein nach Fisch riechendes Zeug, das uns heute „zum Wegwerfen zu schlecht“ wäre. Mam (Mutter) dagegen sprang beim Anblick der Kernsejf vor Freude fast an die Küchendecke.
Schwitt
Schwitt ist ein relativ seltener deutscher Familienname, wie ein Blick ins Telefonbuch zeigt. Der Eifeler kennt das Wort als Begriff für eine kleine Menge gleichartiger Objekte, en Schwitt Köh beispielsweise bezeichnet eine kleine Viehherde, en Schwitt Schollpänz ist ein Trupp Schulkinder. Manchmal ist auch eine Gesellschaft oder Verein gemeint: Mot der janzer Schwitt well ech nix mieh ze dohn han heißt, dass man sich von diesen Leuten distanziert. Bei uns daheim war Schwitt der Name einer unserer vier Kühe. Beim Kleinbauern besaß jedes Stalltier einen Namen, auf den es hörte. Wenn man beispielsweise beim Viehhüten Schwitt, hott eröm rief, so marschierte Schwitt nach rechts, während die anderen Tiere den Befehl ignorierten. Schwitt war unsere älteste Kuh, hatte etliche Kälber zur Welt gebracht und war im Dienst am Menschen alt und knochig geworden. Es war Sonntag, der 17. September 1944, als die Wehrmacht eine Kuh aus unserem Stall requirierte und wir schweren Herzens die Schwitt abgaben. Die kleine Herde „Heeresvieh“ wurde ins Ahrtal getrieben, wo es eine Sammelstelle gab. Am frühen Abend überraschte uns urplötzlich trompetenhaftes Kuhgebrüll. Am Fuß der Hardt erschien unsere Schwitt, trompetete wie zur Begrüßung zu uns herauf und trottete durch die noch offene Stalltür auf ihren verwaisten Platz. Sie war, so erfuhren wir später, kurz vor Oberahreck der Treibermannschaft ausgerissen, in den nahen Wald geflüchtet und durchs Nonnenbachtal herauf heim gekommen.
nach oben
schwonk (weiches o)
Ein typisches „Dörfer“ Dialektwort mit der Bedeutung „zu schwach“ oder „der Belastung nicht gewachsen.“ Gelegentlich brach beim Heueinfahren durch zu starkes Spannen der Wessboum (Wiesbaum) und die Bäuerin wetterte erbost: Dä, jetz stohn mir do! Ech han jo emmer jesoot, dat vimpschisch Böümche oß vell ze schwonk (So, jetzt stehen wir da! Ich habe ja immer gesagt, das kümmerliche Bäumchen ist viel zu schwach). Schwonk wurde hier und da auch in der Bedeutung von „biegsam, elastisch“ gebraucht. Der Bauer schnitt beispielsweise in der Noßheck (Haselstrauch) en schwonk Jusch (eine biegsame Gerte) als Stiel für die lange Ploochschmeck (Pflugpeitsche zum Dirigieren des Gespanns über den Pflug hinweg). Überwiegend bezeichnete man eine solche Gerte allerdings als schmuck Jusch. Ganz besonders bedeutsam war schwonk im Zusammenhang mit dem Kisshamer (Kieshammer, Werkzeug zum Zertrümmern von Bruchsteinen im Straßenbau). Der bis zu 50 Zentimeter lange Hammerstiel musste schwonk sein (elastisch und federnd), dabei aber auch dauerhaft und schwer zerbrechlich. Das erreichte man, indem man das ohnehin elastische runde Haselholz von zwei Seiten her abplattete. Das verlieh dem Werkzeug eine in Schlagrichtung wirksame Federung, die das Kisskloppe (Hämmern) wesentlich erleichterte.
sebbe (weiches e)
Das Zahlwort „sieben“ gibt es im Eifeler Dialekt in verschiedenen Variationen, „sibbe“ beispielsweise, „siwwe“ oder „sewwe.“ In Blankenheimerdorf ist sebbe gebräuchlich, im Nachbarort Nonnenbach sagt man dagegen siwwe. Die Sieben kommt in unserem Dialekt recht häufig in Verbindung mit Redewendungen vor. Ein beinahe klassischer Ausdruck ist beispielsweise Sebbesackspiefe, was wörtlich „Siebensackpfeifen“ heißt, bei uns aber „Siebensachen, Plunder, Herbseligkeiten“ bedeutet: Pack deng Sebbesackspiefe on hau ab heißt soviel wie „verschwinde. Sebbeschrööm (hartes ö) bedeutet „Siebenstriche“ und war ein, heute kaum noch bekanntes altes Kartenspiel, bei dem sieben Striche das Guthaben eines jeden Spielers bedeuteten, die Verlierer mussten jeweils einen Strich löschen. Die Striche wurden früher mit Kreide auf die Tischplatte gemalt. Sebbeschlööfer (hartes ö) (Siebenschläfer) ist der 27. Juni, ein „Lostag,“ der nach der Bauernregel das Wetter für die nächsten sieben Wochen ankündigt. Der sebbente Himmel ist der Inbegriff aller Glückseligkeit, und mit drejmool sebbe (21) wurde man zu meiner Kinderzeit großjährig. Sebbespröng (Siebensprünge) war früher ein beliebter Kirmestanz, der mehr „gesprungen“ als getanzt wurde. Der von Alendorf her durchs Naturschutzgebiet fließende „Lampertzbach“ verschwindet im oberen Talbereich im Boden und tritt unterhalb von Hüngersdorf in Gestalt der Sebbespröng (Siebensprünge = Sieben Quellen) wieder zutage. Und schließlich besagt eine Eifeler Weisheit, dass sich verschmutztes Wasser von selber reinigt, wenn es öwwer sebbe Stejn (über sieben Steine) geflossen ist. Do moss jät draan sen (Da muss etwas Wahres dran sein), denn: Zu meiner Kinderzeit fand man in der Jönzelbaach (Flurname) etwa 500 Meter oberhalb unserer Trinkwasser-Schöpfstelle ein zum Teil schon verwestes Reh im Bach, – tagelang hatten wir das Wasser getrunken, niemand ist krank geworden.
Sech bedde
Sich beten, ein etwas seltsames Dialektwort für das persönliche Gebet, im Gegensatz zu bedde (beten) im Allgemeinen. Das gemeinsame Gebet in der Kirche wurde beispielsweise einfach mit bedde umschrieben, und bei der Duëdewaach (Totenwache) wurde dr Ruësekranz jebedd (der Rosenkranz gebetet). Einfach nur jebedd wurde unter anderem auch in der Fronleichnamsprozession oder bei den Flurumgängen an den Bittagen (aktuell: Bitttage, - fürchterlich!). Die persönliche „Unterhaltung“ mit Gott dagegen, das Morgen- oder Abendgebet beispielsweise, wurde als sech bedde bezeichnet. So redete Mam (Mutter) dem Nachwuchs beim Frühstück ins Gewissen: Hat ihr öch och all jebedd (wörtlich: Habt ihr euch auch alle gebetet). Und abends hieß es vor dem Schlafengehen: Nu jö, jetz wiëd sech jebedd on dann de Trapp erop (Auf geht’s, jetzt das Nachtgebet und dann ins Bett). Bedd on sähn dech heißt wörtlich „Bete und segne dich,“ war unterdessen mehr oder weniger ein Stoßgebet. Vor einem riskanten Unternehmen beispielsweise wünschte man dem oder den Beteiligten: Bedd on sähn dech (öch), dat et joot jeht, und das heißt übersetzt: Gott gebe, dass es gut geht.
secke (weiches e)
Die mundartliche Umschreibung für „urinieren.“ Der Ausdruck wird vielfach als ein wenig ordinär, zumindest aber als „unfein“ eingestuft, er ist aber als Dialektwort nichts anderes als „pinkeln“ in der hochdeutschen Standardsprache. Das Wort secke hat in jedem Fall einen negativen Beigeschmack. Es gibt eine Vielzahl von Redensarten mit zum Teil recht unterschiedlicher Bedeutung, einige seien hier aufgezeigt. Et seck on seck on seck klagte der um die Ernte besorgte Bauersmann angesichts des Dauerregens. Jung do han ech äwwer ejne jeseck krijje entsetzte sich Alois beim Berühren des schadhaften Elektrokabels. Du wells mech wahl besecke ist der Ausdruck des Zweifels am Wahrheitsgehalt einer Behauptung. Bei manchen Zeitgenossen wird vor Lachen oder auch vor Angst die Hose feucht und das nennen wir dann en de Botz secke. Auch für ungewöhnlich rasantes Auto- oder Motorradfahren war secke ein gängiger Ausdruck: Mot der Maschin secken ech dem Düwel e Uhr aff (…fahre ich dem Teufel ein Ohr ab) freute sich beispielsweise der glückliche Besitzer der neuen Cross-Maschine. Die Fußballmannschaft schlich „bedröppelt“ vom Platz und Fritz kommentierte: Die hannse fönnefnull jeseck krijje. Ein derbes Wort für die Toilette ist Seckes (Seck-Haus, ähnlich wie Backes = Back-Haus). Die Kollegen aus meiner aktiven Dienstzeit kannte ein „gemäßigteres“ Wort für secke: maieme.
Seckoomes (hartes o)
Die Betonung liegt auf der ersten Silbe, das Wort bedeutet Ameise. Regional ist auch Seckoomejs gebräuchlich, hierbei liegt die Betonung auf „mejs.“ Der Wortteil oomes ist unverkennbar auf „Ameise“ zurückzuführen, die Silbe Seck bezieht sich vermutlich auf das Versprühen von Ameisensäure durch die aufgescheuchten Insekten. Die Tiere entwickeln bekanntlich einen sprichwörtlichen „Arbeitseifer,“ an der Ameisenburg ist ständige Betriebsamkeit zu beobachten. Daraus abgeleitet ist die positive Eigenschaft fließich wie de Seckoomesse (fleißig wie die Ameisen). Viele Personen auf relativ engem Raum verursachen e Jewimmels wie em Seckoomessehouf (ein Gewimmel wie am Ameisennest). Im Waldbereich „Brand“ bei Nonnenbach gab es in der Nähe vom „Potsdamer Platz“ jahrzehntelang an einer sonnigen kleinen Lichtung mitten im Fichtenwald eine Riesen-Ameisenburg, ein zwei Meter hoher Berg aus trockenen Fichtennadeln. Unser Sonntagsspaziergang führte uns sehr oft an diesem sehenswerten Naturwunder vorbei, in dem zweifellos Millionen von Ameisen lebten. Anfang der 1990er Jahre fanden wir von der stolzen Ameisenburg nur noch kümmerliche verfaulte Reste: Die Lichtung war zugewachsen, die lebensnotwendige Sonne reichte nicht mehr bis an den Bau, dessen Bewohner starben oder „umzogen.“ Im Gegensatz zu den winzigen Weg- oder Wiesenameisen, waren „unsere“ Roten Waldameisen nicht aggressiv, ich habe oft die Hand behutsam an das Nest gelegt und die Tierchen über die Haut laufen lassen, - übrigens ein kaum zu ertragendes Krabbelgefühl, - ich bin nie „gestochen“ worden.
Seckschirvel
Ein „fieses“ Mundartwort, dessen hochdeutsche Übersetzung Urinscherbe lauten müsste und das generell als Schimpfwort gebraucht wurde, zumindest aber die Umschreibung für eine wenig geliebte und unangenehme Person war. Heute ist der Ausdruck kaum noch bekannt. Schirvel ist allerdings auch heute noch unser Wort für die Scherbe jedweder Art, regional ist Scherv gebräuchlich (holländisch: scherf). Der bei unseren Vorfahren unentbehrliche Nachttopf wurde auch abfällig als Seckpott bezeichnet und bestand nicht selten aus Ton (Keramik) oder Glas. Wenn ein solches Gefäß zu Bruch ging, gab es Seckpottschirvele und daraus könnte abgekürzt die Seckschirvel entstanden sein. Das Wort wurde hauptsächlich abwertend für Frauen jeden Alters angewandt: Dat Seckschirvel knaatsch Daach on Nääch war beispielsweise der ärgerliche Kommentar über das fortgesetzte Weinen des kleinen Mädchens. Dat Seckschirvel hät mech doch mot dem Pitter bedresse beschwerte sich Mechel (Michael) über die Untreue seiner Geliebten, und von einem alten Klatschweib behaupteten die Leute: Wenn die Seckscherv nur de Muul opdeet, os et ad jeloëje. Anstelle von Seckscherv war gelegentlich auch Secküül (Urineule) gebräuchlich.
Seggebaach (weiches e)
Im Eifeler Dialekt ist der Bach bekanntlich weiblichen Geschlechts: De Baach. So ist beispielsweise der Nonnenbach de Nonnebaach, und analog dazu ist deren Nebengewässer, der Seidenbach, im Volksmund de Seggebaach. Der Ausdruck ist lokal auf den Raum Blankenheim beschränkt und darüber hinaus nicht bekannt. Der Seidenbach ist knapp einen Kilometer lang, seine Quelle unterhalb der Maiheck (Flurname) speist heute die Ringversorgung der Gemeinde Blankenheim. Der Bach mündet westlich von Schlemmershof in den Nonnenbach, das von ihm durchflossene Tal wird pauschal en dr Seggebaach genannt. Die Namensgebung ist zumindest ungewöhnlich: „Seide“ heißt in unserem Dialekt Sied, der Seidenbach müsste somit eigentlich Siedebaach genannt werden. Dasselbe trifft für die Flur im unteren Talbereich rechts des Seidenbachs zu: Offiziell „auf Seidenfeld,“ heißt es im Volksmund op Seggefeld. Die Ländereien Seidenbach und Seidenfeld gehörten früher zu den Höfen Bierth und Schneppen, die mitten im Wald lagen und längst zu Wüstungen geworden sind. Im unteren Talbereich der Seggebaach gab es damals einen zu Bierth gehörigen Fischweiher, Reste des alten Sperrdammes sind für den Kundigen heute noch erkennbar. Am Standort der heutigen Brunnenstube trat früher die Seidenbachquelle in einem Erdfall zutage, sie führte herrlich kühles kristallklares und wohlschmeckendes Wasser, hier labten sich die Bauern bei der Heuernte in der Sommerhitze. De Seggebaach ist heute Teil des Naturschutzgebietes „Seidenbachtal/Froschberg.“
setze
Wieder mal ein Dialektwort mit mehrfacher Anwendungsmöglichkeit, deren Bedeutung allein an der Aussprache erkenntlich ist. Setze mit hartem e gesprochen (Beispiel: Hetze) bedeutet „setzen“ in allen Varianten, oder auch „pflanzen,“ beispielsweise Jrompere setze (Kartoffeln pflanzen). Die Vergangenheitsformen hierbei sind satt und jesatt, etwa hä satt sech op de Bank (er setzte sich auf die Bank) oder häßte de Jrompere ad jesatt (hast du die Kartoffeln schon gepflanzt). Dä hät sech äwwer fies en de Bröhneißele jesatt besagt, dass jemand durch eigene Schuld in Misskredit geraten ist, und jät en de Zejdong setze ist die Umschreibung für „Zeitungsanzeige.“ Eine zweite Version ist setze mit weichem e gesprochen, und die bedeutet dann „sitzen.“ Hierbei sind die Vergangenheitsformen sooß (hartes o) und jeseiße, Beispiel: Ech sooß op dr Bank oder ech han op dr Bank jeseiße. Wenn früher der Benutzer des „Herzhäuschens“ ungewöhnlich lange am Ort verweilte, hatten die Eifeler eine derbe Erklärung hierfür: Dä setz ad en halev Stond om Abtrett, dä moß bestemp e Pötzsejl drieße. Eine solche Situation bezeichnete man auch als Langdress. Mit dem langen „Pötzsejl“ (Brunnenseil) zog man früher den Wassereimer aus dem Brunnenschacht herauf. Bliev noch jätt setze ist eine Einladung zum längeren Verweilen; Dä hät em Kittche jeseiße sagt man von einem Knastbruder. Das von setze abgeleitete Substantiv ist der Setz (Sitz), und davon hergeleitet ist unter anderem das Setzflejsch (Sitzfleisch).
Sevv (weiches e)
Das Wort bedeutet „Sieb“ und ist heute längst in der Mundart durch ebendiese hochdeutsche Bezeichnung ersetzt worden. Für unsere Eltern dagegen waren Siebe jeglicher Art Sevver (Plural von Sevv), ausgenommen waren allerdings feine Siebvorrichtungen, etwa das Kaffesiebche, mit dem beim Ausgießen der Stomp (Kaffeesatz) aufgefangen wurde. Ein mehr oder weniger engmaschiges Drohtsevv (Drahtsieb) diente auf der Baustelle zum Aussieben von „Putzsand.“ Genormte Siebe für die verschiedenen Getreidearten gab es beim Dreischkaaste (Dreschkasten = Dreschmaschine) oder auch bei der Wannmöll (mechanische Windfege zum Reinigen des Dreschgutes beim Flegeldreschen). Die Sevver befanden sich in Holzrahmen und wurden in die Maschine eingelegt. Dä hätt se net all om Sevv wurde von einem Zeitgenossen behauptet, der geistig etwas zurückgeblieben war oder Unsinn redete. Und wenn einer plötzlich sehr konfuses Zeug von sich gab, hieß es sogar: Dä hät se noch nie all om Sevv jehatt, - jetz hätte noch net ens mieh e Sevv. Da war also dem ohnehin mit Weisheit nicht besonders gesegneten Zeitgenossen auch noch das Sevv und damit die letzte Grundlage fürs Vernünftigwerden abhanden gekommen!
siefe
Die Silbe sief ist in unserem Dialekt generell ein Hinweis auf starke Nässe, das davon hergeleitete Zeitwort siefe bedeutet somit „triefen, fließen.“ Et räänt dat es sief (es regnet Bindfäden) ist ein gängiges Eifeler Wort, das gelegentlich aber auch in et räänt dat et tröütsch abgeändert wird. Siefich Wedder ist unser Wort für den Dauerregen, und wenn man unversehens in einen Regenguss gerät und völlig durchnässt daheim ankommt, so ist man siefnass geworden. Beinahe gleichlautend ist das Substantiv Siefnas, das unterdessen eine ständig tröpfelnde Schnoppnas (Schnupfennase) beschreibt. Du Siefnas ist auch ein gehässiges Schimpfwort für einen ungeliebten Zeitgenossen. Am 02. Juli ist das Fest Maria Heimsuchung, im Volksmund Maria Sief (wörtlich: Maria Nass) genannt. Die Bezeichnung geht auf eine alte Bauernregel zurück: Räänt et op Maria Sief, dann räänt et vierzich Daach stief (Regnet es an Maria Heimsuchung, dann bleibt es 40 Tage lang regnerisch). Der Siefen ist bei uns eine Geländeform oder auch eine grabenartige Senke im Wald. Der Siefen wird in der Regel von einem oft winzigen, aber nie versiegenden Rinnsal durchflossen, an dessen Wasser früher die Waldarbeiter ihren Durst löschten: Man grub mit den Händen eine kleine Vertiefung, wartete ab, bis sich der Mudd (Schlamm) am Boden abgesetzt hatte, legte sich auf den Bauch und trank aus dem natürlichen Becken. Das konnte man bedenkenlos tun, damals war der Regen noch nicht „sauer“ und das Waldwasser noch sauber. Siefen heißt auf Hochdeutsch „Seifen“ und ist mit der Schreibweise „Seiffen“ oft ein Teil von Ortsnamen, beispielsweise Schöneseiffen (Stadt Schleiden), das bei uns Schönnesiefe heißt.
Sonnech (weiches o)
Der Sonntag hat im Eifeler Dialekt verschiedene Namen, am gebräuchlichsten ist Sonndaach, daneben auch Sonndech, bei uns ist Sonnech üblich. Der lateinische „dies solis“ (Tag der Sonne) ist bei uns der siebte Wochentag, also das Wochenende, bei unserem Dechant Hermann Lux lernten wir Pänz (Kinder) allerdings, dass die Woche mit dem Sonntag beginnt. Unter ihm herrschte damals bei uns auch ein strenges Arbeitsverbot, nicht unbedingt erforderliche Sonnesärbed war eine Sünde gegen das dritte der Zehn Gebote. Ich weiß noch, dass wir daheim einmal, nach langer Regenperiode, an einem Sonntag im Heu arbeiteten, – dr Pastuër (der Pfarrer) hat uns nachträglich die Genehmigung dazu erteilt. Als ich in 1953 zur Bundesbahn zu gehen gedachte, wurde ich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bie dr Bahn äwwer och sonn- on fierdaachs jeärbed were moß, und weil mir das nichts ausmachte, hat mich mancheiner ziemlich schief angesehen. Heute fast ein Unding, für uns damals selbstverständlich: Sonntagskleidung, durch die allein schon kundgetan wurde, dass Sonnech war. Was ausschließlich sonntags getragen wurde, erhielt in der Namensgebung den Zusatz sonnes (sonntags) oder joot (gut), so beispielsweise joot Klejd, Botz, Hemp, Schlips, Schoh. Auf unsere Sonnesklamotte waren wir stolz und behandelten sie entsprechend. Vor einem Feiertag, wurden die joot Klejder intensiv gepflegt und aufbereitet. Mit bos Sonnech hammer Pitteschdaach bereiteten sich beispielsweise die „Dörfer“ früher auf ihr Patronatsfest „Peter und Paul“ vor.
sööke
In Unserer Standardsprache heißt es „suchen,“ die Nachbarn in Holland sagen „zoeken“ (gesprochen: suken), unser Dialekt macht sööke daraus (siehe auch: Sööke spelle). Eine uralte Weisheit unserer Vorfahren besagt: Wä söök, dä fend och (Wer suchet, der findet). Das trifft in vielen Fällen auch zu, manchmal aber ist jedes sööke vergebens. In einem solchen Fall schickten unsere Eltern – und schickt auch heute noch mancheiner – ein Stoßgebet zum heiligen Antonius von Padua, der Verlorenes wieder zu finden hilft. Aufgeklärte Zeitgenossen belächeln mitleidig derartigen „Humbug,“ zahlreiche Erfolgsmeldungen im Internet stimmen indessen nachdenklich. Ein gängiger Ausdruck ist „Das Weite suchen,“ was in unserem Dialekt wörtlich mit et Wegge sööke zu übersetzen wäre. Wir sagen unterdessen lieber und treffender stifte john oder auch affhaue, in Holland heißt das treffenderweise „het hazenpad kiezen“ (den Hasenpfad wählen = das Hasenpanier ergreifen). Es gibt Leute, die „ernten, wo sie nicht gesät haben,“ dieselben Leute „suchen, wo sie nichts verloren haben“ und das kommentieren wir so: Söök net, wo de nix verloren häß. Wenn einer wegen einer Kleinigkeit einen erheblichen Aufwand verursacht, dann heißt es von dem: Dä söök en Äez on verbrennt en Käez (Der sucht eine Erbse und verbrennt eine Kerze). Noch eine Redewendung: Mr söök kejn Wuësch en dr Hondshött (Man sucht keine Wurst in der Hundehütte = Wo nichts ist, ist auch nichts zu holen). Ech sööke menge Brell, – ratlos kramte Pap (Vater) in der Hobelbank-Ablage herum. Er hatte die Brille hoch in die Stirn geschoben, ich grinste ziemlich niederträchtig, – das hätte ich besser bleibenlassen.
Sööke spelle (weiches e)
Zu unserer Kinderzeit eine beliebte Spielbeschäftigung. Jooht jät Sööke spelle empfahl uns Mam (Mutter) das Versteckspiel, wenn uns die Langeweile plagte. Sööke spelle heißt in der Übersetzung „Suchen spielen,“ ein anderes Mundartwort war verberje (verbergen). In unserem ländlichen Wohnbereich gab es in Haus und Hof, in Stall und Scheune tausend Versteckmöglichkeiten, die man in der Stadtwohnung vergeblich sucht. Der Wald nahe beim Haus wurde aus unserem Versteckbereich ausgegrenzt, weil er zu viele Möglichkeiten bot: En dr Hardt jilt et net. Der „Sucher“ wurde per Üßzälle (Auszählen) ermittelt, während die übrigen Mitspieler sich versteckten, leierte er mit verbundenen Augen sein Sprüchlein herab: Eins zwei drei vier Eckstein, alles muss versteckt sein… Einmal kroch ich in ein zwei Meter langes dickes Heugebläserohr, das dann von den Mitspielern aufgestellt wurde. Der „Sucher“ bekam Wind von meinem Versteck und rannte dauernd dagegen an, um es umzukippen. Mein verzweifeltes Gebrüll stachelte ihn zu immer neuen Attacken an. Dann kippte das Rohr und ich mit ihm. Umfallen, ohne sich dabei abstützen zu können, - ein fürchterliches Gefühl. Der Sucher erhielt – unverdientermaßen – ein paar Tachteln und brüllte danach noch gewaltiger als zuvor ich. Nie wieder bin ich in ein Gebläserohr gekrochen.
Sou
Die beiden Vokale werden getrennt ausgesprochen: „So-u,“ regional sagte man auch Suu, beispielsweise bei uns daheim in Schlemmershof. Sou war der Allgemeinbegriff für das Schwein: Kirmes wiëd os Sou jeschlaach (Zur Kirmes wird unser Schwein geschlachtet). Sou war unterdessen in erster Linie das Wort für die Sau, den Eber nannte man Bier, der kastrierte Eber war ein Bärch. Obwohl das Schwein einer unserer begehrtesten Fleischliefanten ist, wird sein Name allenthalben als Ausdruck des Schlechten, Schmutzigen und Gemeinen angesehen, hier ein paar von zahllosen Beispielen: Domm (dumme) Sou, blöde Sou, dreckige Sou, fuul (faule) Sou. Wer Gossenwitze erzählte, war ein Sounickel, eine Person von anrüchigem Ruf war ein Souledder (wörtlich: Sauleder), das ungezogene Kind war ein Soubalech (Saubalg) und ein hinterhältiger Kerl war ein Souhond (Sauhund). Im Aachener Raum ist das Wort Saukäs als Ausdruck des Staunens, der Bewunderung oder des Schreckens üblich. Im und nach dem Krieg waren wir daheim wegen unserer kleinen Landwirtschaft „Selbstversorger,“ jedes Stück Vieh, jedes Huhn und jedes Ei aus unserem Stall war genauestens registriert, der Bestand wurde laufend kontrolliert. Dennoch wurde im Geheimversteck ein „schwarzes“ Söuche (Ferkel) bis zur stattlichen Sou herangemästet, die ebenso schwazz (schwarz, hier: geheim) geschlachtet werden mußte. Am Abend der „Schlachtnacht“ lag die Sau tot im Versteck: Rotlauf, das Fleisch verdorben. Der Weltuntergang hätte nicht schlimmer sein können. Bei Nacht und Nebel versenkten wir in einer Geheimaktion den Kadaver in eine höllentiefe Grube in der nahen Hardt.
Söüsblooß (hartes o)
Ein Begriff aus der Zeit der Hausschlachtungen: Die Schweinsblase. Das Schwein wurde geradezu „mit Haut und Haaren“ verwertet, nur ganz wenige Teile waren unbrauchbar, die Augen etwa oder die „Hornschuhe“ der Klauen. Die Schweinsblase war bei den Eifelbauern geradezu begehrt, Ohm Mattes beispielsweise schwor Stein und Bein, es gebe keinen besseren Tubaksböggel (Tabaksbeutel) als die Söüsblooß. Da war etwas Wahres dran, nach gründlicher Vorbereitung und Verarbeitung entstand aus der Blase ein Tabaksbehälter, der es mit jedem Lederbeutel aufnehmen konnte. Die frische Blase wurde sorgfältig gereinigt, anschließend wie ein Luftballon möglichst stramm aufgeblasen, dicht verschlossen und meistens in der Scheune zum Trocknen aufgehängt. Ich weiß noch, dass bei uns die Söüsblooß zwecks schnelleren Trocknens am Zacken eines Rehbockgehörns in der Stuvv (Stube) gehangen hat, - ein reichlich skurriler Wohnzimmerschmuck. Mein Ur-Urgroßvater Johann Plützer war königlicher Förster, etliche seiner Jagdtrophäen waren noch daheim vorhanden. Nach dem Trocknen wurde die Blase intensiv gerollt, gerieben und sonstwie „gequält,“ bis sie weich und geschmeidig geworden war. Das obere Viertel wurde einfach abgeschnitten, und fertig war der Tubaksböggel, in dem der geschnittene Strangtubak oder nach dem Krieg die Selbstzucht angeblich unendlich lange frisch und aromatisch blieb.
Söüsbonne (weiches o)
Mag auch die hochdeutsche Bezeichnung Saubohnen etwas „primitiv“ ausgefallen sein und hier und da gelegentliches Naserümpfen nach sich ziehen, – wer die Söüsbonne kennt, der weiß sie als Bestandteil einer deftigen Mahlzeit sehr wohl zu schätzen, gut durchwachsener Bauchspeck beispielsweise, gekocht oder als „falsches Kotelett“ gebraten, mit Kartoffeln und Saubohnen, – hmmh! Söüsbonne ist eigentlich ein „Nebenname,“ gängiger ist bei uns deck Bonne, „dicke Bohnen“ oder „Ackerbohnen“ ist auch im Hochdeutschen üblich. Da die Pflanze auch als Tierfutter, besonders für Schweine, verwendet wird, gab man ihr den Zusatznamen Söüsbonne. Wie Kartoffeln und Sauerkraut, so gehörten früher auch die deck Bonne zum Wintervorrat im Eifeler Bauernhaus, entsprechend groß war die benötigte Menge, für deren Anbau der Hausgarten nicht ausreichte. In der Regel wurde beim Kartoffelpflanzen ein angemessenes Feldareal für dicke Bohnen reserviert. Dieses Bonnefeldche (Bohnenfeldchen) lag am Rand des Ackers und war vom Gewannweg aus zugänglich: Die Bohnen wurden lange vor den Kartoffeln geerntet. Zur Konservierung wurden die aus der Hülle gepulten Bohnen getrocknet und im handlichen Bonnesäckche (Leinensäckchen) aufbewahrt, seltener wurden sie in Gläser eingemacht. Ein verhasster Schädling unserer deck Bonne besonders im Garten, ist die „schwarze Bohnenlaus,“ bei uns daheim schwazz Biester genannt, die oft zu Tausenden ganze Pflanzen befällt und sie regelrecht aussaugt. Hier erweist sich wieder einmal die vielgeschmähte Brennessel als segensreich: Brennesseljauche geht dem schwarzen Schädling kräftig zu Leibe. Außerdem gibt es in der Apotheke ein wirksames Pulver zum Bestäuben.
Söüskomp (weiches o)
Der Komp ist das Eifeler Wort für einen großen Topf oder Kessel, jedenfalls für einen geräumigen Behälter. Ein deutliches Beispiel ist der Veehkomp, der Futtertrog für die Stalltiere, der in der Regel aus Metall oder Keramik gefertigt ist. Bei uns daheim waren die Veehkömp (Mehrzahl von Komp) aus massivem Stein gehauen, wie nicht selten auch der Spölstejn (Spülstein) in den Eifeler Küchen, dessen Name auf das Material zurückzuführen ist. Ein spezieller Veehkomp war der Söüskomp, der Schweinetrog also. Diese meterlangen schweren Futterbehälter wurden nicht selten vom Dorfschreiner aus schweren Eichenbohlen hergestellt. Nach Vaters Tod erschien bei mir ein Dörfer Bauersmann. Er stammte aus der Südeifel, sein Dialekt war für uns schwer verständlich. Als er mich bat, ihm ein Dräujelche anzufertigen, geriet ich arg in Verlegenheit. Wie konnte ich, ohne unhöflich direkt zu fragen, herauskriegen, was ein Dräujelche war! Ich ließ mir zunächst die ungefähren Maße und Formen des Objekts anzeigen, konnte aber damit nichts anfangen. Erst der Aufstellungsort brachte mir die Erleuchtung: Der Schweinestall. Der gute Mann brauchte einen kleinen Futtertrog für seine Ferkel, im Dörfer Dialekt ein Söüskömpche. Der Dörfer Söüskomp war und ist in der Heimat meines Besuchers ein Drauch (Trog).
nach oben
Söüsuhr
Mit einer „Schweineuhr“ hat der Ausdruck natürlich nicht das Geringste zu tun. Gemeint ist vielmehr das Schweinsohr, das wir in mehreren Varianten kennen. Der Keulenpfifferling, ein guter Speisepilz, wird auch Schweinsohr genannt, Schweinsohr heißt ebenso ein vorzügliches Gebäck, und schließlich gibt es das Hörwerkzeug der Sou, das wegen seiner Paarigkeit fast nur in der Mehrzahl erwähnt wird: Söüsuhre. In manchen Ländern und Gegenden zählen Schweineohren zu den Delikatessen, in China beispielsweise, aber auch regional bei uns in Deutschland. Bei uns daheim wurde bei der Hausschlachtung aus Söüsuhre und Söüsfööß (Schweinefüße) eine sehr leckere Sülze hergestellt. Gekochte Schweinsohren und -Füße mit einem deftigen Schlag Sauerkraut entbehren beim Kenner auch heute noch nicht ihre frühere Beliebtheit. Nach dem Krieg gab es Söüsuhre beim Metzger nur auf Bestellung zu kaufen, seit etlichen Jahren liegen sie wieder, säuberlich verpackt und für wenige Cents erhältlich, im Kühlfach des Supermarktes. Mancheiner mag ob dieser „primitiven“ und billigen Speise die Nase rümpfen, dem Kenner dagegen sträuben sich die Haare angesichts von Schnecken, Muscheln, Heuschrecken oder ähnlicher teurer „Leckereien.“
Späller
Der Ausdruck ist vom Zeitwort spaale (spalten) hergeleitet und heißt übersetzt „Spalter.“ Regional ist auch spalde und analog dazu Spälder gebräuchlich. Der Späller ist ein mehr oder weniger gewichtiges Holzscheit. Früher schnitten die Waldarbeiter die Baumstämme auf „Meterlängen“ zu Raummeter-Klaftern zurecht, diese oft dicken „Rollen“ mussten mit Eisenkeil und Vorschlaghammer in Spällere (Mehrzahl von Späller) zerteilt werden, weil sie sonst zum Verladen auf den Wagen zu schwer waren. Das nämlich geschah, wie alle übrige Waldarbeit, von Hand, Hub- und Frontlader gab es noch nicht, auch keine Spaltmaschinen. Bei uns daheim wurden astfreie Bööche-Spällere (Buchen-Meterholz) auf etwa 80 Zentimeter verkürzt und mit der Axt noch einmal in handliche, dem Ofenholz entsprechende Scheiter gespalten. Diese langen und relativ dünnen Spällere wurden für das Beheizen des Hausbackofens gebraucht, man nannte sie Backspällere, Backschegger (Schegg, weiches e, = Scheit) oder ganz einfach Backholz. Aus astfreien Buchen-Spällere wurden auch die Plätten (Zahnleisten des Rechens) hergestellt (siehe: Reichel). Ein Späller war in jedem Fall ein abgespaltetes langes Holzscheit, kurze Scheite wie etwa das auf 25 Zentimeter geschnittene und gespaltene Ofenholz, fiel in die Kategorie Brandholz.
Späncher
Das Standardwort an der Oberahr für „Streich- oder Zündhölzer.“ Weitere Begriffe sind Füerspän, Feckspän, Strichspän, regional auch Schwävele in Anlehnung an „Schwefelholz,“ in Nettersheim entstand daraus Schwäjele. Das Spänchesdösje (Streichholzschachtel) wurde früher aus hauchdünnen Holzbrettchen hergestellt, war relativ stabil und diente zum Aufbewahren von tausenderlei Kleinigkeiten im Eifeler Haushalt. Leere Streichholzschachteln wurden selten weggeworfen. Interessant ist die holländische Bezeichnung der Zündholzschachtel: „Lucifersdoosje.“ Im Eifelhaus wurden die Späncher in der Ablage des Löffelblechs an der Wand über dem Küchenherd aufbewahrt, an das wir Pänz nicht heran reichten: Mot Füer spelle (Mit Feuer spielen, zündeln) war uns bei harter Strafe strengstens verboten, wegen der Brandgefahr in Stall und Scheune. Im und besonders nach dem Krieg waren Späncher geradezu kostbar, wir Hütebuben erhielten fürs Anzünden des Weidefeuers fünf Stück abgezählt. Die Amerikaner hatten Streichhölzer mit roten Köpfen, - für uns eine Neuheit. Noch interessanter waren die Streichholzheftchen, die wir noch nie gesehen hatten. Unser amerikanischer Freund „Tschäck“ (Jack) schenkte uns mehrere Packen Zündhölzer weil er wusste, dass sie bei uns rar waren. Ein ganzer Berg von Späncher, - da waren wir reich und hatten für lange Zeit ausgesorgt.
Spejel
Wejßte, wie en Jeck üßsitt? – Enää! – Dann kick ens en dr Spejel. Diese Aufforderung, im Spiegel das Aussehen eines Narren zu erkunden, war zwar in aller Regel humorvoll und gutmütig gemeint, konnte aber auch fies ent Ouch john (ins Auge gehen). Der Spiegel „sagt die Wahrheit“ und die kann nicht jeder Mitmensch vertragen. Dat kannste dir honner dr Spejel steiche war die Empfehlung, einen Gegenstand gut aufzubewahren oder einen guten Ratschlag in Erinnerung zu behalten. In unserer Stube daheim hing ein leicht „erblindeter“ Spiegel in verschnörkeltem breitem Holzrahmen an der Wand, dahinter steckten tatsächlich stets etliche Zettel mit Notizen oder Briefe mit besonderem Inhalt. Kick net dauernd en dr Spejel, sons wießte wöös (Schau nicht dauernd in den Spiegel, sonst wirst du hässlich) war früher ein elterliche Rat, der aber meistens bei der eitlen Tochter wenig Gehör fand. Spejelei mot Brootjrompere (Spiegelei mit Bratkartoffeln) war – und ist – eine sehr leckere Mahlzeit, bei uns daheim gab es das meistens als Abendbrot. Als Üülespejelskrööm (Eulenspiegeleien) bezeichnen wir eine dumme und nutzlose Tat, die wir auch mit Wasser en de Baach schödde (Wasser in den Bach schütten) umschreiben. Spejele nannte man früher auch großflächige Möbelteile wie beispielsweise die „Füllungen“ der Wände und Türen am Kleiderschrank. Unsere modernen Spanplatten gab es damals nicht, die Spejele wurden in mühsamer Handarbeit aus dünnen Brettern zusammen geleimt.
Splitterholz
Ein in unserer Eifel noch lange Jahre nach dem Krieg verhasster und gefürchteter Begriff bei den Forstleuten und Sägewerksbetreibern, nicht zuletzt auch bei den Dorfschreinern und Möbelfabriken. Selbst heute noch kann in Altbeständen Splitterholz auftauchen: Granat- und Bombensplitter oder Gewehrkugeln aus dem zweiten Weltkrieg als schädliche Rückstände, die den Holzwert enorm herabsetzen. Himmeldunnerwedder, fluchte seinerzeit Steffens Mattes, der am Standort unseres heutigen Bürgerhauses am „Vogelsang“ (damals Bahnhofstraße) ein kleines Sägewerk betrieb, zwei Jadderbläder am Aasch, dr Düwel soll et Splitterholz holle. Ein Bombensplitter im Holz hatte zwei Sägeblätter des Gatters zerrissen, da soll einer noch friedlich bleiben. Ähnlich erging es Zalentengs Pitter (Peter Steffens, der Vater von Mattes), der nach dem Krieg mit einer metergroßen Kreissäge Bauholz schnitt. Winzige Metallsplitter fanden sich gelegentlich sogar noch in Vaters Schreinerholz und verursachten Kätsche (Schadstellen, Kerben) im Hobelmesser oder stuppe (stumpfe) Kreissägen. Heute wird Rundholz automatisch durch Metalldetektoren überprüft, bevor es zur Säge gelangt.
Sponn (weiches o)
Die hochdeutsche „Spinne“ wird in der Regel im Eifeler Dialekt zur „Spenn,“ im Dörfer Platt ist unterdessen die Umwandlung des Vokals gebräuchlich: Aus i wird o und damit aus der Spinne die Sponn. Für den Nicht-Dörfer ergibt sich hieraus in bestimmten Anwendungen geradezu ein Zungenbrecher, en der Koss os en Sponn (in der Kiste ist eine Spinne) vermag beispielsweise der eingeborene Nonnenbacher nur schwer auszusprechen, allerdings ist das stimmlose e der Nonenbacher für die Umwelt nicht weniger problematisch. Logischerweise müsste das „Spinnchen“ im Dörf zum Sponnche werden, tut es aber nicht: wie der Schmodd zum Schmeddche (Schmied /Schmiedchen), so wird die Sponn zum Spennche. Der Hausfrau zum ständigen Ärgernis, dem Naturfreund dagegen zur Freude, gereicht das Sponnejewevv (Spinnengewebe), ein Kunstwerk, das der Mensch nicht nachmachen kann. Auf dem Heustall (Heuboden) turnten wir Kinder beim Heudämmele (Verdichten durch Darüberlaufen) zwischen meterlangen, von den Dachpfannen herunter hängenden staubgefüllten Sponnejewevver herum, – ekelhaft, aber nicht zu umgehen. Eine Bauernregel besagt: Wenn em September de Sponne kruche, dohn se en harte Wonter ruche (Übersetzung: Wenn im September die Spinnen kriechen, tun sie einen harten Winter riechen). Und eine ähnliche Regel lautet: „Ziehen die Spinnen ins Gemach, folgt sogleich der Winter nach.“
spotz (weiches o)
Auch hierbei wird die „Dörfer“ Gepflogenheit der Vokalumwandlung ersichtlich: Aus dem hochdeutschen Adjektiv „spitz“ macht der Eifeler generell ein „spetz“ (weiches e), bei uns aber wird daraus spotz. Ein geradezu klassisches Beispiel hierfür: Bei strenger Kälte sagt der „Dörfer“ et os spotz (es ist spitz), die Nachbarn in Blankenheim aber behaupten: et es spetz. Die Spitze allerdings heißt auch bei uns de Spetz (weiches e), und der Spitzbube ist bei uns sowohl der Spetzbov als besonders bei der älteren Generation auch der Spotzbov, – unser Dörfer Platt ist eine Wissenschaft für sich. Eine Redewendung unserer Eltern war und ist zum Teil auch heute noch spotz wie en Süül und das bedeutet wörtlich „spitz wie eine Schusterahle,“ beschreibt aber auch nicht selten eine lebenslustige („sexy“) Person: Dä/dat os spotz wie en Süül. Im Zusammenhang mit Körperteilen ist spotz in jedem Fall von negativer Bedeutung: Nase, Zunge, Kinn, Finger, Knie. Es gibt eine Faustregel: En spotze Nas on spotz et Kenn, drejmol setz dr Düwel dren (Spitze Nase, spitz das Kinn, dreimal sitzt der Teufel drin). Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt ist mancher Patient nur noch ein Schatten seiner selbst und die Leute tuscheln hinter der Hand: Jung dä os äwwer spotz jewore (…mager geworden). Jätt spotz krejje (spitz kriegen) bedeutet „etwas herausfinden,“ und spotz Bemerkunge sollte man tunlichst nicht von sich geben.
Spööl (gedehntes ö)
Im modernen Haushalt unserer computergesteuerten Zeit existiert das alte Dialektwort Spööl nicht mehr, dafür sorgt der vollautomatische Geschirrspüler. Dr Spööl (der Spül) war früher die Gesamtheit des zu spülenden Geschirrs etwa nach dem Mittagessen. Wenn im Sommer die Heuernte aufs Einbringen wartete, war der Bauersmann arg im Druck und Ohm Mattes bestimmte nach der hastig eingenommenen Mahlzeit: Dr Spööl bliev stohn bos mir de Maiheck eren han, und das hieß, dass zuerst das Heu von der Maiheck (Flurname) heimgeholt und danach erst das Geschirr gespült wurde. In manchen Haushalten gab es den Spöölejmer (Spüleimer) zur Aufnahme der Spül- und Küchenabfälle, die dann auf dem Düngerhaufen „entsorgt“ wurden. Bei uns wurde nur das Spülwasser weggekippt, die Abfälle und Mahlzeitreste kamen in den Söüsejmer und wurden an die Schweine verfüttert. Einen Spöölstejn (Spülstein = Spülbecken) gab es bei uns daheim nicht: Wir hatten keine Wasserleitung. Wenn man ihren Kaffee als Spöölwasser bezeichnete, konnte unsere Jött mächtig ungemütlich werden. Ein mir als Kind geradezu verhasster und auch heute noch ungeliebter Haushaltsgegenstand ist der Spööllappe, vielfach auch Spööldooch (Spüllappen/Spültuch) genannt. Auch nach sorgfältigstem Auswaschen haftet dem Fetzen ständig ein unangenehmer Geruch an und beim „Einsatz“ fühlt er sich ekelhaft fett und glitschig an. Und manchmal soll sogar der Spööllappe als Angriffswaffe oder Belehrungshilfe zur Anwendung kommen.
Stahle
Die Schreibweise ist je nach Region verschieden: Staale, Stahle, Stale oder an der Oberahr auch Stoohle (hartes o). In der Regel bezeichnet man damit eine Muster- oder Probensammlung, zusammengeführt im Stahlebooch (Musterbuch). Das Tapetenbuch des Anstreichers beispielsweise war ein Stahlebooch. Die Schreibweise Staal ist mit dem holländischen staal verwandt und bedeutet dort unter anderem „Muster“ oder „Probe.“ Die Stahle in Blankenheimerdorf und auch die Stoohle an der Oberahr bezeichnen dagegen hoch gewachsene junge Baumstämmchen. Es gibt sie hauptsächlich im dichten Laubholzaufwuchs, wo sie nicht selten nur etwa armdick, dafür aber sechs Meter und höher werden. Wenn nicht geläutert wird, sterben viele dieser dünnen Bäume ab, das „stehende Holz“ wird steinhart und trocken. Düër Bööchestahle (Dürre Buchenstangen) waren früher fürs Heizen begehrt, die ofenfertigen Stücke bezeichnete man gelegentlich als „Holzbriketts, weil sie lange vorhielten. Auch als Rievkoocheholz waren Bööchestahle beliebt, weil sie beim Reibekuchenbacken rasch die erforderliche Hitze erzeugten. Düër Stahle gab früher der Forstbeamte für ein paar Pfennige heraus, heute bleiben sie als „Totholz“ zur Düngung des Waldbodens an Ort und Stelle.
Stätz
Der Stätz ist unser Wort für einen, dem Tier vorbehaltenen Körperteil, nämlich den Schwanz. Freilich gibt es auch den menschlichen Stätz, doch existiert der nur in der Gossensprache und gehört nicht ins Dörfer Lexikon. Gleiches gilt auch für die Unzahl obszöner Witze. Einer dieser Sorte ist unterdessen doch halbwegs salonfähig: Welech Vüjel han dr Stätz vüër? (Welche Vögel tragen den Schwanz vorne), – die Lösung ist der Name einer sehr bekannten Musikgruppe. Den Namen behalte ich vorsichtshalber für mich, nicht dass sich diese Männer eventuell op dr Stätz jetrodde (auf den Schwanz getreten) fühlen. Dass aber auch der Mensch vor Jahrmillionen einen echten Stätz besaß, ist aus dem Stätzknäuchelche (Schwanzknöchelchen = Steißbein) ersichtlich, das uns manchmal ziemliche Pein bereiten kann. Stätzschwenke (Schweifwedeln) ist beim Hund Ausdruck der Freude, ein menschlicher Stätzschwenker ist ein Schmeichler, Kratzfüßler und „Radfahrer.“ Der enjeklemmte Stätz (eingezogener Schwanz) dagegen ist beim Hund ein Zeichen von Angst und Unterwerfung, auch der menschliche Feigling zöch dr Stätz en on häut aff (macht einen Rückzieher), wenn ihm eine Sache zu brenzlich wird. Unsere Brong (Kuhname = die Braune) besaß die fatale Angewohnheit, der Melkerin unverhofft ejne mot dem Stätz ze wösche (einen Schwanzhieb zu versetzen), also wurde ihr Köhstätz (Kuhschwanz) für die Dauer des Melkens mit einer Schnur ans Hinterbein festgebunden. Im Hochdeutschen wird der Stätz von Fall zu Fall mit klangvollen Namen versehen, „Schweif“ beispielsweise beim Pferd, „Blume“ beim Kaninchen, „Rute“ beim Hund und „Lunte“ beim Fuchs. Beim Wildschwein ist es der „Bürzel,“ beim Hausschwein reden wir schlicht und einfach vom Söüsstätz. Ein solcher Kringelschwanz spielte sogar schon bei Wilhelm Busch („Abenteuer eines Junggesellen“) eine lustige Rolle: „…und an Knoppens Fracke hing gleich darauf ein krummes Ding.“ Der Stätz heißt bei unseren holländischen Nachbarn „staart.“
stauche
Unser Dialektwort für „heizen,“ interessanterweise aber auch für „schnell fahren, rasen.“ Die Zeiten haben sich deutlich geändert: Früher „raste“ eine Auto „mit achtzig Sachen“ durch die Gegend, der moderne Sportwagen unserer Tage „stocht mit 200 über die Autobahn.“ Der Begriff „stochen“ im Sinne von „heizen“ ist heute fast nur noch in ländlichen Gegenden als stauche gebräuchlich (siehe auch: Stauchiese). Im Bauernhaus unserer Eltern war der Küchenherd die „Heizzentrale,“ die frühmorgens aanjestauch (angeheizt) wurde und somit Aanstauchholz benötigte. Das wurde in Gestalt gespaltener Fichtenstücke, totem Astholz oder Fichtenzapfen bereitgehalten. Jung ihr hat joot jestauch (ihr habt gut geheizt) freute sich der Besucher beim Eintritt ins Haus, rieb zufrieden die Hände über dem Herd und konstatierte: Bie öch os et ens emmer jät schön wärm (sinngemäß: Lob wegen der wohligen Wärme). In größeren Betrieben, im Sägewerk beispielsweise, gab es eine mächtige Dampfmaschine zur Stromerzeugung oder zum Antrieb der Transmission. Das Maschinenhaus wurde auch Stauches (Stochhaus) genannt. Füërche stauche (Feuerchen machen) war bei uns Kindern eine beliebte, von den Eltern aber wegen der Brandgefahr verbotene Beschäftigung. De Pief stauche bedeutete die Pfeife in Gang bringen, und wenn man bei brüllender Sommerhitze bei der Heuernte schwitzte, schickten die Leute ein Stoßgebet zum Himmel hinauf: Stauch doch net jrad esu jeckich do owwe, – der Himmelsherr sollte also die Sonnenheizung ein wenig drosseln. Jestauch ist eine Vergangenheitsform von stauche, wir kennen unterdessen auch jestauche, was aber „gestochen“ bedeutet: Do hät mech doch en Wespel jestauche (Da hat mich doch eine Wespe gestochen).
Stauchiese
Ein solches Gerät war früher in jedem Haus unentbehrlich, heute findet man ein Stauchiese hin und wieder noch in ländlichen Gegenden, wo noch mot Holz on Kolle jestauch wiëd (mit Holz und Kohlen geheizt wird). Im modernen Haushalt zählt es – natürlich in modernem Outfit – zum Kaminbesteck: Das Schüreisen, allgemein eher Schürhaken oder Stocheisen genannt, wird auch heute noch in vielfachen Variationen im Handel angeboten. Eine Spezialanfertigung besitzt beispielsweise einen hohlem Schaft und ein Mundstück am Griff zum „Anblasen“ der Ofenglut. „Stochen“ ist ein heute nicht mehr übliches Standardwort für „heizen,“ im ländlichen Raum allerdings als stauche noch allenthalben im Dialekt vorhanden. Das Eifeler Stauchiese war in der Regel ein an der Spitze rechtwinklig gebogener Eisenstab mit einem Holzgriff. Zusammen mit der Füërschöpp (schmale Einhandschaufel, die ins Feuerloch des Ofens passte, siehe: Füërschöpp) hing das Stauchiese am Nagel neben dem Küchenherd. Für die Verteilung der Glut im häuslichen Backofen war naturgemäß ein besonders langes Stauchiese erforderlich, das war die Kluëch, eine meterlange Feuerzange (siehe: Kluëch). Notfalls konnte – und kann – das Stauchiese zur wirksamen Waffe werden. Wenn Mam (Mutter) uns Streithähnen drohte: Ech holle jlich et Stauchiese (Ich hole gleich das Stocheisen), dann wurden wir meistens friedlich: Nicht etwa aus Furcht vor Schlägen mit dem Eisen (die hat es daheim nie gegeben), vielmehr aus Respekt vor dem Schwazzmaache (Schwarzmachen) mit dem ständig verrußten Gerät. Das Schüreisen heißt in Holland „vuurhaak“ (Feuerhaken, gesprochen „vürhaak“).
steiche
Den Ausdruck steiche verwenden wir sowohl in der Bedeutung „stechen“ als auch „stecken,“ wir sagen beispielsweise de Beje steichen dech en dr Fonger (die Bienen stechen dich in den Finger), und wenn sie dann jestauche han (gestochen haben), bleibt der Stachel en dr Hutt steiche (in der Haut stecken). Im Zusammenhang mit steiche gibt es eine Fülle von Redensarten, einige seien hier aufgeführt. E Steckelche steiche (wörtlich: Ein Stöckchen stecken) kennt der Eifeler als Ausdruck für das Vereiteln eines Vorhabens. Dä bröllt wie e jestauche Kalev besagt, dass jemand „wie ein gestochenes Kalb“ brüllt. Dä stich wahl de Haver heißt auf Hochdeutsch „Den sticht wohl der Hafer). „Stechen“ heißt bei den Holländern „steken,“ und für den „stechenden Hafer“ haben unsere Nachbarn eine herrliche Umschreibung: De broodkruimels steken hem (Den stechen die Brotkrümel). Dech steichen ech doch ad lang en de Teisch (…in die Tasche) ist meistens eine überhebliche Behauptung, und wer etwas unterschlagen hat, der hat jät en de ejene Teisch jestauche (etwas in die eigene Tasche gesteckt). De Köpp zesame steiche bedeutet „Heimlichkeiten, Tuscheln.“ Ejnem jät steiche ist unser Wort für „persönliche, geheime Nachricht.“ Em Dreck steiche ist die Umschreibung für „Missliche Lage, Notlage). Wenn ein Bekannter nach längerer Abwesenheit plötzlich wieder da ist, wird er gefragt: Na, och wier em Land, wo häßte die janz Zitt jestauche (…wo hast du die ganze Zeit gesteckt). Und wenn er Bauchweh hat, klagt der Eifeler: Ech han jät Steichens em Buch (Ich habe Stechendes im Bauch). Die „Steckdose“ behält unterdessen auch in unserem Dörfer Platt ihren Namen: Steckdoos.
Steijer
Die Scheune des Eifeler Kleinbauern war in aller Regel räumlich ziemlich beengt, die Tenne war gerade eben mal so groß, dass ein beladener Heu- oder Erntewagen hinein passte. Dabei musste die Deichsel hochgestellt oder durch die Schurp (schießschartenähnliche Maueröffnung, siehe: Schurp) geführt werden. An einer Tennenseite befand sich meistens der Viehstall und darüber der Heustall (Heuboden), an der gegenüber liegenden Seite war der Stapelraum für das noch nicht ausgedroschene Getreide, die so genannte Waisch. Deren Boden lag wesentlich tiefer als die Tenne, das ergab mehr Stapelplatz. Um eine Ablage für das ausgedroschene Stroh zu schaffen, wurde in ungefähr vier Metern Höhe über der Tenne eine Balkendecke eingezogen, und das war der Steijer, zu dem eine fest eingebaute senkrechte Leiter hinauf führte. Der Steijer war zweigeteilt, mitten über der Tenne gab es eine meterbreite Lücke zwischen den Balken, durch die die Büsche (dicke Strohbündel) hinaufgereicht wurden. Der Steijer war nach drei Seiten hin offen, es gab weder ein Geländer noch sonstigen Schutz, das Betreten war uns Kindern strengstens verboten. Das Hochwuchten der relativ schweren Büsche auf den Boden erforderte eine gute Portion Muskelkraft, bei uns gab es dafür eine drezinkige Gabel mit besonders langem Stil, die nur Ohm Mattes zu handhaben vermochte.
nach oben
Stejn
Der „Stein“ wird in weiten Gebieten der Eifel im Dialekt zum Steen, im Dörfer Platt und an unserer Oberahr heißt er unterdessen Stejn, was wohl auch eher dem Standardwort entspricht. Bei unseren Eltern war vielfach sogar Stej gebräuchlich, ein Relikt aus dieser Zeit ist heute noch die Ortsbezeichnung Stejveld (Steinfeld). Om Stejn (Auf dem Stein) ist die Flurbezeichnung der Anhöhe nördlich vom Dorf, wo seit mehr als 40 Jahren das Wiesenfest Für os Pänz stattfindet. Hier war früher der Sportplatz, heute stehen dort die Grillhütte und mehrere ortsfeste Wiesenfest-Anlagen. Eine weitere Flurbezeichnung ist op Huhstejn (auf Hochstein) am südlichen Ortsrand. Im Waldbereich „Urbach“ im Ripsdorfer Eichholz gibt es den Düwelsstejn (Teufelsstein), ein Sandsteinfelsen, auf dessen senkrechter Wand schon in meiner Kinderzeit die dritte Strophe von Eichendorfs „Abschied“ geschrieben stand (Da steht im Wald geschrieben ein stilles ernstes Wort…“). In Nettersheim ist die Stejnrötsch (Steinrütsch = Geröllfeld) eine bedeutende Fundstelle aus der Römerzeit. Der Ronde Stejn (Runder Stein) steht in Pitteschholz (Petersholz, Flurname) bei Milzenhäuschen, der Sage nach dreht er sich jedes Mal beim Mittagläuten um sich selbst. Unser Stejndöppe (Steintopf) ist ein Keramikgefäß, in dem bei uns daheim Butter, Schmalz und Salz aufbewahrt wurden. Stejnollich (Steinöl) ist unser recht treffendes Wort für das Petroleum. Und Stejnweich (Steinweg) ist eine frühere Bezeichnung für befestigte Straßen. Einen Steinweg gibt es sogar in unserer belgischen Partnerortschaft Sint Stevens-Woluwe: Den „Leuvensesteenweg“, die Hauptstraße. Eine Düerstejn (Türstein) hatten wir daheim vor der Haustür: Eine Trittstufe aus Naturstein, auf der man sogar Messer schleifen konnte. Ein Stejnknacker (Steinknacker) zum Zerkleinern von Felsbrocken stand nach dem Krieg im Stejnbruch am Atzeberg, die schwere Maschine wurde durch einen Traktor angetrieben.
Stejndöppe (weiches ö)
Heute mehr oder weniger nur noch zu Dekorationszwecken gebraucht, war das Stejndöppe (Steintopf, Steinzeug) zur Zeit unserer Eltern ein unentbehrliches Haushaltsutensil im bäuerlichen Alltag. Stejndöppe gab es in allen denkbaren Formen und Größen. In jeder Eifeler Küche hing das Döppebrett (Topfregal) an der Wand mit verschließbaren beschrifteten Keramikgefäßen in verschiedenen Größen. Bei uns daheim war das ein schön geschnitztes Holzregal mit zierlichen viereckigen Töpfen in drei Größen, die Größten fassten etwa einen Liter und waren laut Aufschrift für Mehl, Salz, Zucker und Grieß bestimmt, die beiden kleineren Formate waren für Gewürze gedacht. Keiner der Töpfe erfüllte unterdessen seinen eigentlichen Sinn, sie alle enthielten kunterbuntes Allerlei, nur nicht das, was die Aufschrift verkündete. Das nämlich fand sich im Köcheschaaf (Küchenschrank): Butter und Schmalz, Salz und Zucker wurde dort in massiven grauen Steintöpfen verwahrt, mit blauem Blumendekor, wie man sie heute als Ziertöpfe verwendet. Besondere Bedeutung kam dem Stejndöppe bei der Herstellung von Suëre Kappes (wörtlich: saurer Kohl = Sauerkraut) zu. In das mächtigen Gefäß wurde der gehobelte Wieße Kappes (Weißkohl) mit Salz und Wacholderbeeren lagenweise eingestampft und verwandelte sich nach zwei bis drei Monaten in jenes Standardnahrungsmittel, das uns Deutschen im Krieg bei den Amis den Spottnamen „Krauts“ eintrug.
Stejnollich
Stejnollich bedeutet „Steinöl“ und ist unser Wort für „Petroleum,“ was seinerseits in der wörtlichen Deutung ebenfalls „Steinöl“ ergibt: „Petra“ ist das griechische Wort für „Felsen, Stein,“ und „oleum“ ist Latein und bedeutet „Öl.“ Diese Begriffe sind bei mir aus der Gymnasiumszeit „hängen geblieben.“ Als der elektrische Strom unsere Eifel noch nicht gefunden hatte, war Stejnollich in jedem Haus vonnöten: Als Leuchtmittel, Brennstoff für die Stejnollichslüech (Petroleumleuchte, -lampe). Auch im und nach dem Krieg, als unsere Kraftwerke zerbombt und die Stromversorgung im Eimer waren, kam die gute alte Lüech nochmals zu Ehren. Den Betriebsstoff gab es zunächst noch auf „Bezugsschein,“ später nur noch auf dem Schwarzmarkt. Als ich in 1953 bei der Bundesbahn meinen Dienst begann, waren noch sämtliche Signale und Weichen mit Petroleumlampen bestückt. Die mussten täglich gereinigt und gefüllt werden, – eine echte „Sauarbeit,“ es gab sogar eine besondere „Vorschrift über die Wartung und Reinigung der Signallaternen.“ Die älteren „Dörfer“ erinnern sich noch an Schaafs Hermann, einen allein lebenden Junggesellen. In seinem Haus gab es keinen Strom, er hat zeitlebens mit Stejnollich Licht gemacht. Über seinem Lager hatte er vor der Stejnollichslamp eine dicke Sammellinse so platziert, dass ihr Lichtbündel ihm das Lesen im Bett ermöglichte. Für Stall und Scheune benutzten früher die Leute die so genannte Stall-Lüech, jene „Sicherheits-Laterne“ mit Drahtkorb und Henkel, die es heute noch zu Dekorationszwecken gibt. Trotz der „Sicherheitsbauweise“ war eine solche Lüech in der Landwirtschaft eine brandgefährliche Sache. Eine Stall-Laterne (Stalllaterne!) hängten auch die Fuhrleute ans Heck ihrer Fahrzeuge, wenn sie nächtlicherweile unterwegs waren.
Stejveld
Das v wird wie w gesprochen und das e in „veld“ ist stimmlos. Aus dem ursprünglichen Stejveld ist bei uns inzwischen weitgehend Stejnfeld geworden und das kommt dem korrekten Ortsnamen „Steinfeld“ deutlich nahe. Regional ist allerdings auch heute noch Steeveld gebräuchlich. In Steinfeld ist der, zu meiner Jugendzeit noch „selige“ Eifelheilige Hermann-Josef begraben, die Salvatorianer des Klosters unterhielten seit 1924 eine private Knabenschule zur Heranbildung von Ordensnachwuchs. Durch Erlass der damaligen Reichsregierung wurde die Schule in 1940 zwangsweise geschlossen, Wiedereröffnung war am 11. Oktober 1945, ab dem Schuljahr 1946 waren auch „weltliche“ Schüler zugelassen, also nicht nur Ordensnachwuchs. Ab diesem Zeitpunkt gab es auch die „externen“ Schüler, die nicht mehr im Internat wohnen mussten. Zu den Externen gehörte ich selber von 1948 bis 1953. In Anlehnung an die Ursprünge der Klosterschule, herrschte auch zu meiner Zeit noch die irrige Volksmeinung: Wä noo Stejveld jeht, dä well Pastur were (Wer nach Steinfeld geht, der will Pastor werden = Theologie studieren). Ein Nachbar, der mich nicht leiden konnte, nannte mich daheim immer gehässig dr Pater. Bis 1960 war Steinfeld ein Progymnasium, das erste Abitur wurde am 11. März 1961 gefeiert. Heute ein modernes Vollgymnasium, waren meine Steinfeld-Jahre noch weitgehend „katholisch geprägt,“ man tat gut daran, ein braver und eifriger Schüler zu sein. Einmal drückte ich mich, zusammen mit drei weiteren Schülern, vor dem Besuch des Gottesdienstes an einem der neun „Hermann-Josef-Dienstage,“ – das war schon beinahe eine Todsünde. Im Jahr 1946 besuchten Mutter und ich meine Schwester Christel, die in Stejveld in der Klosterküche „in Stellung“ war. Wir machten die Reise zu Fuß, etwa 15 Kilometer von Nonnenbach bis Steinfeld. An der Klosterpforte wurden wir beköstigt, es gab Kartoffelsalat und dazu „Rohesser“ (Räucherfisch), für uns ein wahres Festessen. Auf dem Rückmarsch rasteten wir ziemlich erschöpft am Straßenrand. Dort fand uns Fritz Müller aus Blankenheim-Wald und erbot sich, uns mit seinem Beiwagen-Krad nach Hause zu fahren.
stippe
Das Mundartwort für „stützen, stabilisieren.“ Der Stippe war früher ein Zaunpfahl oder auch ein Stützbalken, ein dünnes Stöckchen war ein Stippche. Ein bekanntes Wort war e Stippche steiche (Ein Stöckchen stecken = einen Riegel vorschieben). Ein heute fast vergessener Dorfbrauch war das „Hausstippen“ anlässlich einer Hochzeit. In der Hochzeitsnacht wurde das Brauthaus mit Holzstämmen, Wagenbrettern, Leitern und ähnlichem Material jestipp (gestützt), damit die Wände ein etwaiges „Beben“ überstanden (Dettman/Weber). Dieses an sich heimliche Tun wurde selbstredend bemerkt, manchmal wurden wir Stipper ins Haus gebeten und mit ein paar hochprozentigen Stärkungen für unsere „Schwerarbeit“ gerüstet. Das Stippen war Ehrensache und ein Beweis für die Beliebtheit der Brautleute im Dorf, Nichtstippen hätte eine Kränkung bedeutet. In der Regel wurde beim Stippen die Haustür verbarrikadiert, der Bräutigam musste morgens zum Gaudium der Nachbarn aus dem Fenster steigen und das Hindernis beseitigen. In Blankenheimerdorf war das Stippen noch in den 1960er Jahren üblich. Auf stippe im Sinne von „herausstrecken“ ist auch das Stippeföttche aus dem Kölner Karneval zurückzuführen.
Stippe
Der Stippe ist das von „stippe“ hergeleitete Substantiv und bedeutet „Stütze, Strebe, Pfahl“ (siehe: stippe). Generell war der Stippe eine Stützvorrichtung aus Holz, mehr oder weniger ein Balken, Metallstützen etwa beim Bau, waren auch im Dialekt Stütze oder Dräjer (Träger). Früher stapelten die Waldarbeiter das Brennholz zu Raummetern auf, so genannte Klooftere (Klafter). Die Stapel wurden beiderseits durch in die Erde geschlagene Stippe abgegrenzt, die Stippe wurden zusätzlich noch durch schräge Streben gegen Umbrechen gesichert, – Waldarbeit war eine Knochenarbeit. Die Zaunpfosten, mit denen die Bauern ihre Weiden einfriedeten, hießen meistens Zongpööl (Zaunpfähle, hartes ö), lokal wurden sie aber auch einfach de Stippe genannt. Das angespitzte Ende neuer Stippe wurde im offenen Feuer leicht angebrannt, das erhöhte die Widerstandskraft gegen Fäulnis. Alte abgefaulte Stippe wurden oft aus Bequemlichkeit an Ort und Stelle im Zaun belassen und einfach ein neuer Pfosten daneben eingeschlagen. Das konnte Ohm Mattes (mein Onkel) absolut nicht leiden, er selber transportierte die alten Pfähle heim: Aus dem trockenen Fichtenholz ließ sich gutes Aanstauchholz für den Küchenherd herstellen. Eine Bauernregel besagt: Stejt de Sonn op Stippe, dann jitt et moër vill Trippe, doch setz et Sönnche Bredder, dann jitt et moër joot Wedder. Die freie Übersetzung ist: Wenn die Sonne scharfe dünne Strahlen (Stippe) zur Erde wirft, gibt es am nächsten Tag Regen (Trippe = Tropfen); sind die Strahlen aber breit (Bredder = Bretter), ist mit gutem Wetter zu rechnen.
Stöck (weiches ö)
Stöck bedeutet generell „Stück,“ ist also Teil eines Ganzen, e Stöck Papier beispielsweise oder e Stöck Kooche (Kuchen). Es gibt aber auch weitere Anwendungen. In der Landwirtschaft spricht man vom Jromperestöck oder vom Koorstöck und meint damit das Kartoffel- und das Kornfeld. Ein Acker allgemein wurde oft einfach Stöck genannt. Das Stöck war nicht zuletzt zu unserer Kinderzeit ein gängiges Wort für das Butterbrot: Mam, ech han Honger, kann ech e Stöck han bettelten wir bei Mutter, die uns dann en Schnedd Bruët (eine Brotschnitte) dick mit guter Butter bestrich und mit Zucker als Belag bestreute. Die Zuckerschnedd war eine echte Leckerei für uns. Ein Stöckelche war und ist eigentlich ein kleines Stückchen, bezeichnet aber auch eine lustige Geschichte, eine Anekdote oder ein Verzällche (kleine Erzählung). Bekannt sind beispielsweise die in 1959 erschienenen Eefeler Stöckelcher (Eifeler Anekdötchen) aus der Feder des Heimat- und Mundartforschers Fritz Koenn aus Hellenthal. In vielen Ortschaften gab es in alter Zeit Ereignisse, über die man immer wieder sprach und die mit der Zeit zum dorfspezifischen Stöckelche wurden. Vieles wurde naturgemäß hinzu gedichtet, irgendwo liegt aber immer ein Körnchen Wahrheit nach dem Grundsatz unserer Eltern: Van nix kött nix (von nichts kommt nichts).
Stombs Wellem
Stombs Wellem war ein Blankenheimerdorfer Original, das Seinesgleichen suchte. Er war Wanderschuster und lebte vor mehr als 100 Jahren (um 1900), ob seiner Erzählkunst und lustigen Streiche war er allenthalben beliebt. Auf seinen Wanderungen kam er durch die halbe Eifel, wo er auftauchte, da kursierte in Windeseile die Nachricht durchs Dorf: Stombs Wellem os do, höck Oovend kreje mir jät ze laache (…heute Abend wird es lustig). Bis tief in die Nacht saß man dann mit Wellem in der Kneipe beisammen und lauschte seinen Verzällcher (Geschichten). Um Stombs Wellem rankt sich manches Anekdötchen. Einmal befreite er Jannespitter (Johann Peter) von Zahnschmerzen, auf seine Art: Der kranke Zahn wurde mit einem Peichdroht (Pechdraht = Schustergarn) ans Tischbein gebunden, Wellem stach den Patienten unvermittelt mit der spitzen Süül (Schusterahle) ins Hinterteil, Jannespitter machte einen erschrockenen Satz – und der Zahn baumelte am Pechdraht. Dunnerkiel, soll Jannespitter gesagt haben, dä Zannt hat äwwer deef Wuëzele (…der Zahn hatte aber tiefe Wurzeln). Ein anderes Mal war Stombs Wellem der Anlass dafür, dass in Blankenheimerdorf Pfingsten auf Ostern fiel (siehe: Pengste). Auf ihn geht auch die heute noch übliche Behauptung zurück, dass es in Blankenheimerdorf alljährlich auf Pengs-Daach (Pfingsten-Tag) schneit. Die Behauptung stimmt. Pengste bedeutet Pfingsten, Daach heißt sowohl „Tag“ als auch „Dach.“ Das Haus der Familie Pfingsten gibt es noch heute im Ort und auf dessen Dach schneit es mit Sicherheit in jedem Jahr. Stombs Wellem hieß mit bürgerlichem Namen Wilhelm Pfingsten.
Stöpp (weiches ö)
Wenn ich früher daheim wieder einmal jät aanjestallt (etwas angestellt = kindliches Vergehen) hatte, kam von Mam die Ankündigung: Waat nur, bos Pap denoovend hejm kött, dann stöpp et (Warte nur, bis Vater heute Abend heim kommt, dann staubt es). Stöpp ist Staub und stöppe bedeutet folglich „stauben.“ Sech üß dem Stöpp maache ist ein gängiger Begriff für „abhauen, stiften gehen, verdünnisieren.“ Et os esu drüch dat et stöpp klagt gelegentlich der Kleingärtner nach einer längeren Trockenperiode. Verschnörkelte Möbelteile und Spinnennetze sind die reinsten Stöppfänger, die Hausfrau rückt mit Stöppdooch und Stöppbeißem (Staubtuch und Staubbesen) gegen sie an. En Stöppwolek (Staubwolke) zieht das Auto beim Befahren eines unbefestigten Weges hinter sich her, und mit dem Stöpp-Pinsel (Staubpinsel) werden die stöppich Boocher (staubige Bücher) aus dem Regal gereinigt. In manchen Fällen hält sich der Eifeler auch an das Standardwort „Staub,“ beim „Staubsauger“ beispielsweise oder bei der „Staublunge,“ einen Stöppsauger oder eine Stöpplong kennt unser Dialekt nicht. Wenn beim Flegeldreschen auf der Tenne der Hausherr eine Runde „Flegelwasser“ spendierte, tat er das mit den Worten: Losse mir os ens dr Stöpp eraff spöle (den Staub hinunter spülen). Affstöppe (Abstauben) ist die bekannte Umschreibung für „Gewinn machen,“ und ein weises altes Wort besagt: Ene nasse Sack stöpp net (Ein nasser Sack staubt nicht).
Stößkoh (weiches ö)
Das Wort bedeutet in der Übersetzung „Stoßkuh“ und bezeichnet eine stoßwütige Kuh. Stösse ist Dörfer Dialekt und bedeutet „stoßen,“ wir daheim in Nonnenbach sagten stüsse, regional heißt es in manchen Eifelortschaften stuësse. Besonders nach der Geburt eines Kälbchens wurden und werden sonst friedliche Kühe stösswödich, weil sie ihren Nachwuchs gegen alles Fremde verteidigen wollen. Die Mutterkuh nahm nicht selten den vermeintlichen „Feind“ im Sinne des Wortes „auf die Hörner“ und das konnte schlimme, vereinzelt sogar tödliche Folgen haben. Oft war aber auch die Aggressivität angeboren und nicht zu kurieren, eine solche Stößkoh bedeutete eine ständige Gefahr beispielsweise für den Hütebuben, das Tier musste in der Regel geschlachtet werden. Aus meiner Hütebubenzeit ist mir noch eine Stößkoh aus dem Nachbarhaus in Erinnerung, das Tier attackierte bevorzugt uns Kinder. Aus Erzählungen von Gottfried Jentges (Karels Fried) ist mir bekannt, dass es im Krieg im Ortsteil Kippelberg in Blankenheimerdorf eine bösartige Stößkoh gab, die beim Weidetrieb die Personen auf der Straße angriff und vor der die Kinder Reißaus nahmen. Am 17. September 1944 wurde sie, wie auch unsere Schwitt, von der Wehrmacht als „Heeresvieh“ beschlagnahmt (siehe: Schwitt), die Leute auf dem Kippelberg atmeten auf. Zwei Tage später war sie wieder da und mit ihr kam die Furcht vor der Stößkoh zurück. Wie auch unsere Schwitt, so war das Tier den Treibern ausgerissen und hatte nach zwei Tagen heim gefunden. Stößköh gibt es auch heute noch, die „Enthornung“ beschert den Tieren zwar ein ziemlich unnatürliches Aussehen, sie vermindert unterdessen aber auch die Verletzungsgefahr ganz erheblich.
Strau
Der Düngerhaufen vor dem Haus war früher ein Maßstab für die wirtschaftliche Situation des Besitzers: „Viel Mist vor der Haustür“ bedeutete „viel Vieh im Stall,“ und das war ein Zeichen von Wohlstand. Für die Düngerproduktion war Stroh als Stallstreu erforderlich, und dieser Vorrat war manchmal aufgebraucht, bevor neu geerntet werden konnte. Dann hieß es für den Kleinbauern Strau maache. Die Strau war ein Strohersatz in Gestalt von Heidekraut und wurde deshalb auch in weiten Teilen der Eifel Hejd oder Heed (Heide) genannt. Bei uns daheim gab es im Waldbereich Brandheck eine größere Heidekrautfläche, wo Ohm Mattes gelegentlich unseren Bedarf an Strau beschaffte. Das Heidekraut wurde nicht einfach abgemäht, sondern zum Großteil mit der Grasnarbe in ganzen Soden vom Boden gelöst. Das Werkzeug hierfür war die spezielle Strausänzel (Sense) mit robustem, etwa 40 Zentimeter langem Blatt und besonders stabilem Wurf (Sensenstiel). Die Sensenschneide war derart grob geschliffen, dass sie auch mit Erde und Holzteilen „fertig wurde“ ohne stumpf zu werden. Gras konnte man unterdessen mit einer Strau- oder Hejdsänzel nicht mähen. Eine Wagenladung Strau daheim vor dem Haus war für uns Kinder ein beliebter Tummelplatz Dass es darin vor Kleingetier nur so wimmelte, spielte keine Rolle. Neben Käfern und Spinnen gab es vor allem Heckeböck (Zecken), die uns hundertmal bissen, uns aber niemals krank machten. Einmal fanden wir sogar eine junge Blindschleiche, die wir in die Gartenhecke setzten.
Streukooche
Streuselkuchen mit Kirschen, Pudding oder Sahne, – wer leckt sich nicht die Finger nach derartigen Gaumenfreuden! Heute beim Bäcker oder in jedem Supermarkt erhältlich, war zu unserer Kinderzeit Streukooche eine seltene Köstlichkeit, die es im Eifelhaus nur zur Kirmes oder an besonderen Feiertagen gab. Der Eifeler Streukooche wies ein Charakteristikum auf, das ihm damals „zu Rang und Namen“ verhalf, das sich aber heutzutage eher nachteilig auswirken dürfte: Die trockene Teigschicht war mindestens dreimal so dick wie der süße Belag, den es nur in Gestalt von Jrömmele (Krümel) gab, Zutaten wie Kirschen oder Pudding kannte man bei uns nicht. Der „Hausback“ etwa vor der Kirmes war für uns Kinder ein besonderer Tag. Da nämlich wurde, neben dem üblichen Brotvorrat für zwei Wochen, auch Taat (Fladen), Streukooche und weiteres süßes Gebäck hergestellt, und hier fiel für uns Pänz immer eine kleine Schleckerei ab, ein paar Jrömmele beispielsweise, ein Rest vom süßen Kuchenteig oder sogar die eine oder andere Rosine, – winzige Kleinigkeiten, aber kostbar in jener armen Zeit und heiß begehrt. Am Backtag duftete das ganze Haus köstlich nach frischem Brot und Gebäck, wir fieberten geradezu dem Moment entgegen, wenn der noch fast warme Streukooche angeschnitten und eine erste Kostprobe gereicht wurde. Es gab damals eine etwas geringschätzige Redewendung der Erwachsenen, wenn einer von uns Kindern vorlaut war: Hät hie ejner Streukooche jerofe, dat du Jrömmel dech melds. Als Jrömmel hatte man sich eben „gebückt zu halten.“
Strombännel (weiches o)
Das Wort müsste eigentlich „Strompbännel“ heißen, weil es „Strumpfband, Strumpfhalter“ bedeutet, Strombännel ist aber leichter auszusprechen. Der Bännel ist allgemein ein Bändel, ein Band oder Bindeseil wie beispielsweise der Strühbännel (Strohbändel) zum Binden der Getreidegarben. Ein Stromp ist ein Strumpf, die Mehrzahl lautet Strömp, in Blankenheimerdorf war auch der Ausdruck Hosse (weiches s) üblich und analog dazu Hossebännel. Als Kinder trugen auch wir Jungen lange Strümpfe, die mit schwarz-grauem Gummiband am Lievje (Leibchen) befestigt waren. Gelegentlich zerriss bei Spielen und Raufen der Strombännel oder der Knopf am Strumpf riß ab. Dann rutschte der Strumpf auf den Fuß hinab und man lief heim: Mam, dr Strombännel oß affjerosse (…ist abgerissen). Das allein war schon schlimm genug, wenn obendrein auch noch der abgerissene Knopf verloren gegangen war, - oha! Den Strombännelsjummi kaufte man in Metern beim Stotzemer, einem nach seinem Heimatort Stotzheim so benannten Hausierer, der regelmäßig bei uns erschien. Gekauften lang Strömp kratzten stets jämmerlich auf der Haut und waren unbeliebt, die von Mam Selbstgestrickten waren sehr viel angenehmer. Obwohl wir kurze Hosen trugen, blieben die Hossebännele meist unsichtbar, weil die Hosenbeine trotz ihrer „Kürze“ bis knapp über die Knie reichten.
stronze (weiches o)
Es gibt Pessimisten unter uns, die das Leben ausschließlich von seiner unangenehmen Seite betrachten. Fragt man einen solchen Kunden beispielsweise, wie es ihm gehe, so hört man als Antwort: Beschesse, on dat os noch jestronz (Bescheiden, und das ist noch geprahlt). Andere Zeitgenossen stellen sich gern bei jeder Gelegenheit in den Vordergrund, prahlen mit ihren Taten und ihrem Wissen und müssen dann häufig einen Dämpfer einstecken: Ja ja, bestronz du dech selever ad jät, anders dejt suwiesu kejner et (…lobe du dich nur selber, sonst tut sowieso keiner es). Stronze ist unser Wort für „prahlen, grosstun, angeben.“ Was im Hochdeutschen der „Prahlhans,“ das ist in unserem Dialekt der Stronzböggel und das heißt wörtlich „Prahlbeutel.“ Stronz heißt bei uns „Angabe, Prahlerei,“ steht aber auch für „unnützes Zeug, wertloser Kram.“ Das Wort wird gelegentlich fälschlicherweise als „Strunz“ verhochdeutscht, im Aachener Dialekt ist „Stronks“ gebräuchlich. Von unserem unvergessenen Krämesch Pitter ist ein Anekdötchen in Erinnerung. Pitter ärgerte sich über einen Gast, der unablässig mit seinem Können prahlte: Du iewije Stronzpitter, jitt et och jät, wat du net kanns? (Du ewiger Prahlhans, gibt es auch etwas, was du nicht kannst). Darauf der Angeber: Oh joo, ech kann menge Deckel net bezahle!
ströppe
Das Wort bedeutet generell „Wild in der Schlinge fangen,“ ein höchst verwerfliches Geschäft also. Der Ströpper ist somit der „Schlingenleger.“ Es gibt die alte Schmunzelgeschichte vom Eifelbauern, den der Förster beim ströppe zu überführen trachtete. Der Bauer hatte aber den Gegner in der Gartenhecke bemerkt. Als ein Hase in der Schlinge zappelte, ging der Mann hin und zog dem Langohr ein paar Hiebe mit einer Haselrute übers Fell, dann löste er ihn aus der Schlinge und ließ in laufen: Dir weren ech helefe, mir dr Kappes ze klaue (Dir werde ich helfen, mir den Kohl zu stibitzen). Wenn wir als Hütebuben unsere Tiere auf fremder Weide grasen ließen, so war das verbotenes stroppe (nicht ströppe), der Hüter selber aber war als Ströpper abgestempelt. Ströppe bedeutet nicht zuletzt auch „die Haut abziehen,“ und hieraus ergibt sich das in unserer Eifel häufige Ströppe des auswärtigen Freiers, der seine Braut bei der Dorfjugend „loskaufen“ muß und dem somit symbolisch „das Fell über die Ohren gezogen“ wird. Der Brauch ist allgemein weit verbreitet und beliebt, er kann allerdings auch ausarten (siehe: Dier jare). Meistens geht die Angelegenheit friedlich vonstatten. Um 1960 herum war einmal ich selber an der Reihe: Auf der Mülheimer Kirmes brachten ein paar Dorfburschen angelegentlich die Rede aufs Ströppe, und als ich ihnen zwei Kasten Bitburger vorschlug, waren sie höchst zufrieden. So einfach ging das.
Ströüf
Eine treffende Übersetzung zu diesem Dialektwort will mir nicht einfallen, in Frage käme allenfalls „Streifen“ oder „Streifband,“ was aber nur zum Teil richtig ist. So ist die Ströüf beispielsweise ein Durchziehband in der Nähfalte etwa am Gardinensaum oder an diversen Kleidungsstücken. Das englische Wort „strip“ bedeutet unter anderem auch „Band“ oder „Bandmaterial“ und ist verwandt mit unserer Ströüf. Eine abgeerntete Heuwiese musste daheim beim Ohm Mattes sauber und blank aussehen, jlatt wie ene Koneraasch (glatt wie ein Kinderpopo) pflegte er zu sagen. Bei nachlässiger Arbeit insbesondere auch mit der Mähmaschine, blieb hier und da ein Grasbüschel stehen. Für Ohm Mattes waren das sündhafte Ströüfe und er konnte geradezu wild werden: Dat os doch kejn Ärbed, esujät määch mr doch net (solche Arbeit macht man doch nicht). Trotz aller Sorgfalt blieb manchmal doch ein Büschel Gras stehen und wurde nach dem Rejnscheere der Wiese (Säubern mit dem Handrechen) sichtbar. Dann wurde ich beauftragt: Do stejt noch en Ströüf, jank on rieß se üß. Notfalls ging der akkurate Ohm selber hin und rupfte die Halme aus. Heute bleiben die Winkel der Wiesen ungemäht, wo die Maschine nicht hinreicht, bleibt das Gras stehen, der Großbauer unserer Tage kennt eine Sense nur noch vom Hörensagen, – Ohm Mattes würde sich im Grab herumdrehen, könnte er solche „Wirtschaft“ sehen. Ihm waren sogar ein paar dünne Heureste als Ströüfe ein Dorn im Auge, die möglicherweise beim Rejnscheere übersehen wurden: Wir mussten sie aufsammeln und von der gemähten Fläche entfernen, denn die musste nun einmal tadellos blank sein.
Strühdaach
Zu meiner Kinderzeit vor 80 Jahren gab es daheim in unserer Nachbarschaft noch ein strohgedecktes Gebäude: Das Wohnhaus des alten Schlemmers Hofes, das Stammhaus des Weilers Schlemmershof. Meine Urgroßmutter Ursula war beispielsweise eine geborene Schlemmer aus dem alten Hof. Ein solches Strühdaach (Strohdach) ist heute eine Sehenswürdigkeit, die man im Freilichtmuseum noch bestaunen kann. Ein sauber gearbeitetes Strohdach ist außerdem eine echte Augenweide, – in Monschau-Höfen gibt es sie noch in Gestalt des originalen „Eifelhauses.“ Das Strühdaach ist im Winter von Vorteil, weil die dicke Strohschicht die Wärme „hält,“ im Sommer kühlt es deutlich, weil keine Wärme eindringt. Strohdach decken ist ein heute fast vergessenes Handwerk, unser Nachbar Peter Rütz, der Hofbesitzer, verstand noch einiges davon, ich weiß noch, dass er gelegentlich Reparaturen vorgenommen hat. Das Rütz-Dach war uralt und total von dickem Moos überwuchert, das Material war brüchig und anfällig gegen Beschädigungen. Um 1952 wurde das alte Wohnhaus abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt. Beim Strühdaach besteht naturgemäß eine enorme Brandgefahr. Am 01. August 1905 wurde Nonnenbach von einer Brandkatastrophe heimgesucht, die als „Der große Brand von Nonnenbach“ in die Geschichte einging. Damals brannten im Unterdorf vier strohgedeckte Anwesen völlig nieder. Das Feuer wurde durch Wind und starke Sommerhitze begünstigt.
Strühpopp (weiches o)
Die Strohpuppe nahm im Alltag unserer Eltern einen ziemlich breiten Raum ein. Da wurden zum Beispiel alte Kleidungsstücke mit Stroh ausgestopft und zur Vogelscheuche im Kartoffelacker umfunktioniert. Ein solcher Bookert (hartes o) erfüllte allerdings nur kurz seinen Zweck, nach zwei Nächten hatten ihn die Wildschweine umgeworfen. Strühpoppe brauchte auch der Dachdecker zum Abdichten (siehe: Schottelspann). Regional wurden die „Hüte“ der Kornkasten auf dem Getreidefeld Strühpoppe oder Strühmänn (Strohmänner) genannt. In vielen Eifelorten wird die Dorfkirmes durch eine lebensgroße Strohpuppe symbolisiert, die nach dem Fest feierlich verbrannt und „begraben“ wird. Dieser Paias, Schabeies, Lazarus oder Nubbel ist ein begehrtes „Mitnahmeobjekt“ der auswärtigen Festbesucher. In Nettersheim beispielsweise hing der Schabeies hoch über der Straße und widerstand allen unseren Versuchen des Abseilens. Wir gaben schließlich auf – und liefen einer Horde Nettersheimer Burschen in die Arme, die an der Hausecke auf unser Abseilen gelauert hatten. Das wäre um ein Haar fies ins Auge gegangen. Durch eine Strühpopp mit einer mehr oder weniger deutlichen Spottschrift, wurde früher anlässlich einer Hielich (Polterabend) oder Hochzeit der verschmähte vorherige Liebhaber verhöhnt, sofern es einen solchen gab (oder auch die Liebhaberin). Den Brauch gab es früher auch bei und in Blankenheimerdorf, die Strühpopp mit einem entsprechenden Schild um den Hals, hing meistens sonntags morgens unter der Riesenkastanie am Denkmalplatz und wurde von den Kirchgängern gebührend bestaunt. Den Brauch gibt es längst nicht mehr, man würde auch postwendend vor dem Kadi landen.
Suëre Kappes
Suër heißt „sauer“ und Kappes ist „Kohl,“ Suëre Kappes ist somit Sauerkohl oder Sauerkraut, das uns Deutschen bei den Amis den Spitznamen „Krauts“ eintrug. Sauerkraut war und ist eins unserer Hauptgerichte, unsere Eltern stellten den Jahresbedarf an Suëre Kappes selber her. Die Höüter (Köpfe) vom wieße Kappes (Weißkohl) wurden mit der Schaav (Krauthobel) zerkleinert, mit Salz und Wacholderbeeren gewürzt und lagenweise in ein dem Bedarf entsprechend bemessenes Stejndöppe (Steintopf, Keramikgefäß) gefüllt. Unser Kappesdöppe daheim fasste 50 Liter. Die einzelnen Lagen wurden mit einem Holzstampfer möglichst fest zusammengepresst, so dass sich zum Schluss eine zentimeterdicke Saftschicht bildete, die den Topf luftdicht verschloss. Das war erforderlich, um eine Fäulnisbildung zu unterbinden. Damit die gestampfte Masse sich nicht lockerte und die Flüssigkeit wieder aufnahm, wurde sie mit einem Tuch und einem passenden Brett abgedeckt und mit einem gewichtigen Stein beschwert. Sauerkraut ist eine gesunde und schmackhafte Kost, bei uns daheim kam wenigstens einmal in der Woche Suëre Kappes önnerenanner (untereinander = mit gestampften Kartoffeln) auf den Tisch. Besonders begehrt dazu waren gekochte Schweineohren oder Schweinefüße, die aber gab es nur selten: Bei uns wurde nur einmal im Jahr ein Schwein geschlachtet.
Süül
Wieder ein Dialektwort mit mehrfacher Bedeutung. Die Süül ist in erster Linie die hochdeutsche „Säule,“ die schon Ludwig Uhland in „des Sängers Fluch“ beschrieb: „Noch eine hohe Säule zeugt von verschwundner Pracht, auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.“ Wenn aber der Eifeler von der Süül spricht, so ist in aller Regel damit ein spitzes dünnes Werkzeug gemeint: Die Ahle, und ganz besonders die Schusterahle. Analog zur äußeren Form der Ahle, kennen wir ein geflügeltes Wort: Spotz wie en Süül (Spitz wie eine Ahle), und damit bezeichnen wir die Charaktereigenschaft gewisser Zeitgenossen, Männlein wie Weiblein. Ich habe früher gelegentlich unserem Nachbarn Schuster-Köbes (Schuster-Jakob) zugeschaut, wenn er mit flinken Händen mit der Süül die Löcher für die Penncher (weiches e, kleine Holznägel) in die Schuhsohlen bohrte, eine mühsame Handarbeit. Die Süül ist auch heute noch in vielen Handwerksberufen unentbehrlich, beispielsweise zum akkuraten Markieren von Bohrpunkten. In Blankenheimerdorf gibt es ein Anekdötchen von Stombs Wellem, der um 1900 lebte, Schuster war und Wilhelm Pfingsten hieß. Zu ihm kam Jannespitter (Johannpeter), von fürchterlichen Zahnschmerzen geplagt. Wellem band einen Peichdroht (Schuster-Nähfaden) an den kranken Zahn und ans Tischbein seiner Werkbank, dann stach er unversehens mit der spitzen Süül in die hinteren Weichteile seines Besuchers. Jannespitter tat einen entsetzten Luftsprung, der Zahn baumelte am Peichdroht und der „Patient“ stellte zufrieden fest: Dunnerkiel, dä Zannt hat äwwer en deef Wuëzel (Donnerwetter, der Zahn hatte aber eine tiefe Wurzel).
nach oben
zurück zur Übersicht
|