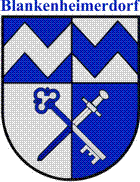|
Pääps
Ein zu unserer Kinderzeit gängiges Wort für ein spezielles, besonders schmackhaftes Stück Fleisch aus der Schweineschulter zum Kochen oder Schmoren. In der Regel war der gesamte Vorderschinken in den Begriff einbezogen. Der Hausschlachter schnitt die Pääps sorgfältig entsprechend dem Kundenwunsch zurecht. Ich kann mich noch erinnern, dass Baalesse Thuëres (Theodor Baales, unser Hausschlachter) bei uns eine der beiden Schweineschultern zerlegte und teilweise die Knochen herausschnitt. Diese zerlegte Pääps war für unseren Hausbedarf bestimmt, die besten Stücke wurden an Festtagen geschmort. Die Knochen wurden für die Suppe gebraucht und so oft gekocht, bis sie kein Gramm „Saft“ mehr hergaben und kein Fisselchen Fleisch mehr dran war. Das relativ weiche schaufelförmige Schulterblatt wurde mit dem Hammer auf dem Trittstein an der Haustür zerklopft und diente als Tierfutter, so seltsam das auch scheint: Unsere Hühner rissen uns die Knochenteile buchstäblich aus der Kinderhand. Die zweite Pääps blieb weitgehend unzerlegt, nur das Eisbein wurde abgetrennt. Der restliche Teil wurde an einem Stück im Holzbottich eingesalzen. Alljährlich zum Brijittefess (Namensfest der heiligen Brigida am 01. Februar) Kam Tant Marie aus Köln zu Besuch und holte sich „ihre“ Pääps von der letzten Hausschlachtung ab. Eine Pääps diente oft auch als beliebtes Geschenk und Zeichen der Achtung bei besonderen Anlässen.
päächte
Was in weiten Teilen der Eifel mit „paachte“ bezeichnet wird, das heißt bei uns in Blankenheimerdorf päächte und bedeutet „pachten.“ Analog dazu ist der „Pächter“ bei uns der Päächter, und in dieser Sparte nimmt der Jaachpäächter (Jagdpächter) eine ganz besondere Position ein: Er zeigt sich in aller Regel dem dörflichen Vereinsleben wohlgesonnen und spendabel bei innerörtlichen Veranstaltungen. Logischerweise müsste nun die „Pacht“ eigentlich in unserem Dialekt zur Pääch werden, doch ist das nur ganz selten der Fall, vielmehr hat sich hier die Paach in den Vordergrund geschoben. Früher trugen die Gewannwege zwischen den Flurparzellen in vielen Fällen schweres Gras, das die Kleinlandwirte für ein paar Groschen von der Gemeinde zum Beweiden oder auch zum Heumachen päächte konnten. Heute befahren schwere Landmaschinen die Wege, und wo die fahren, da wächst im Sinne des Wortes „kein Gras mehr.“ Früher wurden auch die wenigen Plätze auf der Orgelbühne in unserer Kirche verpääch (verpachtet), eine meist den Dorfhonoratioren vorbehaltene Angelegenheit. Von einem „Dauerkunden“ im Wirtshaus wird hinter der Hand behauptet, dass er de Kneip jepääch hat. Und wenn im Wartezimmer ein Kunde ungewöhnlich lange die frische Tageszeitung studiert, wird er gelegentlich vom Nachbarn ärgerlich angeknurrt: Loss mech och ens en die Zejdong kicke, oder häßte die jepääch?
Packaan
Wenn man aus einem Zeitwort ein Hauptwort macht, so spricht man von einer „Substantivierung,“ Beispiele: sägen / Säge, liegen / Liege, bleiben / Bleibe. Die Packaan ist so ein „substantiviertes Verb,“ hergeleitet von aanpacke (anpacken, anfassen). Die Packaan ist somit eine „Anpacke,“ eine Einrichtung zum Anfassen, also schlicht und einfach ein Griff oder Handgriff an Gegenständen. Eine geradezu klassische Packaan benötigten früher die Leute beim Bügeln der Wäsche: Einen Holzgriff für das auf dem Herd erhitzte massive Bügeleisen, an dessen Metall man sich sonst die Finger verbrannte. Die Packaan war zweiteilig und dem etwas gebogenen Eisengriff des Gerätes angepasst. Ebenso klassisch war die Packaan zum Transportieren gewichtiger Pakete: Ein handgerecht gebogener starker Draht mit einer fingerdicken Holzrolle als Griff. Als die Plastiktüte noch unbekannt war, transportierte man das Eingekaufte im gut verschnürten Karton nach Hause, die Kaufhäuser hielten hierfür die mit dem Firmennamen versehenen Tragegriffe gratis zur Verfügung. Die Packaan ließ sich leicht in die Paketverschnürung einhängen und konnte immer wieder verwendet werden. Bei uns daheim lagen stets mehrere Packaane im Wandschaaf (Wandschrank) herum. Von einem hilfsbereiten starken Mann wurde gern behauptet: Dat os ene jode Packaan, was soviel wie „eine gute Hilfskraft“ bedeutete. Und von einem unbrauchbaren Gegenstand sagt man: Do fählt nur noch de Packaan für et fottzeschmieße (Da fehlt nu noch der Griff zum Wegschmeißen),
Päëd
Das Pferd. Im Gegensatz zum Kölner Dialekt „Pääd“ wird bei uns das Wort mit einer deutlichen Trennung der beiden Vokale gesprochen: Pä-ed, die Mehrzahl lautet Päëder. Pferde als Zugtiere ersetzten früher den Traktor überall dort, wo schwere Lasten zu transportieren waren. Noch gut in Erinnerung ist das Päëdsjespann von Josef Berlingen oder auch die schweren Zugpferde des Sägewerks Milz in Blankenheim-Wald. Die Langholzfahrzeuge der Melzemänn (Milzmänner = Mitarbeiter des Sägewerks) waren je nach Ladung mit vier Pferden bespannt und gehörten zum Alltag auf unseren Straßen und Waldwegen. Als im September 1939 die Westfront-Einquartierung kam, brachten die bespannten Einheiten eine Menge Pferde in unsere Dörfer mit. Die Soldatepäëder waren in der Regel gut genährt und wohlgepflegt, in unserer Scheune daheim waren ihrer drei untergestellt. Ihr Pfleger hieß Paul Fassbender und war aus Köln. Eins seiner Pferde hieß Ella, auf Ellas Rücken ließ Fassbender-Paul mich fast Fünfjährigen häufig reiten. Da saß ich dann im Sinne des Wortes stolz wie Oskar om huhe Päëd (auf dem hohen Pferd). Das ganze Jahr hindurch sparten wir Pänz unsere spärlichen Groschen und Pfennige zusammen für ein paar Fahrten mit dem Päëdcheskarressell (Pferdekarussell) auf der Kirmes in Blankenheim.
Päëdsdeck
Die Pferdedecke zählt generell zum Reitzubehör und ist ein Ganzkörperschutz für das Tier. Was bei uns dagegen mit Päëdsdeck bezeichnet wird, ist die braune oder graue Armeedecke, wie sie im Krieg beim Heer verwendet wurde und wie sie auch bei der Bundeswehr üblich ist. Die Soldaten unserer „Einquartierung“ (1939/40) besaßen solche Decken, die sie oft als Sattelunterlagen benutzten und die für uns also Päëds- oder Soldatedecke waren. Das Material war strapazierfähig und irgendwie glatt, eine Päëdsdeck diente bei uns daheim als Büjeldeck (Unterlage beim Bügeln). In der mageren Nachkriegszeit wurden gelegentlich die Hosen für uns Jungen aus einer Päëdsdeck geschneidert. Die sahen zwar nicht besonders schön aus, waren dafür aber warm und dauerhaft. Wegen der Strapazierfähigkeit wurden aus Pferdedecken auch Schrupplompe (Putztücher, Aufnehmer) gefertigt. Die frühere Eifeler Stalltür war zweiteilig und besaß breite Ritzen und Fugen, im Winter wurde sie zusätzlich mit einer alten Päëdsdeck abgedichtet. Dasselbe galt für die dicht über dem Boden liegenden Kellerfenster. Ein anderes Wort für Päëdsdeck ist bei uns Schaaz, was allerdings nicht ganz zutreffend ist. Die Schaaz nämlich ist eigentlich eine dicke und flauschige Wolldecke oder auch ein Umhängetuch.
Päëdsköttel (weiches ö)
Kleine, feste und geformte Teile von Tierkot nennt der Volksmund Köttele (siehe auch Hohnerköttel). Ross- oder Pferdeäpfel sind ebenfalls Köttele, weil sie relativ kleine Teile eines großen Ganzen sind. Im Vergleich zu Kanengs- oder gar Müüsköttele (Kaninchen- / Mäusekot) ist der stattliche Pferdeapfel geradezu ein Musterstück, analog dazu nennen wir den besonders auffällig gekleideten Mitmenschen etwas gehässig Prachtköttel. Pferdemist ist bekanntlich bei den Spatzen beliebt; wenn ich missmutig in meinem Mittagessen herumstocherte, meckerte Jött: Du pecks en dengem Teller eröm wie en Mösch em Päëdsköttel (Du pickst in deinem Teller herum wie ein Spatz im Pferdeapfel). Direkt vor meinem Stellwerksfenster deponierte seinerzeit das Ross des Prominentensöhnchens einen stattlichen Haufen Äpfel auf den samstäglich frisch gekehrten Bahnhofsweg. Meiner erbosten Frage, wer denn nun die Sauerei beseitigen würde, begegnete das Reiterlein ungemein herablassend: „Sie wissen wohl nicht, wer ich bin!“ und trabte hocherhobenen Hauptes vondannen. Zur Vermeidung unnötigen Ärgers beseitigte ich mit Schöpp on Beißem (Schaufel und Besen) die Päëdsköttele und tat sie in die Mülltonne. Das war in den 1970er Jahren, heute würde ich es auf den Ärger ankommen lassen.
Päedskur
Der landläufige Ausdruck für eine Heilmethode unter Anwendung radikaler, zumindest ungewöhnlicher Mittel, die eigentlich der Tiermedizin und hier speziell dem Pferd vorbehalten werden sollte. Die Päedskur wird etwas vornehmer auch als „Rosskur“ bezeichnet, ist eine Radikalkur und damit nicht jedermanns Sache. Die Volksmedizin kannte früher eine ganze Anzahl solcher brachialer Hausmittel, die aber nicht selten auf wirksamen Erkenntnissen und Erfahrungen beruhten. Eine der bekanntesten Päedskuren ist wohl die „Brennesselpackung“ bei Gicht- und Rheumabeschwerden, die aber längst nicht so brutal ist wie ihr Ruf: Man behandelt ja nur die schmerzende Stelle und muss sich keineswegs mit nacktem Körper in die Nesseln legen. Unsere Eltern hielten auch den rheumageplagten Arm ins Ameisennest und ließen sich die Haut „bearbeiten.“ Eine Päedskur war früher die „Behandlung“ von Furunkeln und Geschwüren mit schwazz Sejf (schwarze Seife = Schmierseife), ich selber habe als Kind diese Prozedur mehrfach über mich ergehen lassen müssen. Sie war äußerst schmerzhaft, aber ebenso wirksam und erfolgreich. Als kleine Päedskur ist nicht zuletzt das sofortige Andrücken einer entstehenden Blutblase gegen kaltes Metall: Das schmerzt für en de Botz ze pisse, dauert aber nur Minuten und es gibt keine lästige Blase. Und noch eine Radikalkur: An den Folgen einer harten Kirmesnacht leidend, war mir sterbenselend. Mein Freund und Nachbar Hein Klaßen nötigte mir an der Theke einen mir unbekannten harten Drink auf: Dä, schluck dat, entweder du bos wier om Damm oder du jehs kapott. Ich ging nicht kapott, zehn Minuten später war ich wieder fit.
Paias
Der Begriff stammt angeblich aus der Franzosenzeit und steht für eine Strohpuppe, ganz allgemein für eine Witz- oder Spottfigur. Mit einem Paias wurde früher bei uns im Dorf anlässlich einer Hielich oder Hochzeit der „Verflossene“ der Braut verspottet, oder auch umgekehrt die verschmähte frühere Geliebte. Der Paias mit einer erläuternden Texttafel wurde nachts am Haus des oder der Verflossenen aufgehängt, nicht selten auch unter der Riesenkastanie am Denkmalplatz, wo er den morgendlichen Kirchgängern sofort ins Auge fiel und begutachtet wurde. En Pop ophange (Eine Puppe aufhängen) nannten wir diesen Brauch, der seit Jahrzehnten wegen möglicher Folgen nicht mehr ausgeübt wird. In vielen Eifeldörfern ist der Paias auch, neben der Knauch (Knochen), Sinnbild der örtlichen Kirmes und begleitet das Fest vom „Ausgraben“ bis zur „Beerdigung,“ in deren Verlauf er meist verbrannt wird. Die Puppe trägt auch örtlich verschiedene Namen, Zacheies beispielsweise, Kirmespitter oder wie in Nettersheim, Schabeies. Den Nettersheimer Schabeies, am damaligen Cafe Schruff hoch über der Straße an einem Drahtseil aufgehängt, gedachten einmal eine Handvoll „Blangemerdörfer“ Kirmesbesucher mit auf die Heimreise zu nehmen, scheiterten aber am glatten Stamm der Linde, an dem das Seil befestigt war. Schließlich gaben sie auf - und liefen an der Hausecke einer Horde Nettersheimer in die Arme, die da auf das Abseilen gelauert hatten. Da es dazu aber nicht gekommen war, kam es auch nicht zu der angedachten Tracht Prügel für die verhinderten Schabeiesdiebe, die mit der Gewissheit heimwärts zogen: Jung, do han mir äwwer noch ens Schwein jehatt.
nach oben
zurück zur Übersicht
Palemsonnech
Unser früheres Wort für den Palmsonntag, den Beginn der Karwoche. Heute sagen wir überwiegend Palemsonndaach oder auch einfach Palemdaach (Palmtag). Das Besondere an diesem Tag war die Segnung der Palemstrüüß (Palmsträuße) zu Beginn des morgendlichen Gottesdienstes. Die Leute brachten ihre Palmsträuße mit zur Kirche, bei uns daheim wurde einem von uns Kindern der Struuß in die Hand gedrückt. In jedem Haushalt war ein gesegneter Palemstruuß zu finden, der mangels echter Palmen bei uns aus frischen Buchsbaumzweigen und Weidenkätzchen bestand. Palmzweige wurden ans Familienkreuz in der Stube gesteckt, ans Weihwassertöpfchen neben der Haustür und an den Firstbalken auf dem Dachspeicher: Schutz vor Blitz und Unglück. Paleme wurden auch in den Garten- und Ackerboden gesteckt zum Schutz vor Hagel und Unwetter. Oft wurden auch Palmzweige beim Gewitter im Herdfeuer verbrannt, was heute mangels Kohleherd nur noch selten möglich wäre. Bei uns daheim allerdings durfte beim Gewitter nicht „gestocht“ werden, weil dr Qualem dr Bletz aanzüch (der Rauch den Blitz anzieht). Nach der Palmweihe in der Kirche, zogen wir Messdiener mit dem Pfarrer durchs Hauptportal in die Kirche ein: Sinnbild für den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem.
Pangsiuën
Die Pension, wie zahlreiche andere Begriffe in unserer Sprache ein Relikt aus der Franzosenzeit mit mehrfacher Bedeutung. So kann unter anderem mit Pangsiuën eine Einrichtung bezeichnet werden, die Fremdenzimmer vermietet: Dat Jret hät en Pangsiuën opjemääch (Gretchen hat eine Pension eröffnet), und was man dort für Koss on Loschie (für Kost und Logis) zu zahlen hat, heißt ebenfalls Pangsiuën. Nicht zuletzt kommt der Pension unterdessen Bedeutung als Altersversorgung der Beamten zu. Allerdings nicht unbedingt immer. In Gitte Haennings Erfolgshit aus dem Jahr 1963 beispielsweise rät die Mutter: „Nimm gleich den von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn…und denk doch mal an die schöne Pension bei der Bundesbahn.“ Die heiratswillige Tochter lehnt indessen dankend ab: „Ich will `nen Cowboy als Mann.“ Als Beamtenanwärter bei der DB „verdiente“ ich monatlich 150 DM Unterhaltszuschuss und der Hilfsarbeiter vom Bau meinte an der Theke gönnerhaft zum Wirt: Dohn dem ärme Iesebähner hie och e Bier. Jahrzehnte später wurde er arbeitslos, nahm dankend mein Spenderbier entgegen und meint sogar heute noch: Hätt ech deng Pangsiuën! Auch Tiere gab man in Pangsiuën, im Jahr 1924 beispielsweise standen auf dem Gut Altenburg 100 Rinder vom Frühjahr bis Herbst in Pension, wie uns durch Frau Anna Rohen-Hoppermanns überliefert ist. Ihr Vater Andreas Rohen war Gutspächter auf Altenburg.
Pann
Unser unvergessener, im Juli 2010 leider verstorbener Gastwirt Erwin Schmitz richtete gern eine Rätselfrage an seine Gäste: Et hängk aan dr Wand on hät dr Aasch verbrannt (Es hängt an der Wand und hat den Popo verbrannt), und wer die Antwort nicht wusste, dem gab der Wirt sie selber: De Pann (Die Pfanne). Im Gegensatz zu ihren modernen, mit allen möglichen Beschichtungen ausgestatteten Schwestern von heute, besaß die echte Eifeler Brootpann (Bratpfanne) tatsächlich ein schwarz verbranntes und verrußtes „Hinterteil,“ stand sie doch beim Gebrauch direkt in der Flamme des Herdfeuers. Die kreisförmige Öffnung in der Herdplatte konnte durch Einsatzringe dem Pfannenboden angepasst werden. Die mächtige Eifeler Herdpfanne bestand aus Gusseisen, besaß ein stattliches Gewicht und eignete sich, beidhändig am langen Stiel geschwungen, hervorragend als Verteidigungswaffe. KO-Schläge waren in solchen Fällen keine Seltenheit, aus jener Zeit stammt noch das Wort Dä hät ene Hau mot dr Pann (Der ist nicht ganz gescheit). Daachpanne sind Dachziegel, und wenn jemand net all Panne om Daach (nicht alle Pfannen auf dem Dach) hat, dann ist das gleichbedeutend mit Dä hätt se net all (Der hat sie nicht alle). Ech han ejne op dr Pann war eine übliche Umschreibung für das Bedürfnis, geräusch- und meist geruchsträchtig Bauchluft abzulassen.
Pannekooche
Der Pfann- oder Pfannekuchen ist bekanntlich ein leckerer Fladen aus Mehl, Eiern und kräftigen Zutaten je nach Geschmack des Herstellers. Mit Zucker bestreut, schmeckt der Pannekooche ohne jede weitere Zutat, ganz delikat wird er aber erst durch die Beigabe von frischen Früchten, Sauerkirschen etwa aus dem eigenen Garten, oder Johannisbeeren. Ungewöhnlich lecker und dazu noch ungewöhnlich gesund sind Waldbeer-Pfannkuchen. Die gab es früher daheim immer, wenn wir frische Waldbeeren gesammelt hatten, auf Walebere-Kööjelcher (Waldbeer-Pfannkuchen) waren wir geradezu versessen. In unserem ersten Volksschul-Lesebuch gab es die Geschichte „vom dicken fetten Pfannekuchen,“ der einer reichen Bäuerin aus der Pfanne sprang, durch die Welt rollte, den Reichen immer wieder ausriss und sich schließlich von einem armen Kind verzehren ließ. In Nonnenbach gab es zu meiner Kinderzeit eine besondere Pannekooche-Spezialität: Aus Buchweizenmehl hergestellte kleine Pfannkuchen, als Hejnschkooche (Hejnsch = Buchweizen) über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Hejnschkooche mot Röbekrutt (Rübenkraut, Sirup), danach leckten wir uns die Finger. Dass man aus schlechtem Material nichts Gescheites fabrizieren kann, geht aus einer alten Redensart hervor: Düwels Mäel jitt Düwels Pannekooche (Teufels Mehl ergibt Teufels Pfannkuchen). Und ein Mensch mit breitem und flachem Gesicht hät e Jesiëch wie ene Pannekooche.
Pannhas
Die hochdeutsche Übersetzung wäre „Pfannenhase,“ was unterdessen keinen Sinn ergibt. Pannhas ist nicht nur in der Eifel das Dialektwort für ein einfaches, aber wohlschmeckendes Gericht aus Wurstbrühe, Buchweizenmehl, Speck und Gewürzen. In Roetgen (Städteregion Aachen) gab es seinerzeit an der Ortsdurchfahrt ein kleines Speiselokal mit eigener Schlachterei. Hier gab es unter anderem Pannhas mit Bratkartoffeln, - einfach und billig, aber köstlich. Die graue oder rötliche Pannhasbrööt (Brühe) wird nach dem Erkalten fest und kann dann in Scheiben geschnitten und gebraten werden. Unser Pannhas daheim wurde anstelle von Wuëschbrööt (Wurstbrühe), aus frischem Schweineblut und Hejnschmäël (Buchweizenmehl) hergestellt und möglichst bald in der Pfanne gebraten. Das ergab einen schwarzen Schmarren, ziemlich unansehnlich zwar, aber ungemein lecker, selbst wir Kinder leckten uns die Finger danach. Diesen Genuss gab es nur anlässlich der Hausschlachtung, solange das Schweineblut noch frisch war. Das Gleiche galt übrigens auch für de Hiere (Gehirn) des Schlachttieres, das ebenfalls scharf gewürzt und gebraten wurde. Mancheiner mag hier die Nase rümpfen, wer unterdessen Weinbergschnecken oder Muscheln verzehrt, der sollte auch mal Schweinehirn kosten.
Panz
Das Wort besitzt einen etwas „unedlen“ Beigeschmack, es ist generell die abfällige und geringschätzige Bezeichnung für einen unnatürlich umfangreichen Bauch. Panz ist hergeleitet von „Pansen,“ dem hochdeutschen Wort für den größten Magen der Wiederkäuer. Der deutlich gerundete Bauch seiner Weidetiere verriet früher dem Hütebuben, dass es Zeit für den Heimtrieb war: Die Köh han sech dr Panz voll jefreiße, und selbst heute noch behauptet man hinter der Hand gehässig von einem wohlbeleibten Menschen: Dä hät sech ene richtije Panz aanjefreiße. Artverwandte Ausdrücke sind Balech (Balg) und Wampes (Wanst). Regional, beispielsweise in Marmagen, wird aus unserem Dörfer Panz der für uns seltsam anmutende Panks, Pangs oder Panx, in Marmagen war früher auch zur Kirmes Danx bejm Kranx (Tanz beim Kranz, Kranz hieß eine Gaststätte). Panz war bei uns auch ein Ausdruck für ein ungezogenes Kind: Dä loderich Panz hüert wier net (Der nichtsnutzige Kerl ist wieder ungehorsam) hieß es bei einem Jungen, handelte es sich um ein Mädchen, sagte man dat Panz. Ein besonders unfeines Wort für „Bauchschmerzen“ war Panzpeng.
Pänz
Ursprünglich war Pänz ein Mehrzahlbegriff für ungezogene Kinder (siehe: Panz), inzwischen ist aber das Wort derart alltäglich geworden, dass es heute als Sammelbegriff für „Kinder“ allgemein gelten kann. Ein gutes Beispiel für diese Theorie ist unser Dörfer Wiesenfest: Für os Pänz. Das Kind ist im Dörfer Dialekt et Kond, man könnte also auch das Wiesenfest mit Für os Konner betiteln, doch wäre das geradezu unpassend und dem Fest unangemessen. Im Kölner Karneval komponierte Karl Berbuir seinerzeit den Schlager Agrippina, Agrippinensis, wenn du deng Pänz siehs, beste van de Söck, und in einem Düsseldorfer Nachwuchswettbewerb für Büttenredner hieß es Pänz en de Bütt. Auch hier wäre „Kinder en de Bütt“ einfach „unkarnevalistisch.“ Im Zusammenhang mit dem Begriff Pänz gibt es etliche, zum Teil „deftige“ Redensarten, die noch auf dem früheren „Misskredit“ des Wortes hinweisen. Ein derbes Wort beispielsweise: De Pänz van höck douren dem Düwel em Aasch net ist eine ständige Klage konservativer Mitmenschen über „die Jugend von heute.“ De Pänz freißen ejnem de Hoor vam Kopp beschrieb früher mancher Familienvater seine Ernährungsprobleme. Und das ungefähre Gegenteil davon lautete: Han de Pänz dr Balech voll, sen se mejstens frech on doll, und das bedeutet, dass ein gefüllter Bauch leicht Übermut zur Folge hat.
Pastillcher
Wenn wir Kinder früher ein Kratzen im Hals verspürten oder gar Halsweh und Husten bekamen, drückte uns Mam ein kleines Tütchen in die Hand: Pastillcher für dr Hals. Die kaufte man im Allerweltsladen, wo damals auch rezeptfreie Arzneimittel wie Aspirin oder Spalttabletten erhältlich waren, oder allgemein in der Apotheke oder Drogerie. Wir Kinder kauften Pastillcher vorzugsweise an der Kamellebud auf der Blankenheimer Kirmes, wo es auch die nicht weniger begehrten „Veilchenpastillen“ gab. Das Besondere dabei: An der Kirmesbude waren die Pastillcher in stabilen kleinen Blechdosen verpackt, und darauf waren wir besonders scharf: Sie eigneten sich gut fürs Aufbewahren winziger kindlicher Kostbarkeiten. Die rautenförmigen dünnen Salmiakplättchen sollte man eigentlich auf der Zunge zergehen lassen, damit sie ihre heilende Wirkung im erkälteten Hals voll entfalten konnten. Der intensive süß-säuerlich-salzige und angenehm scharfe Geschmack allerdings verleitete zum Zerkauen. Besonders die Mädchen klebten ein paar der Pastillcher mit ein wenig Spucke auf den Handrücken und fabrizierten so kindliche Formen und Figuren, die der Künstler unserer fortschrittlichen Tage einer tiefsinnigen Betrachtung unterziehen würde. Salmiakpastillcher klebten oft an den Zähnen fest und hatten eine schwärzlich gefärbte Zunge zur Folge. Das war aber belanglos und behob sich nach kurzer Zeit von selber.
Pastuësch
Der katholische Dorfpfarrer wurde Pastur (Pastor) genannt, die Pastuësch war seine Haushälterin, die ihm auch das Essen kochte und somit gelegentlich als Pastuësch Kauch (Koch, hier Köchin) betitelt wurde. Pastuësch ist schwer zu definieren, am ehesten trifft „die Pastor´sche“ zu, in jedem Fall ist eine zum Pastor gehörende Person gemeint. Die Pastuësch war in der Regel eine nahe Verwandte des Pfarrers, bei Dechant Hermann Lux (1936 bis 1952) beispielsweise war es dessen Cousine Gretchen Lux und bei Pastor Ewald Dümmer (1960 bis 1988) führte seine Schwester Martha Dümmer den Haushalt. Gretchen Lux war für ihre Kochkunst bekannt, wenn es bei uns daheim nach einer Hausschlachtung ans Wuëschte (Wursten) ging, war sie eine unentbehrliche Hilfe bei der Herstellung der diversen Blut-, Leber- und Bratwürste. Sie kannte etliche Spezialrezepte, die es in der Tat „in sich hatten,“ die Würste aus der Pastuësch-Herstellung waren delikat und begehrt. Martha Dümmer rief in den 1960er Jahren mit mehreren Frauen aus dem Dorf den „Paramentenverein“ ins Leben, der sich als erste freiwillige Aufgabe die Polsterung der harten Kniebänke in der Kirche zum Ziel setzte. Auch die „Einkleidung“ der von Pastor Karl-Heinz Stoffels beschafften Krippenfiguren – die heiligen drei Könige – übernahmen die Damen vom Paramentenverein mit ihrer „Chefin“ Martha Dümmer. Nicht zuletzt war der Verein auch jahrelang in der Leprahilfe tätig.
Patruën
Ein Dialektwort mit zweierlei Bedeutung, unterscheidbar nur durch den vorgesetzten Artikel. Dä Patruën ist der Schutzheilige, der Kirchenpatron; die Patruën ist die Patrone, vornehmlich die Schusswaffenmunition. Ein Patruën kann natürlich auch, wie im Hochdeutschen, einen ungeliebten Mitmenschen oder Genossen bezeichnen: Ene lästije Patruën ist beispielsweise ein aufdringlicher und unbequemer Zeitgenosse, ene jemöötliche Patruën ist das genaue Gegenteil. Patruëne (Patronen) waren nach dem Krieg unser ziemlich gefährliches „Spielzeug.“ Wir bastelten uns Wurfgeräte, in denen beim Aufschlag auf die Straße das Zündhütchen einer aufgebrochenen Patronenhülse knallte. Das war relativ harmlos, als wir aber die Hülse mit einer kompletten Patruën vertauschten, wurde es enorm kritisch. Patruëne lagen massenweise überall herum, vor dem Wald auf Jerretsroot (Flurname) gab es ein richtiges Depot mit Abertausenden, wenn nicht sogar Millionen Schuss Gewehrmunition. Mein Kumpel Dieter und ich hatten hier einmal ein Feuerchen gestocht und mit Patronen „gefüttert,“ die munter knallend explodierten, als plötzlich, in der Abenddämmerung gerade noch erkennbar, vom Nettersheimer Weg her eine Gestalt auf uns zu schlich. Der Unbekannte hat uns damals verfolgt, über die Prommeallee (Pflaumenallee) hinweg, an Jüldens Feldschüer (Feldscheune der Familie Gölden) vorbei, durchs obere Huhendall (Hohental) und hinauf bis an das Wäldchen oberhalb der heutigen Grundschule Blankenheim. Die Jagd führte durch matschiges gepflügtes Ackerland und knöchelhohes Schmelzwasser im Hohental, wir hörten das Platschen der Verfolgerschritte. Der Mann muss ein Fanatiker gewesen sein, er hat uns aber nicht erwischt.
Patt
Das Wort steht in keinem Zusammenhang mit dem unentschiedenen Ausgang eines Spiels oder einer Wette (Pattsituation). Patt ist in der Eifel der weit verbreitete Ausdruck für den Taufpaten. In der Regel wird unterdessen das liebevoll klingende Pättche angewandt, dabei gilt dieses Kosewort als Anrede sowohl für den Paten als auch für das Patenkind. Oft wurde der leibliche Onkel als Taufpate gewählt, den redeten dann alle Familienmitglieder mit Ühem Pättche an. Dem „Patenonkel“ gereichte es sehr zur Ehre und er fühlte sich geschmeichelt, wenn die Verwandtschaft gelegentlich eines Besuches feststellte: Dä Jong kött janz op se Pättche (schlägt seinem Patern nach). Patt war gelegentlich aber auch ein Kindername für alleinstehende ältere Männer, in der Regel Junggesellen. Einen solchen gab es bei uns in der Nachbarschaft: Kaue Patt. Bei uns Kindern war er unbeliebt, er schimpfte dauernd mit uns herum, wir nannten ihn deshalb et Knotterdöppe, was übersetzt so viel wie „Meckerpott“ bedeutet. Kaue Patt starb mit 83 Jahren im Oktober 1951, ich erinnere mich noch gut: Den Sarg mussten wir über eine schräg gestellte Leiter als Rutsche durch ein Fenster ins Sterbezimmer im Obergeschoß und auch wieder zurück transportieren. Die Owwenopstrapp (Treppe im Haus) war zu eng und zu steil, und Kaue Patt war ein gewichtiger Mann.
Peek
Das Wort ist so gut wie vergessen, wer heute nach der Bedeutung von Peek fragt, erntet selbst bei den meisten Senioren nur ein Achselzucken. Die Peek oder auch Pief ist derart alltäglich und selbstverständlich, dass es heute für sie kaum noch einen eigenen Mundartnamen gibt: Die Abschlussspitze an den beiden Enden des Schnürsenkels, die das Enrejhe (Einfädeln) erleichtert und außerdem das Opreffele (Aufspleißen) des Gewebes verhindert. Die Peek war früher eine Bleichpetsch (Blechklammer,Tülle), heute besteht sie meistens aus Kunststoff. Alte Standardwörter für die aus speziellem Senkelblech hergestellte „Senkelnadel“ waren „Pinke“ und „Pfeife,“ hieraus und aus „Pike“ (altes Wort für Spieß) sind vermutlich das mundartliche Peek und das weniger häufig gebrauchte Pief entstanden. Auch das holländische „Piek“ (Spieß) ist mit der Peek verwandt. Ursprünglich war Peek ganz allgemein die Bezeichnung für eine Metallspitze besonders an Stöcken, vermutlich hergeleitet vom französischen „pique,“ was „Spieß“ oder „Lanze“ bedeutet. Vaters Spazierstock besaß am unteren Ende eine eiserne Spitze und damit eine Peek. Eine solche gab es auch am Stockschirm unserer Eltern, am Bergstock der Alpinisten und an den Skistöcken der Wintersportler.
Peich
Während im Hochdeutschen das Wort „Pech“ sowohl im Sinne von „Ungemach, Unglück“ als auch von „Dichtungsmittel aus Baumharz“ angewandt wird, unterscheidet unser Dörfer Platt zwischen Pech für das Unglück und Peich für das Dichtmittel. Unsere Eltern kannten ein Rätsel: Wann hät dr Schuster Pech? Und die Antwort lautete: Wenn hä kee Peich hät. Zum Zusammennähen der Schuhsohlen fertigte der Schuster früher den so genannten Peichdroht aus zusammengedrehten und mit Pech bestrichenen Fäden an, wobei das Pech zum Abdichten der Naht erforderlich war. Hatte also der Schuster einmal kein Peich zur Hand, so war das sein Pech. Dr Peichdroht war früher ein gängiger, gut gemeinter Spitzname für den Dorfschuster. Heutzutage ist Peich ein fast vergessenes Dialektwort, nur noch ganz wenige Senioren wissen um seine frühere Bedeutung. So hat sich beispielsweise die gute alte Peichfackel unserer Eltern längst in die zeitgemäße Pechfackel verwandelt, und aus Peich on Schwävel ist Pech on Schwefel geworden. Der oft zitierte „Pechvogel“ heißt auch bei uns Pechvurrel und nicht etwa Peichvurrel, obwohl sein Pech eigentlich auf Peich zurückzuführen ist: Die Vögel gingen den „Vogelstellern“ in den mit Leim oder Pech bestrichenen „Vogelruten“ in Sinne des Wortes „auf den Leim.“ Echte Pechvögel sind auch die Millionen von Seevögeln, die durch Ölbohrungen und Tankerunfälle ums Leben kamen und kommen.
Peisch
Zu jedem Haus im Eifeldorf gehörte früher eine mehr oder weniger große Wiesenfläche, die allgemein in Verbindung mit dem Hausnamen „Peisch“ hieß, in Blankenheimerdorf beispielsweise Scholtesse Peisch oder Jasse Peisch. Auch bei uns daheim gab es direkt vor dem Haus den Peisch, die Wiese hinter dem Haus war dr Bongert. Generell war der Peisch eine Wiese am Haus, die Bezeichnung für Wiesen allgemein war Bähne, oft als Flurbezeichnung gebraucht: Em Lenzebähne, Em Sengelsbähne. Aber auch außerhalb des Dorfes gelegene, meist eingezäunte Streuobstwiesen trugen oft den Namen ihres Besitzers mit dem Zusatz Peisch. Eine willkürliche Verhochdeutschung von Peisch ist „Pesch,“ in Flurkarten beispielsweise oder bei Straßennamen: Tonnenpesch, Räuberspesch. In der Nachbargemeinde Nettersheim gibt es die Ortschaft Pesch, im Volksmund Peisch genannt, und ein Stadtteil von Köln heißt ebenfalls Pesch. Die Wiesen auf dem Gelände der Hofwüstungen „Bierth“ und „Schneppen“ waren bis um die 1970er Jahre verpachtet: Auf Bierther Peisch erntete unser Nachbar Klinkhammer Heu, den Schneppe Peisch hatte Nachbar Rütz gepachtet. Im Ortsteil Kippelberg in Blankenheimerdorf gab es das Anwesen von Johann Jentges, der ortsübliche Hausname war Peische, der Hausbesitzer war somit Peische Johann, er war der Bruder von Karels Mechel (Michael Jentges), unserem langjährigen Küster und Organisten.
nach oben
zurück zur Übersicht
Peng (weiches e)
Das Wort wird mit deutlichem weichem e ausgesprochen, wie beispielsweise bei „Kaneng“ (Kaninchen). Der Kölner sagt übrigens „Ping“ und der Holländer „Pijn,“ die Wortverwandtschaft mit unserem Standardwort „Pein“ (Schmerz) ist unverkennbar. Aus einer Fülle von alltäglichen Redewendungen im Zusammenhang mit Peng seien hier einige aufgeführt. Unsere Eltern kannten ein hintergründiges Wort: Jöck os schlommer wie Peng (Juckreiz ist schlimmer als Schmerz). Das trifft durchaus etwa bei Neurodermitis zu, soll aber auch dem Vernehmen nach auf nicht krankhaften Jöck anwendbar sein. Dat määch mir noch Koppeng besagt, dass man sich noch den Kopf zerbricht. Vor lauter Zanntpeng (Zahnschmerzen) möchte man an die Decke springen. Buchpeng bekamen wir Pänz gelegentlich nach dem „Naschen“ halbreifer Knüetschele (Johannisbeeren), Buchpeng wird im rüden Umgangston brutal als Balechpeng oder auch Panzpeng bezeichnet. Hoffart legg Peng (wörtlich: Eitelkeit leidet Schmerzen) lautete eine Weisheit im Zusammenhang mit weiblichen „Schönheitsstrapazen.“ Dä krömp sech van Peng heißt, dass sich einer vor Schmerzen krümmt, und wenn wir Kinder Halspeng (Halsschmerzen, Angina) hatten, wirkte in der Regel ein nächtlicher „Strumpfwickel“ wahre Wunder. Mattes hatte starke Peng im linken Arm und der Doktor meinte, das sei altersbedingt. Das bestritt der Patient aber nachhaltig: Enää, dat kann net sen, dä räechte Ärm os jenauesu alt, do han ech äwwer kejn Peng dren.
pengelich (weiches e)
Das Wort ist unverkennbar von Peng hergeleitet, wird also auch mit kurzem weichem e gesprochen. Die Bedeutung: Empfindlich, zimperlich, wählerisch. Das Zeitwort dazu ist pengele und beschreibt hochgradige Empfindlichkeit, beispielsweise übermäßiges Lamentieren beim geringsten Schmerz. Auch übergenaues Arbeiten ist pengelich, ebenso das „Kräutchenrührmichnichtan,“ das hinter jedem Wort der Mitmenschen eine persönliche Gehässigkeit sieht. Pengeliche Reaktionen insgesamt werden Pengelerej genannt, ein pengelicher Mensch ist für seine Umwelt ein Pengel. Wenn ich früher die Öllichspiefe (Zwiebelblätter) aus meiner Suppe fischte und bei Mam (Mutter) auf den Teller tat, meckerte sie: Dat iß mr mot, bos net esu pengelich (Das isst man mit, sei nicht so empfindlich). In einem Eifeler Gasthaus speiste ich zu Mittag, die Wirtin griff mit der Hand zwei kalte Bratenstücke von der Platte und tat sie mir auf den Teller: Dä ess, schmeck joot, ech wejß jo, dat du net pengelich bos. Schon im Weggehen, griff sie nochmals nach der Platte und knallte mir noch ein Bratenstück auf den Teller: Dä, schmeck joot. Es schmeckte in der Tat hervorragend, und pengelich bin ich tatsächlich nicht. Übrigens: Die Hände der Wirtin waren ordentlich und sauber. Und sie war bekannt für ihre Kochkunst.
Pengste (weiches e)
Unser Dialektwort für „Pfingsten,“ eng verwandt mit dem holländischen Ausdruck „Pinksteren.“ Um die Pengsdaach (Pfingsttage) ranken sich zahlreiche Wetter- und Bauernregeln, beispielsweise „Pfingstregen bringt Weinsegen.“ Ein hintergründiges Eifeler Wort besagt: Os et op Uëstere (Ostern) schön on wärm, kött de Verwandschaff on friß dech ärm. Os et op Pengste schön on erfreulich, kommense noch ens on freiße wie neulich. Eine Übersetzung ist hier wohl nicht erforderlich. „Wenn Pfingsten auf Ostern fällt“ ist allgemein die Umschreibung für „niemals,“ weil dieser Zustand unmöglich ist. Das gilt unterdessen nicht für Blankenheimerdorf. Dort nämlich hatte seinerzeit Stombs Wellem (ein Dörfer Original) auf dem Heimweg vom Oster-Frühschoppen, ob seiner etwas unsicheren Gangart mit der Kulang (Rinnstein) Bekanntschaft gemacht. Flugs rappelte er sich hoch, kehrte zum Stammtisch zurück und verkündete stolz: Jonge, höck os jät passiert, wat et noch nie jejenn hät, - höck os Pengste op Uëstere jefalle (Jungs, heute ist etwas Niedagewesenes passiert, heute ist Pfingsten auf Ostern gefallen). Zweifellos hatte er Recht: Wellem hieß mit gut bürgerlichem Namen Wilhelm Pfingsten.
Penning
Auf meinem Schreibtisch steht ein winziges, messingglänzendes Schweinchen, kaum größer als der „Glückspfennig,“ den es angelötet auf dem Rücken trägt und der richtig genommen ein „Glücks-Cent“ ist. Der Pfennig war zu Omas Zeiten unsere vom Wert her kleinste Geldmünze, im Volksmund Penning genannt. Ene Penning os och Jeld (Ein Pfennig ist auch Geld), nach dieser Devise wirtschafteten unsere Eltern, und das war gar nicht mal so verkehrt. Damals galt noch das weise Wort: „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.“ Heute gilt das offensichtlich nicht mehr, denn: Auf dem Parkplatz am Supermarkt lag eine Fünf Cent-Münze, der Mann vor mir stieß sie mit dem Fuß an – und ging weiter. Der Kaufhauskunde von heute bückt sich nicht nach lumpigen fünf Cents! Wenn man die absolute Wertlosigkeit einer Sache herausstellen will, sagt man Do jenn ech kejne Penning für (Dafür gebe ich keinen Pfennig). Geläufig ist auch heute noch die Redensart Op Heller on Penning, und in der großen Inflation 1923 hieß die Parole: Leever dr letzte Penning versuffe als noch ens spare (Lieber den letzten Pfennig versaufen als nochmals sparen). Penningskroom ist geringwertige Ware, und ein Penningsvötzer oder Penningsknüver ist ein Geizhals.
Penn-Pittche (weiches e)
Penn-Pittche war ein bekannter und beliebter Schuster in Blankenheimerdorf, sein richtiger Name war Peter Warler. Den ortsüblichen Namen Penn-Pittche verdankte er seinem Schuhmacherberuf. Penn ist die mundartliche Bezeichnung für Stift, Nagel, Nadel, Dübel (Englisch: Pin). Im vorliegenden Fall sind speziell die Holznägel gemeint, mit denen der Lappe (Schuhsohle) an der Brandsoll (Brandsohle) befestigt wurde. Penn-Pittche bedeutete somit „Holznagel-Peter.“ Früher gab es noch keinen Alles- oder Sekundenkleber, zusätzlich zum „Schusterleim“ musste daher die Sohle jepennt werden. Die Holznägel wurden meist aus Buchen- oder Birkenholz hergestellt, sie mussten trocken verarbeitet werden und wurden erst beim Einwirken von Feuchtigkeit durch Aufquellen dauerhaft haltbar. Die Nagelstelle wurde durch Einschlagen der Schusterahle „vorgebohrt.“ Die Holzpenn sind längst durch moderne Klebstoffe überflüssig geworden, für traditionsbewusste Liebhaber werden aber auch heute noch „Holzgenagelte“ hergestellt. De Penn stohn erüß (Die Holznägel stehen heraus) war eine Feststellung, die kein Schuster gern hörte: Gelegentlich waren die Penn im Schuh durch die „Brandsohle“ gedrungen und wurden nicht ordentlich abgefeilt. Solche „Flickschusterei“ kam aber bei einem Meister wie Penn-Pittche nicht vor.
Permeter
Mit wissenschaftlichen oder technischen Fachausdrücken konnte der kernige Eifeler unserer Kinderzeit wenig anfangen, die bog er sich so zurecht, dass sie in seinen Sprachschatz hinein passten und „aussprechbar“ waren. Da war beispielsweise das Barometer, ein Wundergerät, das ziemlich zuverlässig Regen und Sonnenschein ankündigen konnte. Der „Meter“ war den Leuten ja noch allgemein als Längenmaß geläufig, den akzeptierte man noch, obwohl er eigentlich mit Sonne und Regen nicht in Zusammenhang gebracht werden konnte. Mit dem Baro war aber beim besten Willen nichts anzufangen, das war auch für die Eifeler Kehle ungewohnt, also änderte man es kurzerhand auf das zungengerechte Per ab und der Permeter war geboren. Der Permeter unserer Eltern war ein Schmuckstück für die Stubenwand: Ein wunderschön geschnitztes und verschnörkeltes Brettchen mit aufgeschraubtem glänzendem Messwerk. Meistens war auch noch ein zweiter Meter dabei, nämlich der Termemeter (das Thermometer). Bei uns daheim gab es weder ein Per- noch ein Termemeter an der Wand, wohl aber, gut eingewickelt und geschützt im Nachtskommödchen, einen Febertermemeter zum Messen der Körpertemperatur, wenn wir wieder mal Halspeng (Halsschmerzen) hatten. Im Nachbarhaus dagegen rückte Kaue Tant (Kindername für die Nachbarsfrau) die Brille zurecht, tippte mit dem Zeigefinger gegen das Messwerkglas und verkündete: Dr Permeter os jefalle, und Kaue Patt (ein alter Junggeselle, ihr Schwager), der gerade vorbeikam, meinte über die Schulter: Dann raaf en wier op (Dann hebe ihn wieder auf).
pesse (weiches e)
Es mag sich um ein etwas „anrüchiges“ Wort handeln, pesse beschreibt unterdessen eine unabdingbar lebensnotwendige Körperfunktion, ist somit also weder unanständig noch unfein. Der Doktor sagt „harnen“ oder „Wasser lassen,“ unser Hochdeutsch kennt „pissen“ und „urinieren,“ auf Englisch heißt es „to piss“ und mein Freund und Nachbar Hein musste beim Garagenfest des Öfteren ens wässere john (einmal wässern gehen). Das hatte er wohl von unseren holländischen Nachbarn gelernt, die nämlich sagen „wateren.“ Wir Kinder kannten allgemein nur den Ausdruck pesse, der auch heute noch allenthalben Gültigkeit besitzt. Sehr verbreitet ist auch schiffe, etwas hintergründig sagt man hier und dort afschödde (abschütten), regional heißt es strohle (strahlen), und meine Euskirchener Kollegen gingen dr Lämpes schwenke oder auch dr Ohm zoppe. Sie kannten schließlich noch den Ausdruck maieme. Deutlich „kräftiger“ ist der landläufige Begriff secke (weiches e), der schon eher als „unfein“ gelten kann. Das kommt beispielsweise bei der Redewendung et os am secke zum Ausdruck: Heftiger Regen ist meist eine „fiese“ Angelegenheit und wird mit einem ebenso fiesen Wort beschrieben. En de Botz pesse tun manche Menschen aus Furcht oder auch vor lauter Lachen. Der Pessdokter ist ein Naturheilkundler, der aus dem menschlichen Pess Krankheiter erkennen kann, der Pessejmer (Toiletteneimer) ist ein ungeliebtes Gerät, und der Pesspott stand bei Oma und Opa unterm Bett oder im Nachtskommödchen.
petsche (weiches e)
Die feinen Leute verhochdeutschen gelegentlich unser petsche und machen daraus pitschen, was unterdessen kein offizielles Standardwort ist. (Siehe auch: afpetsche). Die Bedeutung ist generell „zwicken, kneifen“ oder übertragen auch „schmerzen.“ Petsche ist beinahe ein „Allerweltswort,“ das bei unzähligen Gelegenheiten zur Anwendung kommt. Ungläubiges Staunen kommentieren wir beispielsweise so: Petsch mech ens, ech jlööv ech tröüme (Kneif mich mal, ich glaube ich träume). Losse mir os ejne petsche john ist die Aufforderung zu einem Bier in der nächsten Kneipe, und wer einmal etwas tief ins Glas geschaut hat, der hät sech ejne jepetsch. Das Substantiv zu petsche ist die Petsch, Klammern, Zwingen oder Klemmen jeder Art sind Petsche, beispielsweise die Schraubzwinge des Schreiners, die Briefklammer im Büro oder die Wäscheklammer der Hausfrau. Die Petsch kann auch einen Körperteil bezeichnen, allerdings mehr oder weniger nur in der Gossensprache. Aus der Mode gekommen ist die Botzepetsch unserer Eltern: Die „Hosenklammer“ zum Schutz des Hosenbeins vor dem Kettenrad am Drahtesel (siehe: Botzepetsch). Als Kinder hatten wir uns alle naselang de Fongere jepetsch (die Finger gequetscht), und wenn im Winter die im Backöfchen hart getrockneten Kinderschuhe morgens empfindlich drückten, klagten wir: Mam, die Schoh petschen äwwer ärch. Wenn die neue Zahnprothese Druckstellen erzeugt, dann petschen de Zänn, und das Augenzwinkern umschreiben wir: E Petschöüjelche maache (wörtlich: Ein Kneifäuglein machen).
Pief
Der kernige Eifelbauer unserer Kinderzeit lebt in unserer Erinnerung fast ausschließlich mit der Pfeife im Mund. De Pief moß dämpe (Die Pfeife muss qualmen), nach dieser Devise nahm beispielsweise Ohm Mattes (mein Onkel Matthias) sein Knasterdöppe mit dem krummen Stil und dem dicken Kopf sozusagen nur zum Essen und zum Schlafen aus dem Mund. Ich selber habe, bevor ich das Laster „drangab,“ gut zwei Jahre Pief jerouch (Pfeife geraucht) und behaupte: Die teuerste Zigarette ist ein Nichts gegen eine „eingerauchte“ Pfeife. Du kanns mir dr Mai piefe (wörtlich: Du kannst mir den Mai rauchen) ist eine sehr gängige Umschreibung des Götz-Zitats. Ein kurioser Begriff sind die Sebbesackspiefe (Sieben Sackpfeifen), unser Wort für „Habseligkeiten, Plunder, Siebensachen.“ Schnapp dir deng Sebbesackspiefe on hau ab bedeutet einen Hinauswurf: „Pack deinen Krempel und verschwinde.“ Eine absolute Wertlosigkeit beschreiben wir mit Dat kannste en dr Pief rouche, und Achtzehnhundertpiefendeckel heißt soviel wie „in unbestimmbarer alter Zeit.“ Röhrenförmige Gegenstände sind in unserem Alltag Piefe. So ist das Ofenrohr de Oëwespief, das Lauch- und Zwiebelblatt ist de Öllichspief, und von der kinderreichen Familie sagt man Die han Pänz wie de Orjelspiefe. Ein ziemlich makabres Zitat ist Om letzte Lauch piefe (Auf dem letzten Loch pfeifen), der Piefeknaster oder auch Piefesejver ist der feuchte und stinkende Rückstand im Piefekopp, dem man in regelmäßigen Abständen mit dem Piefestäucher (Pfeifenstocher) entfernen sollte. Und schließlich: Der Kölner Karnevalist Willi Ostermann schrieb und sang seinerzeit „Kut erop kut erop kut erop, bei Palms do es de Pief verstopp…“
Pieferühr
Wörtlich „Pfeifenrohr“ in der Bedeutung von „Ofenrohr“, das allgemein Pief (Pfeife) hieß. Seltener war die Bezeichnung Oëwespief (Ofenpfeife). Im alten Bauernhaus führte das Pieferühr des Stubenofens durch die Zimmerdecke, ragte im darüber liegenden Schlafgemach der Eltern meterhoch aus dem Fußboden und führte erst dann in den Kamin. Der Grund: Durch das heiße Pieferühr war das Zimmer stets angenehm temperiert, - eine praktisch kostenlose Schlafzimmerheizung, die vom Stubenofen mit betrieben wurde. Ein solches Pieferühr gab es nach dem Krieg auch noch in unserem Haus Muuße auf dem Kippelberg. Etwa 20 Zentimeter vor der Wand ragte es anderthalb Meter hoch aus dem Fußboden des elterlichen Schlafgemachs im Giebelzimmer und führte dann in den Kamin. Es war zwar stets angenehm warm im Zimmer, es roch unterdessen aber auch immer ein wenig nach Pief. Ich hätte hier nicht schlafen mögen, den Eltern machte dieses „Klima“ aber nichts aus. Außerdem befand sich ja hier der „Haustelegraph“ in Gestalt des Ofenrohrs (siehe: Oëwespief), und der war bei vier Familiensprösslingen unverzichtbar. Unser Pieferühr war ursprünglich einfach durch ein Loch im Fußboden gesteckt, der dann auch deutliche Brandspuren aufwies. Bei der ersten Renovierung hat Vater später eine passende Beton-Durchführung eingebaut.
Pitter
Wenn die Bayern aus „Josef“ einen Sepp fabrizieren, dann machen wir eben aus dem „Peter“ einen Pitter, und den kennt das gesamte Rheinland, nicht nur unsere Eifel. Pitter heißt einer unserer Pfarrpatrone, Pitteschdaach, sein Namensfest am 29. Juni, wird auch Pitter on Paul genannt und war früher ein hoher Festtag in unserem Dorf. Aus meiner Kinderzeit ist mir eine Redewendung in Erinnerung: Pitter, et jit e Jewitter, - Kloos, dat os net wohr, dr Himmel wiëd ad wier kloor. Das sollte unsere Kinderangst vor dem Gewitter beschwichtigen. Pittermännche ist nicht nur die Verniedlichung von Pitter, es bezeichnet auch das beliebte Zehn-Liter-Kölschfässchen auf dem Partytisch. Jannespitter oder Pitterjuësep waren früher gängige Eifeler Namensgebungen (Johannpeter, Peterjosef). Ein früherer Trinkspruch lautete: Pitter, loß dr Moot net senke, loß mr noch e Dröppche drenke – eine nur zu bereitwillig befolgte Einladung. Der drüjje Pitter ist ein langweiliger einsilbiger Mitmensch („trockener Peter“), der jecke Pitter ist ein „merkwürdiger Heiliger,“ der Knommels- oder Knüselspitter bastelt an allem Möglichen herum, der Luchpitter nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau („Lügenpeter“), der Quatsch- oder Quasselspitter brabbelt meistens unsinniges Zeug daher, der Schmuspitter versteht es, sich beliebt zu machen, und der Stronzpitter ist ein Angeber. Krämesch Pitter war unser, im September 1991 verstorbener beliebter Gastwirt, und Scholle Pitter (Peter Reetz) war unter Bürgermeister Johann („Schang“) Leyendecker Gemeindediener von Blankenheimerdorf.
nach oben
zurück zur Übersicht
Pitterzaudech
Ein typisches Eifeler Wort für „Diarrhö,“ was auf gut Deutsch „Durchfall“ bedeutet. Pitterzaudech besteht eigentlich aus drei Einzelwörtern: Pitter zau dech, und heißt übersetzt „Peter beeile dich.“ Andere landläufige Ausdrücke sind Dönndreß, Dönnflitsch, Flöcke Pitter, Schnelle Otto, oder ganz einfach Dr Dönn. Bei uns daheim gab es eine etwas seltsame Kombinationsformel: Zau dech Pitter maach flöck (beeil dich Peter mach schnell). Im Hochdeutschen gibt es noch den Dünnpfiff, den Dünnschiss und den etwas ungewöhnlichen Ritschritsch. Ein gefürchteter Pitterzaudech ist „Montezumas Rache,“ kaum ein Tropen- oder Südamerikaurlauber, den dieser Reisedurchfall nicht gepeinigt hätte. Montezuma war ein Aztekenfürst, der vor seinem Tod die weißen Eindringlinge verfluchte und schwor, dass sie unter seiner Rache fürchterlich zu leiden haben würden. Ein Kollege, den ich geärgert hatte, wünschte mir dr jlöhende Dönndreß (den glühenden …) an den Leib, gottseidank ging sein unchristlicher Wunsch nicht in Erfüllung. Wer auf dem Heimweg, etwa von der Kneipe, vom Zaudechpitter überfallen wird, der tut gut daran, sich äußerst behutsam zu verhalten, eine unvorsichtige Bewegung nämlich geht unweigerlich en de Botz (in die Hose). Einen solchen „Heimkehrer“ beobachtete ich einmal spätabends unbemerkt, er suchte intensiv die finsteren Straßenbereiche auf und seine „Körpersprache“ hätte einem Breakdancer zur Ehre gereicht. Ich konnte ihm seine Not nur zu gut nachfühlen, - aus eigener Erfahrung. Ein langdauernder Zaudechpitter, der sich erst nach Jahren „verzieht“ und nur selten ganz verschwindet, ist auch die natürliche Folge einer „Hemikolektomie“ (Entfernung des halben Dickdarms). Daran gewöhnt man sich aber mit der Zeit.
Pitteschdaach
Die Pfarrkirche von Blankenheimerdorf ist den Apostelfürsten Petrus und Paulus geweiht. Deren Namensfest am 29. Juni war früher ein hoher kirchlicher Fest- und Feiertag fürs Dorf mit festlichem Gottesdienst und einer Prozession ähnlich wie Fronleichnam. Zu Pitteschdaach (wörtlich = Peterstag) kam aus nah und fern die Verwandtschaft zu Besuch und wurde dem Anlass entsprechend festlich mit Taat (Eifeler Torte) und Streukooche (Streuselkuchen) bewirtet, auf den Mittagstisch kam sogar ein saftiger Schweinebraten, sehr oft war es die, für diesen Festtag eigens aufbewahrte Pääps (siehe: Pääps) Was Pitteschdaach für Blankenheimerdorf, das war Brijittefess (Brigidafest am 01. Februar) für den Nachbarort Nonnenbach. Die dortige Kapelle ist der heiligen Brigida geweiht. Sankt Petrus und Paulus werden regional gelegentlich „Die Herren über das Wetter“ betitelt. Das kommt nicht von ungefähr, denn es gibt eine Reihe von Bauernregeln zu Pitteschdaach, eine davon besagt beispielsweise: „Regnet´s am Tag von Peter und Paul, so steht es mit dem Wetter faul. Es drohen 30 Regentage, da nützet nun mal keine Klage.“ Der Bauer weiß auch, dass ab Pitteschdaach das Getreide reift: „Auf Peter und Paul bricht dem Korn die Wurzel und es reift alsdann Tag und Nacht.“ Den früheren Festtag Pitteschdaach gibt es in Blankenheimerdorf nicht mehr.
Pitteschholz
Das Wort bedeutet „Petersholz“ und ist die Flurbezeichnung für den Waldbereich von Blankenheim-Wald aus in Richtung Milzenhäuschen und Krekel, durch den die heutige Bundesstraße 258 verläuft. Im Petersholz wurde früher Eisenerz abgebaut. In Pitteschholz zwischen Blankenheim-Wald und Milzenhäuschen hatte seinerzeit die Wehrmacht beiderseits der Straße erhebliche Mengen Munition und Sprengstoff deponiert. Wir Halbwüchsige entdeckten nach dem Krieg hier eine wahre Fundgrube: Material für unsere geheimen und lebensgefährlichen „Schieß- und Sprengaktionen“ in Hülle und Fülle, insbesondere hatten wir es auf die Sprengkapseln abgesehen, die in besonderen Behältnissen in den Holzkisten bei den Handgranaten steckten. Zwar wurde nach dem Krieg das gesamte Zeug an Ort und Stelle gesprengt, für uns blieb unterdessen immer noch genug übrig. Für die Neutrassierung der Bundesstraße musste in Pitteschholz ein breiter Streifen Wald gerodet werden. Die Waldarbeiter Heere Paul, Bahne Mattes und Kochs Pitter (Paul Hoffmann, Matthias Schlemmer, Peter Koch) waren beim Verbrennen des Reisigs, als es plötzlich im Feuer fürchterlich krachte, - im Waldboden versteckte Munition, deren Explosion glücklicherweise keinen Schaden anrichtete. Ab da untersuchten die Drei den Boden jedes Mal gründlich, bevor sie Feuer machten.
Pläät
Die Pläät, regional auch Plaat, ist das weithin bekannte Mundartwort für „Glatze, Kahlkopf.“ Eine etwas hinterhältige Form ist Pläätekopp. Die Pläät kann manchmal echt nützlich sein, denn Wä en Pläät hät, bruch sech net ze kämme (Die Glatze erspart den Kamm). Ein etwas widersinniges Wort besagt Besser en Pläät, wie jarkejn Hoor (Besser eine Glatze, als gar keine Haare). Eine ganz bestimmte Pläät, nämlich die von Hans Hääp Klaßen, bleibt in Blankenheimerdorf in bester Erinnerung. Am 12. Mai 1972 – es war der Karfreitag – tagte im Hotel Schmitz-Cremer die Interessengemeinschaft Wiesenfest Für os Pänz (Für unsere Kinder). In der anschließenden Bierrunde behauptete Hääp, er würde sich für 100 DM en Pläät schnegge lassen. Unverzüglich blätterte Johann Klobbe Friederichs einen Hunderter auf den Tisch und Hääp musste an Ort und Stelle Haare lassen. Horst Simmler führte den Rasierer, begleitet vom Gejohle der Anwesenden. Dann aber wurde es mäuschenstill: Hääp wog etwas nachdenklich den „Blauen“ einen Augenblick lang in der Hand – und steckte ihn in die Wiesenfest-Spardose. „Für os Pänz“ war vor einem Jahr erst gegründet worden, 100 D-Mark für die Wiesenfestkasse waren ein wahrer Reichtum. Hääps Gute Tat bleibt unvergessen. Jugendliche Kahlköpfe sind heute „in,“ die Zeiten ändern sich eben.
Plack
Das Wort ist heute nicht mehr gebräuchlich, früher bezeichnete man mit Plack Hauterkrankungen wie Grind oder Schorf besonders am Kopf. Mit Plack artverwandt ist Schapp (Krätze). Als Kinder hatten wir gar nicht so selten Plack auf der Kopfhaut, - eine unangenehm juckende, kratzende und schuppende Angelegenheit, die vermutlich durch mangelnde Hygiene hervorgerufen und mit Omas Hausmittelchen „kuriert“ wurde. Das waren wiederholte „Behandlungen“ mit irgendeinem Gemisch aus Öl und Essig, das die Krusten aufweichte und abheilen ließ. Verursacher von Plack konnten auch Kopfläuse sein, die uns im Krieg gewaltig plagten und mangels anderer Mittel, mit stinkenden Petroleum-Verbänden bekämpft wurden. Das klingt drastisch, wurde aber gehandhabt und war sogar wirksam. Plack hatten wir auch häufig im Gesicht, meistens am Mund, als Folge schlechter Ernährung. En Bröötsch an dr Mul (Ausschlag am Mund), das war fast immer schmerzhafter Lippen-Herpes, der daheim mit ungesalzenem Schweineschmalz behandelt wurde. Das heilte zwar kaum, verhinderte aber das Verschorfen und die Bildung schmerzhafter Hautrisse. Plack an dr Mul war hintergründig auch ein Zeichen dafür, dass man verkiert jebütz (falsch geküsst) hatte. Das Zusammenwirken von Läusen und Schorf machte eine frühere Redewendung deutlich: Je schlommer dr Plack, desto fetter de Lüüs, und ein weiteres Wort besagte: Wenn dr Neid Plack maache däät, dann mööten sech de mejste Löck kratze (Wenn Neid Plack verursachen würde, dann müssten sich die meisten Menschen kratzen).
Plätt
Was dem Pferd sein Hufeisen, das bedeutete dem Ochsen oder der Gespannkuh die Plätt: Schutz des Hufs vor Verschleiß und Verletzung. Wenn eine unserer Arbeitskühe zu humpeln begann und beim Auftreten offensichtlich Schmerzen verspürte, brauchte sie nöü Schoh (neue Schuhe) und musste zum Beschlagen en de Schmed (in die Schmiede), wo ihr die verschlissene oder gelockerte Plätt (Hufplatte) erneuert wurde. Als Paarhufer benötigten Kühe und Ochsen speziellen Beschlag in Gestalt einer kleinen Eisenplatte. Die musste in jedem Fall individuell angefertigt und dem Huf angepasst werden, fertige Rohlinge wie beispielsweise beim Hufeisen, waren wenig vorteilhaft. Beschlagen wurden in der Regel die Außenklauen der Vorderhufe, die Hinterhufe wurden nur bei schwerem Arbeitseinsatz mit Plätte versehen. Genagelt wurde die Plätt am Außenrand, innen wurde sie durch eine ausgeschmiedete Eisenzunge gehalten, die zwischen den Klauen hindurch geführt und umgebogen wurde. Meister ihres Schmiedefachs waren zu meiner Kinderzeit et Schmeddche (wörtlich: das Schmiedchen) in Blankenheimerdorf und Pent-Köbes in Waldorf. Der Dörfer Schmied hieß Josef Friederichs, war klein von Gestalt und wurde daher nur et Schmeddche genannt. Sein Berufskollege in Waldorf hieß Jakob Pint, wir Nonnenbacher ließen unsere Tiere bei ihm beschlagen, weil seine Schmiede am Ortsrand lag und über weiche Feld- und Wiesenwege erreichbar war, was den lädierten Tierfüßen zugute kam.
plöcke (weiches ö)
Auch hier wird wieder die enge Verwandtschaft mit dem Niederländischen deutlich: Die Holländer sagen „plukken“ (gesprochen: plücken), gemeint ist natürlich „pflücken.“ Plöcke steht in manchen Fällen auch für „rupfen,“ Heu plöcke (Heu rupfen) beispielsweise oder et Hohn plöcke (das Huhn rupfen). Das eigentliche Pflücken kommt unter anderem beim Nöß plöcke (Nüsse pflücken) zum Ausdruck oder bei Äppel plöcke (Äpfel pflücken). Die Vergangenheitsform „gepflückt“ heißt im Dialekt jeplodd (weiches o) und wird verspottend für eine Tracht Prügel angewandt: Jung, dä hät se äwwer deftich jeplodd krijje (…ist massiv verprügelt worden). Das vom Zeitwort plöcke abgeleitete Hauptwort ist der Plöck und bezeichnet „das Gepflückte,“ also die Ernte. Der Prommeplöck beispielsweise ist die Pflaumenernte. Der Kölner Karnevalist Karl Berbuer hatte im Jahr 1949 einen Bombenerfolg mit seinem Plöckleed: „Jo dä eeschte Plöck es prima, och dä zweite Plöck es joot…“ Den dritten Plöck, so rät der Liedtext, sollte man sich an den Hut stecken, weil der „kein Klima verträgt.“ Ein Schelm, wer diese karnevalistische Plöckversion auf unsere Damenwelt übertrüge!
Ploochschlejf
Wörtlich übersetzt „Pflugschleife, Pflugschleppe“, eine Vorrichtung für den Transport des Pfluges auf der Straße. Das Pflügegerät des „kleinen Mannes“ war zur Zeit unserer Eltern und Großeltern der leichte einscharige Karren - Wendepflug, dessen Führungsteil zwei Räder besaß. Die Ploochschlejf bestand aus zwei starken, etwa 1,5 Meter langen und V-förmig zusammengefügten Rundhölzern. Für den Transport wurde der Pflugbalken mit Schar und Sterzen waagerecht gedreht und auf die Schlejf gelegt. Deren beide Enden waren von oben her so zwischen Schar und Grindel gesteckt, dass sie zwei schräg nach hinten ragende „Beine“ bildeten, auf denen der hintere Pflugteil, der ja keine Räder besaß, auflag und jeschlejf (geschleppt) wurde. Die Ploochschlejf verursachte fürchterliches Knirschen und Scharren auf den steinigen Wegen und hinterließ deutliche Schleifspuren. Vereinzelt bastelten sich findige Bauern eine Art einachsigen „Karren,“ der die Funktion der Schlejf übernahm und einen leichteren Transport des Pfluges ermöglichte. Die Ploochschlejf musste von Zeit zu Zeit erneuert werden, weil die beiden Holzenden relativ rasch abnutzten und verschlissen.
Poppe (weiches o)
Der Plural von Popp mit der Bedeutung „Puppen.“ Allbekannt ist der Ausdruck Do sin de Poppe am danze als Umschreibung für einen massiven Streit. Ein beliebtes Spielzeug und Weihnachtsgeschenk für Mädchen war früher die Poppeköch (Puppenküche), die oft der bastelfreudige Vater selber fabrizierte und mit gekauften Pöppcher (Püppchen) ausstattete. Eine interessante Wortabweichung kam in der Kindersprache bei Puppa oder Puppachen zum Ausdruck: Ein liebevoller Name der Puppenmutti für ihr Kind. Poppe war nicht zuletzt ein markantes Wort im Fachjargon der Dachdecker. Die Eifeler Daachpanne (Dachziegel) waren so genannte Schottelspanne (übersetzt = Schüsselpfannen) aus Ton oder Beton, muldenförmige Hohlpfannen ohne Falz mit einer halbrunden Überlappung. Wenn der Dachdecker von Poppe sprach, dann meinte er damit die puppenartigen kleinen Strohbündelchen, die zum Abdichten unter die Überlappung gesteckt wurden. Lebensgroße Strühpoppe (Strohpuppen) wurden als Wild- und Vogelscheuchen auf die Felder gestellt, und schließlich spielten sie im Dorfbrauchtum eine Rolle: Als Schabeies (Kirmessymbol, beispielsweise in Nettersheim) oder als Verhöhnung des/der verschmähten Liebhabers/in anlässlich der Hochzeit des/der früheren Geliebten.
Poss-Mechel
Poss-Mechel war Landwirt, Küster, Organist, Chorleiter und Postzusteller in Blankenheimerdorf. Sein richtiger Name war Michael Jentges, nach seinem Hausnamen wurde er häufig auch „Karels Mechel“ genannt. Im Hause Jentges auf dem Kippelberg (Ortsteil) war jahrzehntelang eine Nebenstelle der Post eingerichtet. Während Vater Michael mit dem schwer beladenen Fahrrad Pakete und Briefe zustellte, bedienten am kleinen Schalterfensterchen im Flur links neben der Haustür Ehefrau Agnes oder Tochter Christel die Kundschaft. Poss-Mechel war im Jahr1892 geboren und hat noch im ersten Weltkrieg „gedient.“ Er wurde von der Militärregierung als erster Bürgermeister von Blankenheimerdorf nach dem zweiten Weltkrieg eingesetzt. Seine erste Aufgabe war die Säuberung des Schulgebäudes und das Zufüllen von Bombentrichtern auf den Wegen und Straßen. Über die Kriegs- und Nachkriegsjahre von 1941 bis 1952 hat Poss-Mechel für die Nachwelt wertvolle Aufzeichnungen hinterlassen. Das „Tagebuch“ berichtet unter anderem von der letzten Postzustellung am 06. März 1945 und der Schließung der Poststelle, es endet mit der Einführung von Dechant Hermann Lux als Probst in Kempen am 23. November 1952. Poss-Mechel starb im Oktober 1979 im Alter von 87 Jahren.
poste
Das mundartliche Zeitwort poste wurde bei der Veredelung von Obstbäumen angewendet. Beim so genannten „Pfropfen“ wird ein Edelreis auf ein Trägerstämmchen aufgesetzt. Diesen Vorgang nannten unsere Eltern poste. Im Saargebiet gab es den ähnlich klingenden Ausdruck „posse“. Es gab und gibt bei uns auch das Substantiv Poste, das aber den „Pfosten“ bezeichnet und mit poste nicht in Zusammenhang steht. Den Pfropfen als Flaschenverschluss nennt der Eifeler Stoppe (Stopfen). Mein Ohm Mattes hat seinerzeit einmal ein Edelapfelreis auf ein Holzapfelstämmchen jeposs (gepfropft). Das Ergebnis war eine etwas seltsame, aber wohlschmeckende Apfelsorte. Leider ging der junge Baum nach wenigen „fruchtbaren“ Jahren ein. Ein umgekehrter Versuch – Holzapfel auf Edelstamm – blieb erfolglos. Josef Ehlen (Hanne Jüpp) aus Nonnenbach, der Enkel des Heimatdichters Johann Ehlen (Klooße Hann), hat seinerzeit die Veredelung einer Birnensorte versucht und dabei ebenfalls eine ungewöhnliche, aber hervorragend schmeckende Frucht erreicht, Jüpp hat mich damals einmal „probieren“ lassen. Die beim Poste unvermeidbare „Wunde“ am lebenden Holz musste fachgerecht „verbunden“ werden, ansonsten starben beide Teile ab.
Pott
Ganz allgemein ist der Pott ein topfartiges Gefäß, mit dem Niederländischen verwandt: „Pot“ ist dort das Wort für „Topf.“ Auch unser Hochdeutsch kennt den Pott, als Umschreibung für ein großes Schiff beispielsweise oder in der Anwendung „Ruhrpott.“ Gängige Eifeler Pötte sind unter anderem der Kaffee-, Bloome (Blumen)-, Kauch (Koch)- und nicht zuletzt der Kamerpott, den man auch als Hutschpott (wörtlich = Hocktopf) bezeichnet. Für unsere Redewendung et wiëd jejeiße, wat op dr Desch kött (es wird gegessen, was auf den Tisch kommt) haben unsere Nachbarn in Holland den Begriff „eten wat de pot schaft“ (essen, was der Topf hergibt). Als Kinder nannten wir die weißen und braunen Isolatoren an den Strom- oder Telefonmasten Pöttcher (Töpfchen), sie waren beliebtes Zielobjekt beim Wettschießen der amerikanischen Besatzungssoldaten. Von einem schlagfertigen und redegewandten Mitmenschen behauptete man Dä hät op jede Pott ene Deckel, und wenn am „Tisch 17“ bei Krämesch Erwin am Kirmesabend munter gezecht wurde, hieß es Jung, die sen äwwer noch ens kräftich am pötte. Der Oberbegriff Pott wird bei uns je nach Form und Einsatzbereich unterschieden in Komp (großer Topf, etwa die Schüssel für den Kartoffelsalat), Schottel (große, meist flache Schüssel) und Döppe (Allzweckschüssel). Die Verkleinerungsformen sind Pöttche, Kömpche, Schöttelche und Döppche.
nach oben
zurück zur Übersicht
Pottloh
Pottloh ist eigentlich kein echtes Mundartwort, vielmehr die offizielle Bezeichnung für eine spezielle schwarze Graphitfarbe, hitze- und schmelzbeständig und damit insbesondere für den Anstrich gusseiserner Öfen geeignet. Es gibt regional auch den Ausdruck Pottlot, das ist unterdessen die Bezeichnung für „Graphit.“ Einmal im Jahr, meistens zur Kirmes, wurden im Eifelhaus der eiserne Kanonenofen und die Pief (Pfeife, hier = Ofenrohr) jepotloht (gepotloht, gestrichen). Manchmal wurde auch die Pief mit Silberbronze behandelt, das sah etwas vornehmer aus, fiel aber unter den Oberbegriff Pottloh. Das aufgetragene Pottloh war zunächst stumpf und unansehnlich, nach der Trocknung wurden die Flächen aber kräftig mit einer Bürste bearbeitet und dann glänzte der Ofen wieder wie neu. Die Graphitfarbe roch intensiv und penetrant, sie stank geradezu. Ganz besonders intensiv roch es beim ersten Anheizen nach dem neuen Anstrich. Der Geruch steckte nach dem Anstreichen mehrere Tage lang im ganzen Haus und verflüchtigte sich nur allmählich. Pottloh gibt es auch heute noch, es wird im Eifelhaus aber nicht mehr benötigt, – weil es dort keine eisernen Öfen mehr gibt.
Preßsack
Der Computer änderte zwar den Begriff automatisch in Presssack um, derartige Wortungetüme mag ich aber nicht, auch wenn die neue Rechtschreibung sie fordert, und so befahl ich dem PC kurzerhand, den Presssack zu korrigieren. Der Preßsack war ein weißes Leinentuch, mindestens einen Viertelquadratmeter groß, das über einen entsprechend großen Topf gespannt wurde und als Siebfilter für selbst hergestellten Fruchtsaft diente. Nach dem Abtropfen wurden die vier Zibbele (Tuchzipfel) zusammengefasst und aus dem im sackähnlichen Behälter verbliebenen Fruchtbrei durch Knedde (Kneten) der letzte Tropfen Saft heraus gepresst: Preßsack, der Entsafter unserer Kinderzeit. Der Preßsack hing dann noch stundenlang über einem Auffangbehälter am Deckenbalken, damit auch der allerletzte Safttropfen nicht verloren ging. Gern erinnere ich mich an den köstlichen Omberesaff (Himbeersaft), den unsere Jött daheim aus selbstgepflückten wilden Waldhimbeeren herstellte. Pur getrunken, war es ein geradezu himmlischer Genuss, leider wurde aber stets kräftig mit Wasser jelängk (gelängt = verdünnt), damit die kostbare Flasche nicht zu rasch leer wurde. Ein Glas Omberesaff war in der Regel eine Belohnung von Jött für unseren Einsatz beim schweißtreibenden Heu abladen (siehe: dämmele).
Promme
Hinter meinem Elternhaus in Schlemmershof standen in meiner Kinderzeit zwei mittlere Pflaumenbäume, einer davon trug Außpromme (Augustpflaumen = Frühobst). Bei jeder günstigen Gelegenheit „naschten“ wir Pänz vom verbotenen Baum – und wurden oft genug dabei erwischt. Die Hausregel schrieb bei uns vor: „Vom Baum gefallenes Obst, egal welcher Art, ist im Haus abzuliefern.“ So streng waren damals die Sitten, im Jahr 2014 habe ich eimerweise Pflaumen in den Kompost getan: Es war ein echte Pflaumenschwemme, an unserem Baum brachen fast die Äste, wir konnten nur einen Bruchteil verwerten – und kein Mensch wollte Promme haben, nicht einmal geschenkt. Prommetaat (Pflaumentorte) war früher ein selbstgefertigtes leckeres Festtagsgebäck, der standesbewusste Eifelbäcker stellt sie heute noch her. Jäeschtebrie mot Promme (Gerstenbrei mit Backpflaumen) war eine Köstlichkeit auf dem Mittagstisch. Jedresse Prömmche („geschissenes Pfläumchen“) ist eine ablehnende Antwort und ersetzt eigentlich das Götz-Zitat. Prommesaff (Pflaumensaft) ist ein erprobtes Hausmittel bei Verstopfungen, Promme fresch vam Boum (frisch vom Baum) tun unterdessen dieselben Dienste. Ein verschluckter Prommekeere (Pflaumenkern) kommt in der Regel nach einiger Zeit auf natürlichem Weg wieder an die frische Luft, und der Prommeschottisch war zur Zeit unserer Eltern ein beliebter gemütlicher Tanz beim Dorfball. In Lückerath (Stadt Mechernich) wird alljährlich die Meisterschaft im Pflaumenkern-Weitspucken ausgetragen.
Prommenallee (weiches o) Bild
Die „Pflaumenallee,“ ein Ur-Dörfer Wort, jedes Kind in Blankenheimerdorf kennt die Prommenallee. Es handelt sich um den befestigten Wirtschaftsweg nördlich der Ortschaft von der Brücke über die Umgehungsstraße bis zu Waldrand in Richtung Mürel (Flurbezeichnung). Der Wegrand ist einseitig mit Pflaumenbäumen bepflanzt, daher der Name. Allerdings ist Allee nicht ganz korrekt, wegen der nur einseitigen Bepflanzung wäre Halballee richtiger. Die Pflaumenbäume wurden in den 1950er Jahren unter Bürgermeister Johann (Schang) Leyendecker gepflanzt und mancher Spaziergänger hat sich an den leckeren Früchten gütlich getan. Etliche Bäume waren mit der Zeit dem Eifelsturm zum Opfer gefallen, Anfang Dezember 2011 wurde auf Veranlassung von Ortsvorsteherin Tanja Möllengraf Nachwuchs gepflanzt. Der Weg hieß bis zur Bepflanzung Karl Wagner-Weg im Gedenken an den Ortsbewohner Karl Wagner, der in den 1930er Jahren beim Kulturamt Adenau beschäftigt war und damals den Weg geplant und realisiert hatte. Hier und da wird fälschlicherweise der Ausdruck „Prummenallee“ verwendet. „Prumme“ ist Kölner Dialekt, der Eifeler sagt Promme.
Puddel
Regional ist gelegentlich Puddel und Pudel ein und dasselbe, nämlich ein „canis aquaticus,“ ein auf die Wasserjagd abgerichteter Hund, allgemein „Pudel“ genannt. Die Blankenheimerdorfer Puddel dagegen ist das lateinische „stagnum“ und damit eine Pfütze oder Lache. Besonders in der Südeifel bezeichnete man früher auch die Jauchegrube als Puddel, analog dazu war Puddel fahre das Ausbringen der Jauche auf die Felder und Wiesen. Puddel und Maar (unser Wort für Puddel) sind zeitnah angepasst und heißen heute „Gülle,“ stinken allerdings deshalb nicht weniger als früher. Boste wier durch de Puddele jetalep (Bist du wieder durch die Pfützen gelaufen) wetterte Jött beim Anblick unserer total „versifften“ Kinderschuhe und griff seufzend nach dem Schohkaaste (Schuhkasten, Schuhputzzeug). Auf unseren nicht befestigten Straßen und Wegen standen damals nach jedem Regen massenweise Puddele, deren braunes Schmutzwasser uns geradezu magisch zum Hineintreten reizte. Anlass zu Rügen und Meckern war auch die Puddel auf der Tischplatte, wenn wir mal wieder beim Kaffeetrinken jeschlabbert hatten. Puddelich war ganz allgemein ein Ausdruck für Unsauberkeit oder Nachlässigkeit, eine unordentlich gekleidete Frau beispielsweise war e puddelich Mensch. Vom Pudel hergeleitet war und ist allerdings auch bei uns puddelnass (wie ein begossener Pudel), desgleichen puddelnackich (nackt wie ein geschorener Pudel).
Pupp
Gelegentlich auch Pupps oder Püpp, ein etwas „anrüchiges“ Wort aus der Kindersprache mit der Bedeutung „hörbare Blähung,“ im deutschen Lexikon als „Furz“ deklariert. Auch der Erwachsene bedient sich des Pupp, wenn er sich „gemäßigt“ ausdrücken will: Ech moß ens ene Pupp losse entschuldigte sich beispielsweise einer aus der Skatrunde und begab sich aan de fresch Luff. Ein häufiges Kosewort für ein kleines „mobbeliges“ Kind war Puppsack, es gab sogar ein Wiegenlied, in dem die Mutter schloof du klejne Puppsack sang. Das vom Substantiv Pupp abgeleitete Verb ist puppe oder püppe. In einem alten Bierlied heißt es unter anderem puppe legg (leidet) och ad ens Nuët (Not), wä net puppe kann es duëd (tot). Tatsächlich kann der am natürlichen Abgang gehinderte Pupp beträchtliche Buchpeng (Bauchschmerzen) verursachen. In einer Nettersheimer Familie war es üblich, dass die Kinder sich vor dem Zubettgehen ihrer kleinen oder auch großen körperlichen Bedürfnisse entledigten, und dazu befahl die Mutter: Jepiss, jepupp, - de Trapp erop. Ausflüchte oder gar Widerreden waren indiskutabel und wurden einfach nicht geduldet.
nach oben
zurück zur Übersicht
|