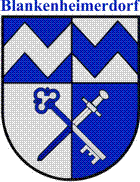|
Hääp
Die Hääp war und ist ein Handbeil mit einer gut 20 Zentimeter langen und etwa acht Zentimeter breiten Klinge, – die verkleinerte Ausgabe eines Fleischerbeils. Im Werkzeugkatalog wird das Gerät als „Heppe“ angeboten. Im Eifeler Alltag fand die Hääp vielfache Anwendung, sie eignete sich unter anderem bestens fürs Zurechthacken von Buchenästen zu Schanzen (Reisigbündel) für den Backofen. Auch zum Verkürzen von Roggenstroh als Stallstreu war die flache Klinge vorteilhaft, ebenso zum Anspitzen der Äezerieser (Erbsenreiser). Und wenn ein Huhn oder sonstiges Federvieh für den Kochtopf geschlachtet werden sollte, wurde aus der Hääp sogar ein Henkerbeil. Josef Franzen, der Besenbinder von Reetz, benutzte eine Hääp zum Stüppen (Kappen der Reisigspitzen) seiner Birkenbesen. Beim Handwerkermarkt in Blankenheim hatten sich Franze-Jüpp und der Monschauer Hahn (Traditionsfigur der Stadt Monschau) mit ihren Ständen am Museumsplatz etabliert. Mit finsterer Miene hielt Jüpp dem „Hahn“ seine Hääp vor die Nase: Wejste, wat dat os? Dat os en Hääp, on domot were bie os de Hahne jeköpp (…das ist eine Hääp, und damit werden bei uns die Hähne geköpft), worauf der „Hahn“ symbolisch die Flucht ergriff.
Hääpe
In den Dörfern unserer Eifelheimat besitzt jedes Haus einen ortsüblichen speziellen Namen, der auf alter Tradition, örtlichen Besonderheiten oder alteingesessenen Familien beruht. Unser Haus beispielsweise heißt seit eh und je aan Muuße, benannt nach dem früheren Besitzer Jakob Maus. Auch Hääpe ist ein Dörfer Hausname, ein weiterer Name desselben Anwesens ist Austengs. Die Herkunft der beiden Bezeichnungen konnte ich nicht ermitteln, Hääp ist ein altes Werkzeug (siehe Hääp). Das Anwesen Hääpe befindet sich im Ortsteil Ovverbaach in der Nähe des früheren Transformatorenhäuschens. Früherer Besitzer war der Eisenbahner Johann Klaßen, ortsüblich Hääpe Johann genannt. Austengs Hein war einer seiner vier Söhne, Hein wurde später mein sehr lieber Nachbar bei uns auf dem Kippelberg, leider mußte er schon mit 51 Jahren sterben. Hein war der geborene Humorist und unschlagbare Karnevalist nicht nur auf unserer Dörfer Bühne, wo immer er in die Bütt stieg, da tobte der Saal. Sein Bruder Hans, im Dorf allgemein nur die Hääp genannt, war Mitbegründer unseres Karnevalsvereins und langjähriger Sitzungspräsident der Gemötliche Dörfer. Er ließ sich auch in 1971 en Pläät schnegge (den Kopf kahl scheren) und stiftete die damit gewonnenen 100 DM der IG Wiesenfest Für Os Pänz. Eine Tochter der Klaßen-Familie, Sophie Pyka, war die erste Karnevalsprinzessin in Nettersheim, und Wolfgang Klaßen, der Jüngste aus dem Hääp-Haus, ist aus dem Karneval in Lommersdorf nicht wegzudenken.
haar
Das Wort entstammt der Fuhrmannssprache und bedeutet „her, herüber zu mir.“ Der Fuhrmann ging und geht links vom Gespann, haar ist also die Aufforderung, nach links abzubiegen. Das Gegenteil, also die Aufforderung „nach rechts,“ ist hott. Als Kind war mir die Verwechslung der beiden Begriffe lange Zeit ein großes Problem, das beispielsweise beim Weidefahren mit unseren Kühen unliebsam in Erscheinung trat. Die Tiere kannten die Befehle sehr genau und befolgten sie auf der Stelle, auch wenn sie aus Kindermund kamen. Früher durften Waldwege und nicht aufgeforstete Lichtungen beweidet werden. Das ging problemlos, auch wenn es völlig fremdes Gelände war. Vor Ort hieß es langgezogen ooh Jüü, haar eröm und die Tiere schwenkten nach links und begannen zu weiden. Wenn nun aber die Lichtung rechts vom Weg lag, blieb das Vieh offensichtlich „ratlos“ stehen, ging aber nicht unaufgefordert nach rechts. Hott on haar ist ein noch heute gängiger Begriff für eine konfuse Situation, in der beispielsweise dä Ejne net wejß, wat dä Annere well (der Eine nicht weiß, was der Andere will). Bie denne jing et noch ens hott on haar besagt, dass es da und dort wieder einmal drunter und drüber ging. Vater hatte seine Brille verlegt und lief hott on haar durch Huus on Werkstatt ohne sie zu finden. Ein ähnlicher Begriff wie hott on haar ist aauch geläufig: Erop on eraff (rauf und runter).
Häckselbank
Die Häckselbank war eine handbediente Maschine zur Zerkleinerung von Stroh, Mais oder anderem Viehfutter, sie besaß ein metergroßes Schwungrad mit zwei halbrunden Messern, das Schnittgut wurde über eine hölzerne „Bank“ an die Messer geführt, der Vorschub konnte durch ein Spanngewicht geregelt werden. Als wir unser Haus Muuße bezogen, fand sich in der Scheune eine verrostete alte Häckselbank, das Spanngewicht existiert noch, es wiegt etwa 15 Pfund. Ein junger Mann schleppte es seinerzeit als Gewicht von der Wasserwaage auf eine Baustelle im Ort (siehe unter Tuppes). Das Bedienen der Häckselbank erforderte Geschick und Muskelkraft, ähnlich wie bei der Kolerawemöll (Rübenschneider) federte nämlich das Schwungrad bei falscher Handhabung zurück und der massive Schwengel (Kurbel) donnerte schmerzhaft auf die Maschinistennase. Wir daheim besaßen keine Häckselbank, wir hackten das Stroh mit einem alten Zimmermannsbeil auf die gewünschte Länge zurecht. Mit diesem Beil als „Tomahawk“ erlegte einer der amerikanischen Besatzungssoldaten durch gezielte Würfe mehrere unserer unschuldigen Hühner, die unsere Jött dann auch noch braten musste.
Hahnebrochs Schäng
Er hieß mit richtigem Namen Johann Reetz, war Allroundman und ein Dorforiginal und wohnte mit seiner Familie zuletzt in der ahl Scholl (alte Schule) gegenüber dem Hotel Friesen. Sein Elternhaus stand am Standort des heutigen Kaufhauses Bell, der ortsübliche Name war aan Hahnebrochs. Schäng war der letzte Feldhüter von Blankenheimerdorf (bis zur kommunalen Neuordnung 1969). Viele Jahre lang stellte er in aller Herrgottsfrühe im Dorf die Tageszeitung zu, wenn ich um 4,30 Uhr morgens zum Frühdienst fuhr, war er schon unterwegs und reichte mir die Zeitung durchs Autofenster. Bis zur Schließung der örtlichen Müllhalden Mitte der 1970er Jahre, beaufsichtigte Schäng dort das Abladen und machte 1972 als „Der Mann im Schrank“ von sich reden: Auf der Blankenheimer „Wallbach-Deponie“ verkroch er sich bei Regenwetter in einen alten Schrank, bis ihm die Gemeinde eine ordentliche Behausung beschaffte. Zu seiner Alltagsausstattung gehörten Gummistiefel und Flätschkapp (Schiebermütze), je nach Witterung auch eine warme Strickmütze. Selten sah man ihn ohne diese Kleidungsstücke. Hahnebrochs Schäng starb am 23.10.1977 im Alter von 72 Jahren.
Halefe
Aan Halefe hieß bis 1957 das Anwesen Schmitz/Brück gegenüber der Schule. Die älteren Dorfbewohner erinnern sich noch: Die Giebelfront des Gebäudes ragte meterweit in die Ortsdurchfahrt – damals B. 258 – hinein, die Straße machte geradezu einen Bogen um Halefe Jewwel (Giebel). Beim Ausbau der OD wurde Alt-Halefe abgerissen, an dieser Stelle befindet sich heute der Jean Leyendecker Platz. Halefe Johann (Schmitz), der Hausbesitzer, war bei der Bundesbahn beschäftigt und in seiner Freizeit aktiv im Junggesellen- und Theaterverein tätig. Die Laienspieler boten noch lange nach dem Krieg alljährlich zum Antunniusfess (17. Januar, Fest des heiligen Antonius) eine Theateraufführung. Man erinnert sich noch sehr gut an Halefe Johann, wenn er mit seiner markanten Stimme auf der Bühne den heiligen Paulus zitierte: Tod, wo ist dein Stachel. Der Junggesellenverein unter Halefe Johann hat seinerzeit auch eine neue Kirchenglocke beschafft. Der „Halfe“ war früher der Halbbau-Pächter eines Herrenhofes, er hatte die Hälfte des Ertrags aus seiner Landwirtschaft dem Herrn als Pacht abzuliefern, daraus leitete sich die Bezeichnung „Halbmann“ oder auch „Halfe“ ab. Die Halfen waren in der Regel gut situierte und wohlhabende Leute.
Halefjehang
Die Übersetzung lautet „Halbgehänge“ und ergibt keinerlei Sinn, trotzdem ist das Wort auch heute noch im Dialekt häufig anzutreffen. Ein Halefjehang ist ein Mensch, der auf sein Äußeres keinen oder nur wenig Wert legt, der seine Kleidung vernachlässigt und von Körperpflege wenig hält. Ausgefranste, eingerissene und durchlöcherte Jeanskleidung ist heute bei manchen Zeitgenossen „in“ und wird stolz zur Schau getragen. Unsereiner fragt sich, was wohl in den Köpfen solcher Leute vor sicht geht. Unsere Eltern hätten sie in die Kategorie Halefjehang oder Bookert (Vogelscheuche) eingestuft. Mit Halefjehang beschreiben wir das äußere Erscheinungsbild eines Menschen, egal ob Mann oder Frau oder Kind. Eine schmächtige, abgemagerte Person, eine Jammergestalt, ist ein Halefjehang. Eine recht treffende Beschreibung liefert uns ein Kölner Mundartlied mit dem Titel „Wenn doch emmer Chreßdaach wör.“ Dort werden zunächst die Freuden einer „Dauerweihnacht“ geschildert, dann aber zeigt der Texter die Nachteiler einer solchen Situation auf, unter anderem heißt es: Et Bäumche fing ze nodle aan, on stünd do wie e Halefjehang.
Hällef
Verschiedentlich auch Hellef, verwandt mit dem holländischen „helft.“ Wieder ein Eifeler Wort mit doppelter Bedeutung. Die Hällef ist schlicht und einfach die Hälfte: De Hällef van fönnef os zweienhallef (Die Hälfe von fünf ist zweieinhalb). Die Mehrzahl ist Hällefte (holländisch „helften“): Die Schoklad (Schokolade) wiëd en zwei Hällefte opjedejlt. Der Eifeler kannte unterdessen auch dat Hällef und das hatte mit einer Hälfte absolut nichts gemeinsam. Dieses „neutrale“ Hällef war ein Werkzeugstiel, vornehmlich der Axtstiel, das Axenhällef. Stiele fertigte man früher selber an oder ließ sie beim Dorfschreiner herstellen. Ich selber habe in Vaters Werkstatt jede Menge Axenhällever fertigen müssen. An Hand einer Schablone (die gibt es heute noch) wurde der Rohling von Hand mit der „Schweifsäge“ (überdimensionale Laubsäge) aus einer Eschenholzbohle heraus gesägt und mit Schabhobel und Raspel bearbeitet. Axenhällever herstellen war eine mühsame und wenig einträgliche Beschäftigung, deshalb musste ich mich frühzeitig damit befassen. Die Zeit des Meisters oder Gesellen war zu kostbar für derartig minderwertige Arbeiten.
hallije
Wer außer Atem geraten ist und keuchend nach Luft ringt, der ist am hallije. Die Wortbildung hängt möglicherweise mit „inhalieren“ zusammen. Ein Begriff mit ähnlicher Bedeutung ist jappe, was soviel wie „nach Luft schnappen“ bedeutet. Während jappe mehr oder weniger einen Zustand beschreibt – Et os esu hejß dat de Kroohe jappe (Es ist so heiß, dass die Krähen nach Luft schnappen) – ist hallije meistens das Resultat einer schweren Anstrengung. In der ersten Julihälfte 2015 beispielsweise jappten de Kroohe und nicht zuletzt auch die Menschen bei fast 40 Grad im Schatten. Beim Baumfällen musste häufig ein „Hänger“ (am Fallen gehinderter Baum) mit Hebeln vom Stock gehoben und zu Boden gebracht werden. Das war Schwerarbeit und die Böschmänn (Waldarbeiter) gerieten en et Hallije (Keuchen). Beim Hundertmeterlauf geraten die Athleten außer Atem, sie sind am hallije. Der Hund, der ununterbrochen den Ball apportiert, ist nach kurzer Zeit ebenfalls am hallije (hecheln). Beim Heimtrieb von der Weide war die Kuh ausgerissen, Hermännche fing sie mühsam wieder ein und kam all Hallijens (außer Atem) zu Hause an.
Halspeng (weiches e)
Aus zwei Substantiven zusammengesetzt: Hals und Peng, bedeutet der Mundartausdruck also Halsschmerzen (Peng ist unser Wort für Schmerzen insgesamt). Als Kinder hatten wir daheim alle naselang Halspeng, Mandelentzündung und Schluckbeschwerden zum Verzweifeln, ganz allgemein hieß das ech han et em Hals (wörtlich: ich habe es im Hals). Manchmal wurde eine richtig böse Angina daraus und der Dokter mußte ein Antibiotikum verschreiben. In den meisten Fällen aber half die Anwendung althergebrachter Hausmittel, wir Pänz (Kinder) mussten trotz unserer Halspeng zur Schule gehen. Es gab eine ganze Menge an Hausmitteln und auch unsere Jött (Tante Elisabeth) kannte etliche davon. Einige dieser „Kuren“ sind sogar heute noch hier und da gebräuchlich. Da gab es unter anderem Halswickel aus frisch gekochten und noch heißen Kartoffeln, oder auch aus selbstgemachtem Klatschkäs (Speisequark). Ein weiterer Halswickel wird heute etwas mitleidig belächelt, ich selber bin aber der lebende Beweis dafür, dass er zumindest in meiner Kindheit funktionierte: Ein tagsüber getragener Strumpf wurde vor dem Zubettgehen um den kranken Hals gewickelt, am nächsten Morgen war die Halspeng nur noch halb so schlimm, und am zweiten Tag war sie in aller Regel völlig verschwunden. Interessante Tatsache: Bei uns daheim durfte es aus unerfindlichen Gründen immer nur der linke Strumpf sein, der Rechte half tatsächlich nicht, ich habe es am eigenen Leib erlebt. Das war zwar eine ziemlich mysteriöse und auch wenig hygienische „Halskur,“ aber sie half, und das allein zählte. Warum sie half, – vielleicht wissen es unsere Mediziner? Damals trugen auch wir Jungens lang Strömp (lange Strümpfe) und die ließen sich gut als Halswickel verwenden, die heutigen zentimeterbreiten Söckchen reichen höchstens für den kranken Daumen.
Hängel
Die Jack jehüët aan et Mantelbrett, wofür mejnste dat do ene Hängel draan wär! Wörtlich übersetzt hieß diese Mahnung: „Die Jacke gehört an die Garderobe, wofür meinst du, dass da ein Aufhänger dran wäre“! Mit Hängel bezeichnete man den Aufhänger an Kleidungsstücken oder sonstigen Textilien. Das Handtuch beispielsweise besaß einen Hängel, der Waschlappen, das Spültuch, der Topflappen. Der Hängel, ein schmaler Tuchstreifen, war aufgenäht, konnte leicht abreißen und Jött (Tante) wetterte: Dä Hängel oß affjerosse, kannste net oppasse! Der Ausdruck Hängel ist auch heute noch regional gebräuchlich. Bei der Hausschlachtung wurden früher oft die fertigen Schweinehälften zum Auskühlen in der Scheune an einer schräg gestellten Leiter aufgehängt, bis der Metzger kam, um das Fleisch zu zerlegen und im großen Holzbottich einzusalzen. Als einmal bei uns Baalesse Thuëres (Theo Baales, der Hausschlachter) die Schlachthälften ophange (aufhängen) wollte, gab mir das zu denken und ich fragte bei Mam nach: Os dann aan der Sou och ene Hängel dran? Der Hängel ist nicht identisch mit dem Henkel etwa an Krug oder Tasse, den nämlich nannte man in Blankenheimerdorf de Henk.
Häns
Eine von zahlreichen Abwandlungen des Männernamens Johannes. Neben dem offiziellen Johannes und Johann war und ist bei uns im „Dörf“ die Form Häns besonders häufig anzutreffen. Da war beispielsweise Hammesse Häns (Hans Hammes), der nach dem Krieg eine Kfz-Werkstatt führte und später den Oberkreisdirektor im Dienstwagen durch den Kreis Euskirchen chauffierte. Da war auch Austengs Häns (Hans Klassen, die „Hääp“), der sich für 100 DM en Pläät schnegge (einen Kahlkopf scheren) ließ und das Geld dem Wiesenfest spendete. Irgendwann in den 1960er Jahren feierten wir mit sage und schreibe 15 „Johannessen“ an einem 24. Juni bei Krämesch Erwin unseren Namenstag. Organisiert hatte das Treffen unser Kartellvorsitzender Johannes („Klobbe“) Friederichs in einer spontanen Aktion, nachdem sich zufällig an diesem Tag vier Hännesse bei Erwin begegnet waren. Daraus ergab sich der Vorschlag, umgehend alles in die Kneipe zu beordern, was im Dorf Johann oder Jöhann, Hans oder Häns, Johannes, Schäng, Schang, Jannes oder Jännes hieß. Da machten auch einige Dorfsenioren mit, aus Spaß an der Freud. Ich meine mich zu entsinnen, dass sogar unser Bürgermeister Johann „Schang“ Leyendecker für ein Stündchen erschien. Ich selber kam zufällig mit meinem „Glas 1204“ zum Tanken gegenüber der Kneipe bei Hammesse Hein. Die Hääp erspähte mich durchs Fenster und komplimentierte mich an die Theke. Dabei hatte ich meine Groschen restlos „vertankt“ und keinen roten Pfennig mehr in der Tasche. Das war aber belanglos: Erwin machte selbstredend „einen Deckel.“ Das war eine ziemlich fröhliche Angelegenheit damals.
Hans Muff
Wenn es zu unserer Kinderzeit auf den 6. Dezember zu ging, waren wir die bravsten Pänz von der Welt. Am Vorabend nämlich kam der Nikeloos (Nikolaus) und vor dem, mehr noch vor seinem schwarzen Begleiter Knecht Ruprecht, der bei uns Hans Muff genannt wurde, hatten wir mächtigen Respekt. Er schleppte zwar als Diener des Nikolaus die Geschenke für die braven Kinder herbei, er war aber auch befugt, im Auftrag des Heiligen Mannes böse Kinder in den schwarzen Sack zu stecken oder Rutenhiebe auszuteilen. Waat nur, bos dr Nikeloos kött (warte nur, bis der Nikolaus kommt) lautete in der Vorweihnachtszeit eine häufige Elternwarnung, die wir uns auch gut hinter die Ohren schrieben. Hans Muff ist eigentlich die Bezeichnung für einen mürrischen und unfreundlichen Menschen, im übertragenen Sinne also der „Böse,“ der seinerseits allerdings unter der Herrschaft des Guten (Nikolaus) steht. Diese etwas bedenkliche Erziehungsmethode unserer Eltern war unterdessen wenig effektiv: Kaum war der Nikolaustag vorbei, waren alle guten Vorsätze vergessen, hatten wir doch ein ganzes muffreies (mufffreies, fürchterlich!) Jahr vor uns. Im Jahr 2011 feierte das Nikolausgespann von Blankenheimerdorf ein beachtliches Jubiläum: Ludger Schneider war 30 Jahre im Nikolausamt, sein Begleiter Wilfried Meyers trug schon seit 42 Jahren das schwarze Muff-Kostüm. Die Beiden waren bis 2013 „im Dienst“ und bei ihrer Kundschaft beliebt, Wilfried starb leider im April 2014 mit nur 69 Jahren.
Harel
In den frühen Nachmittagsstunden des 22. Juli 1950 (Samstag) ging über Blankenheimerdorf ein Hagelunwetter nieder, wie es das Dorf noch nie erlebt hatte und wie es sich seitdem auch nicht mehr wieder ereignet hat. Esu ene Harel han mir noch nie jehatt (einen solchen Hagel hatten wir noch nie) stellten selbst die ältesten Dorfsenioren fest. Was da vom Himmel fiel und die gesamte Ernte vernichtete, das waren hühnereigroße Klumpen und scharfkantige Eisschollen von der Größe einer Kinderhand, die einen Menschen hätten erschlagen können. Mit dem Begriff Harel verbinden wir in jedem Fall negative Vorstellungen, und das kommt in verschiedenen Redensarten zu Ausdruck. Ein sinnlos Betrunkener beispielsweise ist sternharelvoll, gegen eine unbeliebte Anordnung harelt et Protest, bei einer wilden Prügelei fliegen gelegentlich die Fetzen dat es harelt on dämp (dass es hagelt und qualmt), und wer ein griesgrämiges Gesicht schneidet, dem hat es meistens en de Zupp jeharelt (die Suppe verhagelt). Und schließlich besagt eine alte Bauernweisheit: Wenn es in die Suppe hagelt, ist das Dach wohl schlecht genagelt.
Harjeschier
Das Dengelwerkzeug des Sensenmähers, bestehend aus dem Harstock (Dengeleisen, kleiner Amboss) und einem geeigneten Hammer mit kurzem Stiel, der ein „gefühlvolles“ Sänselkloppe (Dengeln) ermöglichte. Das nämlich war oberste Voraussetzung für eine hauchdünne Bahn an der Sensenschneide. Die perfekt gedengelte Schneide ließ sich mit dem Daumennagel wölben, das war ein Kriterium für gute Arbeit und scharfes Werkzeug. Auf diese Sensenprüfung ist der Begriff Nagelprobe zurückzuführen. Der Dengelhammer war das Heiligtum des Schnitters, er durfte für keine andere Arbeit eingesetzt werden, um Beschädigungen der „Bahn“ (Der Hammerboden heißt offiziell „Bahn“) zu vermeiden. Der Mäher führte das Harjeschier bei der Arbeit mit sich, um im Bedarfsfall eine Schadstelle an der Sensenschneide rasch ausdengeln zu können. Schon ein leichter Schnitt durch einen Seckoomessehouf (im Gras verstecktes Ameisennest) ließ die Sensenschneide stumpf werden. Hier halfen noch ein paar Striche mit dem Schliefstejn (Wetzstein, siehe Schlotterfass), der harte Stengel einer Wiesendistel dagegen konnte schon ernsteren Schaden anrichten, der dann mit dem Harjeschier wieder „herausgedengelt“ wurde. Haren ist das holländische Wort für „dengeln, schärfen.“ Ein Harjeschier findet man heute bestenfalls noch im Museum, wie auch die Sense, zu der es gehört.
nach oben
zurück
Harstock
Das Harjeschier (Hargeschirr) war das Dengelgerät des Sensenmähers (siehe Harjeschier), der hier erwähnte Harstock ist ein Teil dieses Werkzeugs, nämlich der Amboss zum Ausdengeln der Sensenschneide. Der Harstock geht auf das holländische haren (dengeln) zurück. Den Harstock gab es in den unterschiedlichsten Ausführungen, zwei Formen waren generell im alltäglichen Gebrauch: Der Flachamboss mit flachem, etwa vier Quadratzentimeter großem Auflagetisch, und den Spitzamboss mit etwa drei bis fünf Millimeter breiter Auflagefläche. Im ersten Fall wurde mit der Finne (spitzer, dünner Teil) des Hammers geschlagen, wobei die Unterseite (Gleitfläche) des Sensenblattes auf dem Amboss auflag. Beim Spitzamboss lag die Dengelseite des Werkzeug auf und geschlagen wurde mit der Hammerbahn (flacher Teil, im Volksmund auch Aasch genannt). Das Resultat war in jedem Fall eine hauchdünne Dengelbahn, die eigentliche Sensenschneide. Oberstes Gebot beim Sänzel kloppe (Sense klopfen = dengeln) war ein standfester und nicht federnder Harstock. Zu diesem Zweck war das untere Ende des Gerätes angespitzt und konnte in einen Holzblock oder Ähnliches eingeschlagen werden. Ich selber klemmte den Harstockfuß in unseren starken Schraubstock, das ging auch ganz gut und ich dengelte im Stehen. Daheim schlug Ohm Mattes das Eisen in den festen Schuppenboden ein, hockte sich dahinter auf einen alten Sack und dengelte im Sitzen. Harstock und Hammer waren in der Regel durch eine unterarmlange Schnur miteinander verbunden und konnten so bequem über der Schulter getragen werden. Der Mäher nämlich nahm das Werkzeug mit auf die Einsatzstelle, um eventuelle leichte Beschädigungen der Sensenschneide sofort vor Ort beheben zu können.
hartdressich (weiches e)
Ein etwas „fieses,“ aber nicht anstößiges Wort, das unterdessen eine peinliche und auch peinvolle Situation beschreibt: Verstopfung bei Mensch oder Tier. Das gängige Dialektwort für die Darmausscheidungen ist Dress (weiches e), wer mit Hartdressigkeit zu kämpfen hat, ist ob dieses Zustands nicht zu beneiden. Selbstverständlich haben auch Tiere mit diesem Leiden zu tun. Daher stammt beispielsweise die Redewendung Du määß e Jesiëch wie ene hartdressije Hond, wenn jemand ein leidendes Wesen an den Tag legt. Ein Unterbegriff mit ähnlicher Bedeutung ist hartlievich (hartleibig), und damit bezeichnen wir gelegentlich einen begriffsstutzigen Menschen, dem man alles dreimal erklären muss: Boßte nu esu hartlievich oder dejste nur esu (Bist du nun so schwer von Begriff oder tust du nur so), und wenn einer eigensinnig oder uneinsichtig ist, so wirft man ihm vor: Bos net esu hartlievich on hüer wat ech dir sare (Sei nicht so stur und höre auf meine Worte). Im Auftrag meiner Zeitung besuchte ich seinerzeit den Jugendzeltplatz Alendorf, wo sich gerade eine Gruppe aus Sötenich aufhielt. Im abseits gelegenen „Herzhäuschen“ hing eine riesenhafte eiserne Kneifzange an der Bretterwand und die Lausbuben erklärten mir: Die ist zum Abpitschen, wenn es einmal zu hart ist. Sie hatten also für einen eventuellen Fall von Hartdressichkeit vorgesorgt.
Hasebruët
Hasenbrot, ein verbreitetes Wort für Butterbrote, die am Arbeitsplatz nicht verzehrt und wieder mit heim gebracht wurden. Sie waren naturgemäß ausgetrocknet und hart, heute würde man sie samt Belag in die Biotonne tun. In der Regel waren die Brote in Schneddepapier (pergamentartiges Butterbrotpapier) eingewickelt, dem die geschmolzene Butter arg zusetzte, das aber immer wieder verwendet wurde, bis es schließlich an den Faltkanten brüchig und „undicht“ wurde. Zu unserer Kinderzeit war Hasebruët beliebt, hatte es doch dr Has dem Vater oder Onkel auf der Arbeitsstelle als Leckerbissen für uns Kinder mitgegeben. Eine andere Wortdeutung ging davon aus, dass man mit hartem Brot die Hasen (Kaninchen) füttert. Diese Erklärung war aber für uns Pänz kein Anreiz zum Verzehr der trockenen Schnitten, kam also nicht zur Anwendung. Bei uns wurde kein Nahrungsmittel weggeworfen oder „entsorgt“, als Tierfutter war es in jedem Fall verwendbar. Hasebruët oder Haseklie (Klee) hieß bei uns daheim auch der Sauerklee, der in der schattenreichen Hardt flächenweise gedieh und dessen sauer schmeckende Blättchen wir wie den Sauerampfer roh verzehrten. Den Hasenklee gibt es tatsächlich, der Sauerklee gehört zu dieser Gattung.
Haseströpper
Es war anfangs der 1950er Jahre. Damals unternahm ich gelegentlich bei entsprechender Witterung ausgedehnte Skiwanderungen rund um Blankenheimerdorf. Einmal folgte ich einer einsamen Skispur durchs Hassendall (Flurname) und stieß auf dem Kosterberg unvermittelt auf eine Drahtschlinge, die da im Gebüsch über einem Hasepädche (Hasenpfad, Hasenwechsel) hing. Ich wurde darauf aufmerksam, weil hier der Skifahrer Halt gemacht hatte. Ein Haseströpper! (Ströpper = Schlingenleger). Leichtsinnigerweise nahm ich die Schlinge mit und zerschnitt sie daheim. Wie leicht hätte ich da selber in Verdacht geraten können! Ich hätte die Sache dem Förster melden müssen. Am Rand eines kleinen Eifeldörfchens lebte Hasenmattes, von dem selbst der Förster wusste, dass er ein eifriger Haseströpper war, es gab aber keine Beweise. Einmal zappelte im Garten hinter dem Haus ein handfestes Langohr in der Drahtschlinge. Vom Fenster aus bemerkte Mattes zufällig im nahen Haselbusch eine Gestalt, griff sich eine schlanke Jusch (Rute, Gerte) und stiefelte in den Garten. Dort zog er dem Gefangenen ein paar deftige Juschenhiebe über den Balg, löste ihn aus der Schlinge und ließ ihn laufen. In wilden Sätzen flüchtete Meister Lampe durchs Loch im Lattenzaun, während Mattes ihm hinterher schrie: Dir weren ech helefe, mir dr Kappes ze klaue (Dir werde ich helfen, mir den Kohl zu stehlen). Es heißt, der Förster sei seitdem nie mehr in einen Haselbusch gekrochen.
Haustock
Der Haustock wird gelegentlich mit dem Harstock verwechselt. Beide Geräte haben zumindest eine gleichgelagerte Ambossfunktion: Auf dem hölzernen Haustock wird Brennholz gespalten, auf dem eisernen Harstock wird de Sänßel jeklopp (die Sense gedengelt). Der Haustock war eine etwa 80 Zentimeter lange, aus einem Buchen- oder Eichenstamm herausgeschnittene „Rolle“ mit wenigstens 40 Zentimetern Durchmesser. Bevorzugt nahm man das Erdenn (wörtlich: Erdende = Bodenstück) des Stammes als Haustock, weil es durch den Wurzelansatz eine größere Standfläche besaß. Durch die unzähligen Axthiebe beim Holzspalten, zerklüftete mit der Zeit die Arbeitsfläche, die Werkstücke verloren ihre Standfestigkeit und kippten nicht selten um. Die Arbeit an einem solchen Haustock war gefährlich. Durch Ansägen einer neuen Arbeitsfläche wurde zwar abgeholfen, der anfangs tischhohe Stock wurde aber immer niedriger und musste schließlich ersetzt werden. Holzhacken war schon als Kind meine Lieblingsarbeit, ich besaß daheim einen eigenen kleinen Haustock und ein handliches Beil. Die Erwachsenen lästerten manchmal: Paß op, hau dech net op de Zong (Paß auf, hack dir nicht auf die Zunge), und das ärgerte mich gewaltig.
Hawer
Der Hafer wird in unserem Dialekt weiblich: Die Hawer. Jeder Eifeler Kleinlandwirt baute früher alljährlich ein Hawerstöck (Haferfeld, Acker) an, dessen Ertrag als Winterfutter für die häusliche Hühnerschar diente. Haferkörner waren bei den Eierproduzenten höchst beliebt, die Tiere pickten sie uns Kindern aus der Hand. Haferprodukte sind in der heutigen Nahrungsindustrie recht bekannt: Kekse, Flocken, Plätzchen, Grütze, Schleim, Mehl. Und als Kraftfutter für die Pferde ist Hawer geradezu unverzichtbar. Im Vergleich etwa zum Roggen ist Haferstroh relativ weich und geschmeidig, Hawerstrüh galt somit auch als hervorragendes Tierfutter und wurde auch begehrlich gefressen. Im Krankenhaus erhielt ich nach einer Woche Intensivstation als erste Nahrung Haferschleim, - den habe ich nach dem ersten Schluck beiseite gestellt, obwohl ich Hunger verspürte, Hawerschliem ist mir seitdem ein Horror. Dabei ist die Hawer sogar in der Medizin zumindest als Vorbeugungsmittel bekannt, beim Magen- und Darmerkrankungen beispielsweise, bei Aderverkalkung oder bei Hautproblemen. Und beim Diabetes Mellitus II soll Hawer tatsächlich den Insulinbedarf des Patienten drastisch senken. Hawerkaaf, die beim Dreschen anfallende Spreu, ist gleichermaßen als Tierfutter beliebt, und unsere Eltern gaben zum Schlafen einem Kaafsack den Vortritt vor der regulären Matratze. Ohm Mattes (mein Onkel) hat zeitlebens auf einem solchen Hawerkaafsack geschlafen, in seiner Kammer roch es stets etwas eigenartig. Haferspreu war wegen ihrer Weichheit als Kaafsackfüllung bevorzugt. Von einem übermütigen oder aufgeregten Menschen sagen wir dä stich de Hawer (den sticht der Hafer). Das geht auf den Kaafsack zurück: Ein gehässiger Mitmensch hatte in den Schlafsack des Betroffenen harte Roggen- oder Gerstenspreu gefüllt, und deren scharfe spitze Grannen (Ährenborsten) hatten sich durch den Sackstoff hindurch in die Haut des Schläfers gebohrt. Da soll sich einer nicht aufregen!
Hawerjeschier
Eine spezielle Sense für die Getreideernte. Als „Hafergeschirr“ war das Gerät im gesamten Rheinland bekannt, es wurde regional auch Sicht oder Reff genannt. Das Hawerjeschier besaß über und hinter dem Sensenblatt eine Art Auffangkorb für die geschnittenen Halme, die dadurch ohne umzufallen aufrecht gegen das noch stehende Getreide oder auch auf den Boden abgelegt werden konnten. Letzteres war bei kleinwüchsigem Schnittgut erforderlich, bei Gerste etwa oder beim Buchweizen. Die Arbeit mit dem Hawerjeschier erforderte Übung und kräftige Armmuskeln. Es gab zwei Bauarten: Das Zinkenreff mit langen, der Sensenkrümmung entsprechend gebogenen Holzzähnen über dem Sensenblatt und einem gitterartigen Auffanggestell, und d s Bogenreff mit einem tuchbespannten Auffang, der über das halbe Sensenblatt hinweg reichte. Für das Hawerjeschier war ein spezieller Wurf (Sensenstiel) erforderlich, örtlich auch Worf oder Warf genannt, auf dem das Reff befestigt wurde. Wurf und Reff wurden beim Stellmacher angefertigt oder in speziellen Werkstätten für landwirtschaftliche Geräte gekauft. Unser Hawerjeschier daheim war ein Zinkenreff ohne Tuchbespannung.
Heckebock (weiches o)
Wörtlich „Heckenbock“, - eine sehr treffende Bezeichnung für die Zecke. Die bekannteste Zecke nämlich ist der „Holzbock“. Wenn bei uns Pänz in der Kinderzeit irgendwo am Körper ein schwarzer Punkt auftauchte und jämmerlich juckte, war es mit Sicherheit ein Heckebock, den Mam „abpflückte“ und die Bißstelle mit ein wenig ungesalzenem Schweineschmalz bestrich. Der nahe Wald war unser Tummelplatz und wir fingen uns alle naselang einen Heckebock ein. Da gab es beispielsweise in Sichtweite meines Elternhauses auf dem Krohhöwwel (Flurbezeichnung, wörtlich = Krähenhügel) ein mit mehr als mannshohem Ginster bewachsenes Areal, etwa einen halben Hektar groß, das sich hervorragend fürs Sööke spelle (Suchen spielen = Versteckspiel) eignete. Hier wimmelte es geradezu von Heckeböck. Im Sommer, wenn der Strohvorrat aus dem Vorjahr aufgebraucht war, gab es bei uns meistens einen Berg Strau vor dem Haus, - Stallstreuersatz aus Heidekraut und Waldbeersträuchern. Dieser relativ weiche Strauhaufen war nicht nur bei uns Pänz ein beliebter Tummelplatz, hier fühlten sich auch massenweise Heckeböck wohl. Die Zecken gehörten damals sozusagen zu unserem Alltag, manchmal fanden sich sogar zwei oder gar drei dieser Blutsauger an unserem Körper. Krank geworden ist nie einer dadurch. Offensichtlich war die Zecke unserer Kinderzeit weniger jeftich (giftig, aggressiv) als heute.
Heer
Wie im Hochdeutschen gesprochen, bezieht sich das Wort auch im Dialekt auf die Streitmacht, eben das Heer. Ist dagegen das e kurz und hart, wie beispielsweise in „sehr,“ dann steht unser Heer für das hochdeutschen „Herr.“ Im Eifeldorf gab es generell einen einzigen Herrn, nämlich den Pastor, dem man mit dem Titel dr Heer die gebührende Hochachtung zollte: Dr Heer hät höck äwwer noch ens richtich schön jepreddich lobten die Leute die Sonntagspredigt des Seelenhirten. Und häßte dem Heer och alles jebich (hast du dem Pastor auch alles gebeichtet) lautete eine strenge Elternfrage. Lehrer, Bürgermeister, Arzt oder Jagdpächter hätten aufgrund ihrer Stellung im Dorf eigentlich auch Heere (Herren) sein müssen, doch wurde hier dr Lehrer, dr Bürjermejster, dr Dokter, dr Jaachpäächter bevorzugt angewandt. Ein Mitarbeiter der Verwaltung oder des Gerichts war dagegen ene Heer vam Amp oder vam Jerich, und ein gut gekleideter Fremder war en fenge Heer (ein feiner Herr). „Lieber Gott“ ist ein häufiger Stoßseufzer, bei uns hieß das früher O leeven Heer, und ein altes Sprichwort besagt Wo dr Heer en Kirch hät, bout dr Düwel en Wietschaff (Wo Gott eine Kirche besitzt, baut der Teufel eine Kneipe).
Heere Brand
Bei den älteren Einwohnern von Blankenheimerdorf ist der heutige Standort der Bäckerei Bell in der Ortsmitte noch als Heere Brand bekannt. Am 28. Juni 1932 zerstörte ein Brand an dieser Stelle das Anwesen von Josef Hoffmann, die zehnköpfige Familie wurde obdachlos. Der ortsübliche Hausname war Heere, die Brandstätte an der Einmündung der Straße Kippelberg in die Nürburgstraße erhielt ob des Unglücks die Bezeichnung Heere Brand. Wegen der dichten Bebauung dieses Ortsteils, bedeutete der Brand eine enorme Gefahr. Damals wie heute war unterdessen unsere Feuerwehr eine leistungsstarke Truppe, der es unter Führung von Manns Pitter (Peter Schlemmer) gelang, die rund um das Haus Heere liegenden landwirtschaftlichen Gebäude und Wohnhäuser der Familien Breuer, Reetz und Weber vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen, - eine enorme Leistung angesichts der damals noch recht „dürftigen“ Ausrüstung der Wehr. Ein bedeutender Gefahrenpunkt waren die noch weitgehend mit Stroh gedeckten Gebäude, die bei einem Brand nicht selten zur Vernichtung ganzer Ortsteile führten. Beim Großen Brand von Nonnenbach beispielsweise, wurden am 01. August 1905 vier Anwesen im Unterdorf völlig vernichtet. In Blankenheimerdorf baute Heere Juësep (Josef) am Ortseingang aus Richtung Blankenheim-Wald ein stattliches neues Haus.
Heffe
Im Supermarkt muß man schon genauer hinschauen, um die kleinen, nur wenige Gramm wiegenden Päckchen zu entdecken: Backhefe. Wenn der Kirmesback bevorstand oder neuer Dejßem (Sauerteig) für unser Roggenbrot erforderlich war, musste die hierbei unverzichtbare Heffe gekauft werden. Backhefe gab es im Dorfladen, beispielsweise an Jierdrögge (auch Katze, damals Geschäft Schmitz) in Blankenheimerdorf) für ein paar Pfennige zu kaufen. Für ene Jroschee Heffe war in den meisten Fällen die Einkaufsmenge, die Portion wurde aus dem großen Dejßemspott (Sauerteigtopf) abgewogen. Wir Kinder kosteten ab und zu ein wenig von der käseartigen Masse, es schmeckte ziemlich seltsam. Was gab und gibt es nicht alles an Köstlichkeiten, für deren Produktion Heffe unerläßlich ist! Heute noch lecken wir uns die Finger nach Heffeköjelccher (kleine Pfannkuchen aus Hefeteig, die daheim regelmäßig auf den Tisch kamen und die heiß und fettriefend direkt aus der Pfanne am besten schmeckten, schön mit Zucker bestreut oder sogar Rübenkraut drauf. Kalt sind sie unterdessen auch nicht zu verachten, wenn der Zucker geschmolzen und schön „eingezogen“ ist. Begehrt waren bei uns damals die Heffedejlcher (Hefeteilchen), die es ebenfalls für ein paar Pfennige an Jierdrögge gab. Eine Köstlichkeit war für uns auch der Heffezopp (Hefezopf), den die Eltern nach altüberliefertem Hausrezept herstellten. Besondere Aufmerksamkeit erforderte dabei das Flechten, damit auch ein richtiger Zopp entstand. Dem Vernehmen nach sollen auch Hefeklöße mit Birnen und Speck eine Köstlichkeit sein, - ich habe sie noch nie probiert, werde das Versäumte aber gelegentlich nachholen.
Heij
Dr Heij hänk en dr Luff, moor jit et joot Wedder. So kommentierte Ohm Mattes den leichten Dunst, der sich gegen Abend über Wiesen und Felder ausdehnte, wenn wir an heißen Sommertagen die letzte Fuhre Heu des Tages einbrachten. Viele Leute wussten früher die Hinweise oder auch Warnungen der Natur zu deuten. Der Heij war eine Lufterscheinung wie sehr dünner Rauch, der flimmernd und unbeweglich über der Heuwiese hing. Das war sehr oft gegen Abend der Fall und dann behauptete der Onkel, dass am nächsten Tag gutes Heuwetter kommen werde. Fast immer behielt er Recht. Heij war generell unser Wort für „Hauch, Dunst, dünner Überzug.“ Ganz feinen „hauchdünnen“ Nebel beispielsweise bezeichneten wir als Heij, ebenso den „Schleier,“ der sich manchmal um die Sonne bildete. Heij bildet sich auch auf Früchten. Wenn beispielsweise im Herbst die Pflaumen heranreifen, weisen sie einen hauchfeinen blauen Überzug auf, der ihnen ein stattliches Aussehen verleiht, bei Berührung aber verschwindet. Aus meiner Kinderzeit ist mir noch in Erinnerung, dass in unserem Garten die Johannisbeeren manchmal von einem mehltauartigen Belag befallen wurden. Dr Heij os an de Knüetschele konstatierte dann unsere Jött und ermahnte uns Kinder: Jooht mir blos net do draan fächte, do wied mr krank van (nascht blos nicht daran, davon wird man krank). Ob das stimmte, weiß ich bis heute nicht, unser Knüetschelsheij überzog die Blätter mit einem grau-weißen Schleier, die eigentlichen Früchte blieben unberührt, sie wurden auch geerntet und zu Gelee gemacht.
Heija
Ein uraltes Wort für alles, was irgendwie mit dem Schlaf in Zusammenhang gebracht wird. Jetz wiëd sech noch jebedd on dann ab en de Heija (Jetzt noch das Nachtgebet und dann ab ins Bett) lautete bei uns allabendlich der elterliche Schlafenszeitbefehl. Ech maachen e Stöndche heija war die Ankündigung eines Mittagsschläfchens. Das Heijabettche war und ist ein allgemein beliebtes Wort auch bei den Erwachsenen. Das Heijakindche war das Kleinkind, wenn die Mutter es fürs Schlafengehen zurecht gemacht hatte. Auch der Karneval kennt die Heija in dem Kölner Schlager Waröm solle mir dann jetz ad en de Heija jonn, et es noch vill ze fröh, mir blieve noch jät he. Wir kennen die beiden verwandten Begriffe Heijamann und Heiermann als gängige Namen für die frühere Fünf-DM-Münze, die später seltener auch auf den entsprechenden Euro-Schein übertragen wurden. Lange Zeit war zumindest mir die Herkunft der beiden Wörter unklar, jetzt endlich hat das allwissende „Google“ mir eine Erklärung verschafft. Demnach soll sich Heier auf die Heuer der Seeleute beziehen, die sich im Hamburger Hafen für eine solche Heier mit den einschlägigen Damen vergnügten. Da dieses Vergnügen mit dem Wort „Schlaf“ in Zusammenhang zu bringen war, lag also auch Heija im Anwendungsbereich, daraus soll Heijamann entstanden sein. Laut Google war im Krefelder Stadtbereich auch der Begriff Heiermännchen für die 50 Pfennigmünze üblich.
Heische
Dohn dir de Heische aan, et os düchtich kalt lautet der gutgemeinte Rat, wegen strenger Kälte die Handschuhe zu tragen. Im Kölner Dialekt sind das die Händsche, die Holländer sagen handschoen (gesprochen „handschuhn“). Als Kinder kannten wir eigentlich nur zwei Arten von Handschuhen, beim Schlittenfahren und Eisbahnschlagen waren die Fuußheische (Fausthandschuhe) bevorzugt, weil sich dabei die Finger „gegenseitig“ und damit die Hand insgesamt wärmten. Zum individuellen Kälteschutz der einzelnen Finger bedienten wir uns dagegen der Fongerheische (Fingerhandschuhe). Die Heische unserer Kinderjahre entstammten in aller Regel der häuslichen Eigenproduktion: Strecke (Stricken, weiches e) war an den langen Winterabenden oder am arbeitsfreien Sonntagnachmittag die Lieblingsbeschäftigung der weiblichen Hausbewohner. Dabei standen unter anderem auch lang Strömp (lange Strümpfe) und Konerheische (Kinderhandschuhe) zur Fabrikation an. Die aus dicker Wolle hergestellten eigenen Stricksachen wurden von uns Kindern in jedem Fall bevorzugt getragen. Die heute bei jeder Gelegenheit üblichen Arbeitshandschuhe kannten wir früher fast gar nicht, als Kind habe ich mich stets gewundert, wenn jemand Ärbedsheische trug. Und für Sommerheische fehlte mir absolut jedes Verständnis: Em Sommer dejt mr doch kejn Heische aan, für meine Begriffe waren Heische ein reiner Kälteschutz im Winter. Wenn wir unvermutet vor ein Problem gestellt werden, das wir ohne fremde Hilfe nicht lösen können, bedienen wir uns gelegentlich der Redewendung dat os e Donge wie en Heische (das ist ein Ding wie ein Handschuh). Damit bringen wir zum Ausdruck: Der Handschuh allein vermag nichts, er braucht die Hand als treibende Kraft, - ohne Hilfe von außen können auch wir dieses Problem nicht bewältigen.
Hejnche
Es ist eine Eigenart unserer Dialektsprache, dass einmal „vergebene“ Namen unverändert beibehalten werden. Ein klassisches Beispiel hierfür war unser früherer Bürgermeister, Johann Leyendecker mit gut bürgerlichem Namen, der in der halben Eifel generell als Leyendeckesch Schang bekannt war, Johann oder das allgemein übliche Schäng hätten absolut nicht zu seiner Persönlichkeit gepasst. Ähnliches gilt für den Namen Heinrich, den wir in aller Regel auf Hein abkürzen. Da ist beispielsweise der niederländische Schlagersänger Hein Simons, der als Heintje Weltruf erlangte und dem dieser Kindername noch heute anhängt. Unsere dialektmäßige Verkleinerung von „Heinrich“ ist Hejnche. Unser früherer Bierverleger Heinrich Handwerk fungierte allenthalben unter diesem Namen, wurde aber bei uns im Dorf ausschließlich Handwerks Hejnche genannt, obwohl er von ganz normaler Statur und keineswegs ein „Klein-Heinrich“ war. Ein ähnliches Beispiel: Heinrich Hammes, obwohl ebenfalls von normalem Körperbau, wurde zeitlebens Heini genannt. Unser Nachbar Heinrich Klaßen wurde von Kind an Klaßens Hein genannt, Heini oder Hejnche wären bei ihm undenkbar gewesen. Auch mein Vater, obwohl klein und sschmächtig von Wuchs, war und blieb im Dorf und bei seiner gesamten Kundschaft Vossen-Hein. Unser Nachbar im Schlemmershof hieß Heinrich Klinkhammer, im Alltag wurde er unterdessen ausschließlich Kaue Hejnerich genannt, auch bei ihm wäre Hejnche geradezu unmöglich gewesen.
Hejnsch
Hejnsch ist das Eifeler Wort für den Buchweizen, die Herkunft geht vermutlich auf die Anspruchslosigkeit der Pflanze zurück, die selbst in der Heide noch gedeiht und regional auch „Heiden“ genannt wurde. Noch nach dem Krieg wurde bei uns in Nonnenbach auf bestimmten kargen Böden Buchweizen angebaut, das trug uns bei den Nachbarn in Blankenheim den Spitznamen Hejnschkoochemänn (Buchweizenkuchenmänner) ein. Manchmal kam Besuch aus dem „Flecken“ über die Hardt herüber und kündigte sich vom Waldrand her mit langgezogenem Ruf an: Hejnschkooche, Hejnschkoochemänn. Dann stellte die Nonnenbacher Hausfrau die Eisenpfanne aufs Herdfeuer, um den Besuch traditionsgemäß mit frischen Buchweizen-Pfannkuchen begrüßen zu können. Fettig und heiß direkt aus der Pfanne waren die optisch ein wenig unscheinbaren Köjelcher (Minikuchen) ein echter Leckerbissen. Wir daheim bauten einen halben Morgen Hejnsch an, um eben gelegentlich ein paar Hejnschkooche auf dem Tisch zu haben. Die Pflanze kann bis gut einen Meter hoch werden, auf unserem mageren Feld wurde der Hejnsch nur etwa kniehoch, die Ernte war mühsam, weil das Mähgut auf den Boden abgelegt werden musste (siehe: Hawerjeschier).
Hellije Mann
Es gibt zahllose heilige Männer, der Eifeler verbindet unterdessen mit dem Begriff Hellije Mann ausschließlich Sankt Nikolaus, den Kinderfreund. Wochenlang im Voraus freuten wir Kinder uns auf Nikeloosdaach (Nikolaustag, 06. Dezember), wochenlang bemühten wir uns auch, bis dahin gehorsam und artig zu sein, denn die Eltern kündigten an: Wennde dech net schecks, kreßte nix vam Nikeloos oder auch pass blos op, dr Hans Muff dejt dech en dr Sack. Hans Muff, das war bei uns der schwarze Begleiter des Heiligen Mannes, der die bösen Kinder in den riesigen Sack steckte. Bei uns daheim kam der Hellije Mann ganz selten persönlich, es fand sich kaum jemand, der die Rolle übernehmen mochte. Wir stellten am Vorabend unsere superblank gewienerten Schuhe auf die Fensterbank und fanden sie am nächsten Morgen mit diversen Süßigkeiten und kleinen Geschenken gefüllt. Großartigkeiten brachte der Nikeloos bei uns nicht, dafür war aauch kein Geld da. Zwei Tage zuvor hatten wir schon einmal die Schuhe aufgestellt: Am 04. Dezember hatte uns die Bärb (Sankt Barbara) ein paar kleine Köstlichkeiten mitgebracht. In Blankenheimerdorf und Umgebung waren Ludger Schneider und Wilfried Meyers jahrzehntelang als Nikolaus und Hans Muff ein vielbeschäftigtes Gespann, dessen Dienste die Eltern sehr gerne in Anspruch nahmen. Ihr besonderes Merkmal: Der Hellije Mann und sein Knecht Ruprecht traten niemals als „Kinderschreck“ in Erscheinung, diese Rolle lehnten sie kategorisch ab und beschränkten sich im Bedarfsfall auf das eine oder andere ernsthafte Mahnwort.
Hellijebildcher (weiches e)
Ein Heiligenbildchen ist heute so selten wie sechs Richtige im Lotto, allenfalls entdecken wir diese gedruckten bunten Schätze noch im verstaubten uralten Jebettbooch von Oma oder im „Leben der Heiligen,“ sofern das alte Familienbuch noch in der hintersten Schrankecke ein bescheidenes Dasein führt. Zu unserer Kinderzeit gab es Hellijebildcher vom Pastor in der Chreßlich Liehr (Christenlehre, Religionsunterricht) als Belohnung, wenn wir unseren Katechissem (Katechismus) gut auswendig gelernt hatten. Wir legten uns regelrechte Bildchendateien zu, tauschten untereinander aus und waren stolz auf unsere Sammlung. Der „Insider“ des 21. Jahrhunderts findet für ein Hellijebildche bestenfalls noch ein müdes Lächeln, - eigentlich schade, es gab richtige Raritäten darunter. Hellijebildcher verkaufte früher auch der Husierer (Hausierer), etwa der in der halben Eifel wohlbekannte Stotzemer (Stotzheimer). In seinem Bauchladen gab es, neben Gummiband, Heftzwecken, Nähgarn und Rasierklingen, auch Heiligenbildchen, alles zu annehmbaren Pfennigsbeträgen. Und ganz hinten im Kasten gab es auch Bildchen anderer Art, die wir Pänz aber nicht zu Gesicht bekamen. Sie wurden honner dr Hand (hinter der Hand) gehandelt, so wie beispielsweise beim Friseur hin und wieder ein geheimnisvolles Päckchen den Besitzer wechselte.
Hemb
Aufgekrempelte Hemdsärmel sind in der Regel ein Zeichen von Unternehmergeist und Arbeitsbereitschaft. Wenn beispielsweise im Frühjahr die Märzsonne unsere Erde erwärmt, sehen wir den Arbeitsmann in Hembsmaue (hemdärmelig) in Haus und Hof und Garten schaffen. Hemb war und ist die allgemeine Dialektbezeichnung für das Hemd, bei uns war früher aber auch Hem (weiches e) gebräuchlich: Moor dejste e fresch Hem aan (Morgen ziehst du ein frisches Hemd an). Der Plural war Hember und Hemmer (weiches e). Am Waschtag flatterten sie auf der Wäscheleine vor dem Haus: Mannslöcks-, Fraulöcks- und Konnerhember, und vermittelten ungewollt einen Einblick in den Wäschebestand des Besitzers, wobei besonders die Sonndaachshember ins Auge fielen. Sonntagshemden waren in der Regel Wieß Hember, die Farbigen zählten eher zu den Ärbedshember (Arbeitshemden). Es gibt eine Unmenge von Redewendungen im Zusammenhang mit dem Hemd, woraus die Bedeutung dieses Kleidungsstücks hervorgeht. Das uns et Hem noher os wie dr Rock ist eine altbekannte Tatsache. Maach dir nix en et Hemb bedeutet so viel wie „reg dich nicht auf, keine Angst.“ E opjerääch Hemb ist ein zappeliger unruhiger Mitmensch. Kejn Hemb am Aasch äwwer et Auto en dr Karaasch spottet man über den Autonarren. Ejnem et Hemb üßdohn bedeutet jemanden ausnützen bis zum Gehtnichtmehr. Und wer et Hemb vam Liev fott jitt (das Hemd vom Leib gibt) der ist ein wahrer Samariter.
Herres
Das in der Eifel weit verbreitete Mundartwort für die dritte Jahreszeit, den Herbst. Die Holländer sagen „herfst,“ und das ist artverwandt mit dem englischen Wort „harvest,“ was soviel wie „Ernte“ bedeutet. Der Herbst ist die Zeit der Reife, der Farben und der Vorbereitung auf Kälte und Winter. Für viele Menschen, und vor allem für diejenigen, die selber den Lebensherbst erreicht haben, ist der Herbst die allerschönste Jahreszeit. Christian Friedrich Hebbel beschrieb seinerzeit das Natur-Herbstwunder treffend: „Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah, / Die Luft ist still, als atmete man kaum / Und dennoch fallen raschelnd fern und nah / Die schönsten Früchte ab von jedem Baum…“ Das Gedicht hat mich schon in der Volksschule fasziniert. Aus einer Unzahl von Bauernregeln über den Herbst, sei hier eine erwähnt: Vell Nevvel em Herres, vell Schnie em Wonter (Viel Nebel im Herbst, viel Schnee im Winter). Angeblich soll auch ein trockener Herbst einen langen Winter einleiten. In unserer verdrehten Zeit jedoch, wo selbst die Natur auf dem Kopf steht, ist auch auf die Wetterregeln unserer Vorfahren kaum noch Verlass.
nach oben
zurück
Herresfäddem
Damit sind die „Herbstfäden“ gemeint, die Spinnenfäden im Altweibersommer, an denen sich Millionen winziger junger Baldachinspinnen vom Wind davontragen lassen. An sonnenwarmen Herbsttagen sehen wir die Herresfäddem wie lange, silbergraue Haare durch die Luft segeln. In der germanischen Mythologie bewirken die Nornen (Schicksalsgöttinnen), die die Lebensfäden der Menschen spinnen, dass die alten Frauen (Weiber) beim Kämmen viele Haare verlieren, die dann vom Wind davongetragen werden. Im Christentum entstand die Legende, wonach die Silberfäden aus dem Mantel Marias stammen, den sie bei ihrer Himmelfahrt trug. Im Volksmund heißen die Fäden somit auch Marienfäden, Marienseide oder Marienhaar. Der Eifel-Schriftsteller Karl Guthausen beschrieb einmal in einem Zeitungsbeitrag die Herresfäddem sehr treffend: „Silberne Fäden, wie feines weißglänzendes Greisenhaar.“ Die nur millimetergroßen Baldachinspinnchen am Ende der Fäden sind beinahe unsichtbar, wir entdecken sie erst, wenn ihre gewölbten dichten Netze (Baldachine) im Morgentau auf der Wiese glitzern.
Herresferië
Das sind die Herbstferien, die überall im Oktober stattfinden und ein bis zwei Wochen dauern, wobei die Termine von den einzelnen Landesregierungen festgelegt werden. In Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise die Herresferië 2015 vom 05. bis 17. Oktober. Die Herbstferien sind aus den ursprünglichen „Kartoffelferien“ hervorgegangen. Noch zu meiner Kinderzeit gab es daheim im Oktober 10 Tage oder länger Jrompereferië zusätzlich, die eigens für die Kartoffelernte angesetzt waren: Alle Arbeit geschah noch von Hand und da mussten die Kinder mit aufs Feld zum Jrompere raafe (Auflesen, Einsammeln). Der Oktober war und ist der Erntemonat für Spätjrompere, die sich bestens zum Einkellern eignen, weil sie zum Ausreifen länger in der Erde bleiben. Bevorzugte Spätsorten waren früher Ackersegen, Industrie und Bismarck, unsere Hausmarke daheim war der Ackersegen. Wenn die Kartoffeln geerntet und die Ferien noch nicht zu Ende waren, war für uns Pänz ganztägiges Viehhüten angesagt: Die Weide war „offen“ (siehe: Mechelsdaach) und der „Goldene Oktober“ musste so lange wie nur möglich genutzt werden, um das kostbares Winterheu zu sparen.
Herring
Das war unser Mundartwort für den Hering, der früher während der kalten Jahreszeit mindestens zweimal im Monat auf den Mittagstisch kam, meistens reichte die angerichtete Menge für zwei Tage. Herring mot Quellmänn (Hering mit Pellkartoffeln) war eine billige, schmackhafte und obendrein gesunde Mahlzeit, die auch heute noch beim Kenner nichts an Beliebtheit eingebüßt hat. Mangels geeigneter Kühlmöglichkeit – Kühlschrank und Gefriertruhe waren beinahe utopische Begriffe für uns – gab es bei uns Heringe nur im Winter zu kaufen, das hölzerne Herringsfass stand beim Dorfkrämer neben der Ladentür im Schnee. Die Salzfische wurden mit der hölzernen Zange aus dem Fass geholt, sie waren noch „ganz“ und mussten daheim ausgenommen und eingelegt werden. Das war eine langwierige Arbeit für die Hausfrau, und das ganze Haus roch intensiv nach Salz und Fisch. Mit zubereitet und verspeist wurden seltsamerweise auch die Hoden der Heringsmännchen sowie der Rogen der Weibchen. Entsprechend wurden die Fische bei uns als Milcher oder als Körner eingestuft. Den Herring selber verspeiste auch ich mit Behagen, die massenhaft in der Brühe schwimmenden Öllijer (Zwiebelstücke) fischte ich dagegen heraus.
Herringsschloot (hartes o)
Salzheringe werden, wie schon der Name sagt, in einer hochprozentigen Salzlake konserviert und müssen somit vor der weiteren Zubereitung gründlich gewässert werden. Bei uns daheim war das weitaus größte Quantum fürs Einlegen bestimmt, ein paar gewässerte Fische zweigte Mam unterdessen für die Zubereitung von Herringsschloot (Heringssalat) ab, den außer ihr selber kaum einer von den übrigen Hausgenossen anrührte. Ich kenne die Zutaten und die Herstellung nicht genau, das fertige Produkt enthielt in jedem Fall aber kleingeschnippelte Heringe, Gurken, Karoten (Rote Bete), Zwiebeln und eine Menge guten Roum (Rahm) aus der Hausproduktion. Es schmeckte ganz passabel, ich selber aber hasste das Knirschen beim Kauen von rohem Öllich (Zwiebeln), und auch die Karoten mochte ich nicht, - Öllich und Karote mag ich heute noch nicht. Mam besaß ein spezielles schmales Pozzellengdöppche (Porzellantöpfchen) für ihre Herringsschloot (Die Schloot = mundartlich für Der Salat). Eine kräftige Scheibe von unserem selbstgebackenen Brot, gut mit Butter bestrichen, eine dicke Lage Herringsschloot drauf, dann eine Lage Tomatenscheiben, und schließlich eine massive Schicht Zwiebelringe, - das war Muters Herringsschnedd (Heringsschnitte), für die sie den Schweinebraten stehen ließ. Meistens kam obendrauf auch noch ein Klecks Klatschkäs (Quark). Da musste die „Futterluke“ schon ganz schön weit aufgetan werden, doch ist das bekanntlich bei dem einen oder anderen „Burger“ unserer Tage nicht anders.
Heudreßer (weiches e)
Ein ziemlich seltsames Wort, die Übersetzung müsste „Heuscheißer“ lauten, ein Begriff, mit dem wenig anzufangen ist. Noch zu unserer Kinderzeit war unterdessen Heudreßer ein gängiges Mundartwort, dem ein bitterer Beigeschmack anhaftete. Wenn nämlich die Erntemannschaft beim Heueinfahren von einem plötzlichen Regenguss überrascht wurde, so war das ein unerwünschter und gefürchteter Heudreßer, der den bravsten Bauersmann zu unchristlichem Fluchen verleitete. Wenn der Guss nicht übermäßig stark war, konnte man die obere Schicht der Wagenladung daheim auf der Scheunentenne trocknen lassen, bevor sie auf den Heustall (Heuboden) kam. Im schlimmsten Fall aber musste die durchnässte Fuhre auf der Wiese wieder abgeladen werden. In einem solchen Fall ging man dem Betroffenen am besten aus dem Weg. Ich erinnere mich noch gut: Wir waren an der Maiheck (Flurname, Standort des heutigen Pumpenhauses der Wasserversorgung) beim Heu laden, ich war der „Lader“ auf dem Wagen. Ein Gewitter zog heran, mit überstürzter Eile wurde das restliche Heu aufgeladen, die Ladung mehr schlecht als recht mit dem Wiesbaum gebunden, und ab ging es auf den gut kilometerlangen Heimweg: Schnell schnell, dat mir noch vüer dem Rään en de Schüer komme! Noch vor dem Regen in die Scheune, leicht gesagt. Die Heuladung war in der Eile schlecht gestapelt und schejf jebonne (schief gebunden = mangelhaft gesichert), in einer Wegkurve machte sich ein Teil der Ladung selbständig und rutschte zu Boden. Oha! Natürlich war der Lader schuld, über seinem (meinem) Haupt entlud sich ein zweites Gewitter. Das echte Gewitter war glücklicherweise drüch (trocken) und zog ohne Regenguss vorbei. Nicht auszudenken, wenn auch noch ein Heudreßer über uns gekommen wäre.
Heuhooke (hartes o)
Der „Heuhaken“ war früher ein unentbehrliches Gerät in jedem Bauernhaus und wurde beim täglichen Heu roppe (rupfen) gebraucht. Das war die Entnahme der Tagesration aus dem Heuvorrat für die Stalltiere. Beim Abladen im Sommer wurde das sperrige Heu auf dem Heuboden jedämmelt (durch Darüberlaufen niedergetreten, siehe dämmele). Daraus ergab sich nach längerer Lagerung ein ziemlich fester Stapel, aus dem der Tagesbedarf fürs Vieh herausgerupft werden mußte. Das Rupfen diente der Auflockerung und „Lüftung“ des Futters. Der Heuhooke war ein armlanges spitzes Eisen mit einem starken Widerhaken und einem massiven Holzgriff, manchmal war auch der Eisenstab am hinteren Ende zu einem Griff gebogen. Heu rupfen war eine langwierige und allgemein unbeliebte Arbeit. Weil der Haken immer nur kleine Mengen aus dem Heuberg heraus „pflückte,“ sprach man oft auch von Heu plöcke (pflücken), beispielsweise Ohm Mattes, wenn er mich beauftragte: Maach dech op der Heustall on plöck et Heu für denoovend (Rauf auf den Heuboden und den Heubedarf für heute Abend gerupft!). Etwaige Widerreden wurden bei derartigen Aufträgen schon in ihren Anfängen und damit „im Keim“ erstickt.
Heulauch
Das „Heuloch“ gehörte zum Heustall wie der Rauch zum Feuer. Es gab zwei Heulaucher (Plural von Heulauch) mit unterschiedlicher Funktion: Eins zum Befüllen, das andere zum Leeren des Heubodens. Die Tenne der Eifeler Scheune war meistens so eng, dass gerade mal ein beladener Heu- oder Getreidewagen hinein passte, das Abladen war schwierig. Deshalb gab es oft in der Außenwand der Scheune eine mit einem Holzladen verschließbare Öffnung, durch die bequem das Heu von außen auf den Heuboden gegabelt werden konnte. Die zweite Art Heulauch war eine Luke im Heustallboden, durch die der tägliche Futterbedarf in den darunter liegenden Foderjang („Futtergang,“ Raum zum Beschicken der Futterkrippen) befördert wurde. Es gab eine dritte Art von Heuloch, die aber „aus der Art geschlagen“ war: Et jeckich Heulauch. So nannte man einen Zeitgenossen, der lauter dummes Zeug im Kopf hatte und die Mitmenschen gern auf die Schippe nahm. Du jeckich Heulauch, mech kannste net veraasche wehrte man sich beispielsweise gegen eine zweifelhafte Behauptung. Du jeckich Heulauch war in etwa gleichzusetzen mit Du Jeck em Rään.
Heusoome (hartes o)
Das Wort bedeutet Heusamen und ist eigentlich ein „Unwort,“ Heusamen in Sinne des Wortes nämlich gibt es nicht. Was bei uns mit Heusoome bezeichnet wurde, das war der trockene Grassamen, der sich im Lauf der Jahre am Boden des Heustalls ansammelte und manchmal handhoch die Ritzen zwischen den Bodenbalken ausfüllte. Der Heusoome setzte sich aus einer Vielzahl von Gras-, Blumen- und Kräuterteilen zusammen. Die Pflanzen wurden mit dem Grasmähen geschnitten und getrocknet, ein Teil der Samen und Kleinteile gelangte mit der Ernte auf den Heuboden und sammelte sich dort mit der Zeit. In der Volksmedizin nahm Heusoome eine nicht unbedeutende Position als Heilmittel bei einer Vielzahl von Krankheiten ein, Heubloome (weiches o) nannte man ganz allgemein den Tie vam Heustall (Tee vom Heustall), und Heublumentee gibt es auch heute noch. Umschläge, Bäder und Wickel mit heißem Heublumensud waren früher an der Tagesordnung und sollten unter anderem schmerzlindernd wirken. Auf eine absolut nicht gesundheitsfördernde Weise verwertete nach dem Krieg Ohm Mattes (mein Onkel) unseren Heusoome. Es gab keinen Tabak, die Raucher lebten notdürftig von „Selbstzucht“ und erfanden die mörderischsten „Spezialmixturen“ für die hungrige Raucherlunge. Ohm Mattes sammelte, trocknete und zerstückelte die vom Kirschbaum gefallenen gelben Blätter und fabrizierte prima Tubak daraus. Wenn nun aber im Winter der Kirschbaum keine Blätter mehr besaß, wurden sie durch Heusoome ersetzt, von dem der Ohm ständig eine ausreichende Portion in der Jackentasche mit sich führte. Dieser „Tabakrauch“ war „Fliegentod“ in höchster Vollendung, er stank geradezu bestialisch und schmurgelte unbeschreiblich im Knasterdöppe, aber es qualmte, und das allein zählte.
Heusprong
Wörtlich übersetzt „Heusprung,“ ein Begriff, mit dem heute kaum noch jemand etwas anzufangen weiß. Gemeint ist die Heuschrecke und speziell der bei uns verbreitete „Grashüpfer“ in seinen verschiedenen Arten. Früher hüpften beim Grasmähen ganze Scharen von Heuspröng vor der Sense auf oder flüchteten vor dem Rechen beim Heueinfahren, was ihnen wohl auch zu ihrem Namen verholfen hat. Seltener begegnete man bei uns dem „Großen Grünen Heupferd,“ das im Endstadium seiner Entwicklung einschließlich der Flügel sechs bis sieben Zentimeter groß wird und vor dem wir Kinder wegen seiner Größe ziemlichen Respekt hatten. Das ausgewachsene Große Heupferd ernährt sich von Insekten und jagt sogar die Larven des Kartoffelkäfers (Quelle: Google), es ist also ein sehr nützliches Geschöpf. Es gab eine braun-graue Sorte von Heuspröng, die zum Teil einen gebogenen spitzen „Stachel“ am Hinterleib trugen und die wir Pänz nicht zu berühren wagten. Wir wussten ja nicht, dass es sich nur um die „Legeröhre“ der weiblichen Tiere handelte. Wenn nach dem Krieg Dechant Hermann Lux aus dem Dörf zum Angeln am Nonnenbach kam, nahm er mich meistens mit, ich mußte ihm dann Heuspröng als Naturköder für seine Angel fangen.
Hielich
Früher auch Hillich, bezeichnete allgemein den Ehestand oder das Verlöbnis. Konkret bedeutete aber die Hielich die öffentlich-feierliche Verabschiedung der Braut aus dem dörflichen „Rosengarten“ (Mädchenkreis) oder des Bräutigams aus dem Jelooch (Junggesellenvereinigung). Die originale Dörfer Hielich, wie sie bei uns noch bis in die 1970er Jahre veranstaltet wurde, war ausschließlich Sache der Junggesellen. Am Samstagabend vor der ersten „Verkündigung“ des Brautpaars in der Kirche, zogen die Junggesellen zum Brauthaus, gratulierten mit dem – mehr oder weniger melodischen – Liedvortrag Schönste aller Schönen, was hör ich von dir… und einem Blumenstrauß, und wurden anschließend bewirtet. Problematisch war oft die Beschaffung der unabdingbar erforderlichen Blumen: Den Junggesellen saßen die Groschen durchaus nicht locker, also „bediente“ man sich ersatzweise in diesem oder jenem Vorgarten, soweit die Jahreszeit dies ermöglichte. Einmal stammten die Blumen sogar aus dem Gärtchen der Braut, die sich mächtig über die herrlich Blome freute und auch am nächsten Tag nicht böse wurde, als sie die Wahrheit erfuhr. Heute wäre in einem solchen Fall Anklage wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl, arglistige Täuschung und was weiß ich noch alles unvermeidbar. Die Hielich war Ehrensache für alle Beteiligten, sie galt als „Barometer“ für die Beliebtheit des Brautpaars im Dorf. Inzwischen hat der schöne Ur-Brauch dem modernen „Polterabend“ mit möglichst großen Scherbenhaufen weichen müssen.
Hiere
Noch lange nach dem Krieg war allgemein die Hausschlachtung für den Eigenbedarf üblich, zur Kirmes oder einem besonderen Anlass, beispielsweise zur Hochzeit, kam das bis dahin liebevoll heran gemästete Hausschwein ans Messer. Hausschlachter bei uns war Theodor Baales, gebürtig aus Nonnenbach, allgemein nur dr Baales genannt. Er kannte und befolgte die speziellen Wünsche seiner Kundschaft genau. Ein solcher Wunsch war oft das Aussortieren und Konservieren der Hiere meist für die Verwertung noch am gleichen Tag. Die Hiere, das war das Schweinehirn, ließ man auskühlen und verzehrte sie dann zum Abendbrot. Bei uns daheim wurde die etwas unansehnliche Masse mit Zwiebeln, Pfeffer und ähnlichen hausüblichen „Scharfmachern“ gewürzt und ebenso scharf in der Eisenpfanne gebraten. Es schmeckte etwas eigentümlich, war aber lecker und wir Kinder rissen uns um die Brocken. Leider war es stets viel zu wenig, die Erwachsenen verzichteten zu unseren Gunsten. So ein armes Schwein hatte eben nicht viel Hiere em Kopp. Schweinehirn mag nicht jedermanns Sache sein, wer unterdessen Muscheln schlürft, Mehlwurmlarven röstet oder Weinbergschnecken als Delikatesse verzehrt, der sollte sich durchaus auch einmal Hiere zu Gemüte führen. Je frischer, desto leckerer, lautete bei uns die Devise. Nicht weniger frisch und lecker war am Schlachttag auch der Pannhas aus Schweineblut, Buchweizenmehl und Gewürzen, bei uns daheim ein kohlschwarzer unansehnlicher Schmarren, aber ungemein schmackhaft. Das Wort Hiere wurde und wird ausnahmslos im Zusammenhang mit Tieren angewandt, ansonsten sagen wir Jehirn.
Hobbelspän (weiches o)
Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wenn wir heutzutage über Hobelspäne reden, handelt es sich in aller Regel um die winzigen halbrunden Schnippel, die in der modernen Schreinerei schon beim Entstehen an der Maschine abgesaugt und im Silo gespeichert werden. Armlange, hauchdünne Streifen, wie sie früher der Dorfschreiner mit dem Handhobel erzeugte, müssen heute durch spezielle Maschinen hergestellt werden. Beim Glätten beispielsweise einer Türfüllung mit dem speziellen Putzhobel, stand seinerzeit der Schreiner nicht selten bis zum Knie in einem Berg von Hobbelspän. Die ergaben das allerbeste Material fürs Anheizen des Küchenherdes, wurden aber angesichts der Masse meist außerhalb des Hauses verbrannt. Das Verheizen im Ofen war unrentabel und wegen der starken Flamme feuergefährlich. Der heutige Hobelspan verbrennt längst nicht mehr so intensiv, dafür erzeugt er gewaltigen, stinkenden Rauch. Hobbelspän als Industrieabfall finden heute vielfältige Verwertung, sofern sie nicht im eigenen Betrieb beispielsweise als Heizstoff eingesetzt werden. Eine Hauptnutzung ist die Herstellung von Holzpellets. In der Landwirtschaft werden Hobbelspän als Einstreu genutzt, der Gärtner braucht sie zur Bodenlockerung. In unserem Garten wurden noch vor Jahren gelegentlich Hobbelspän verbrannt, wegen der Geruchs- und Rauchbelästigung habe ich das eingestellt. Im und nach dem Krieg führte daheim in Nonnenbach Ewe Huppert (Hubert Baum) eine Schreinerwerkstatt mit einer, damals hochmodernen Holzbearbeitungsmaschine. In bestimmten Zeitabständen verbrannte er neben dem Haus seine Werkstattabfälle, und dann stank Tag und Nacht das Nonnenbachtal nach Hobbelspän. Beschwert hat sich nie jemand.
Hoddel (weiches o)
Ausdruck für eine schlechte Leistung oder auch für den mühsamen Verlauf einer Arbeit: Dat os äwwer noch ens ene Hoddel höck (Das ist heute mal wieder eine Plackerei). Das Ursprungswort ist Huddel und wird auch überwiegend an der Oberahr gesprochen, Hoddel ist nur lokal gebräuchlich, unter anderem in Blankenheimerdorf. Im Raum Aachen hat Hoddel die Bedeutung von „Stofflappen, Fetzen, Lumpen,“ es gibt da ein allbekanntes Bierlied: Et flooch en Fot (Hinterteil) et Daach erop, die wor met Hoddele ußjestopp… Wenn die Arbeit nicht fluppt (vorangeht, gelingt), so ist das „eine einzige Hoddelerej,“ und wenn ein Unternehmen Hoddelskroom (Pfuscharbeit) liefert, gerät es leicht in den zweifelhaften Ruf einer Firma Hoddel on Brassel. Dieser „Firmenname“ kann unterdessen sehr wohl auch das Gegenteil bedeuten. Da gibt es nämlich (2013) in Üllewe (Uedelhoven, Ortschaft der Gemeinde Blankenheim) den recht aktiven Theaterverein Huddel un Brassel und der ist alles andere als eine Huddelsfirma. Manchmal, wenn ich in unserer Werkstatt mit irgendeiner unbeliebten Arbeit beauftragt war und nicht recht voran kam, riss Vater der Geduldsfaden: Wat hoddelste dir do ejentlich zesamme, komm her, loß mech dat maache. Laß mich das machen, - ein solches väterliches Wort war des Anschreibens im Kalender wert.
Hohn (kurzes weiches o)
Das Hohn, mit kurzem weichem o gesprochen, ist ganz unverkennbar unser Eierlieferant, das Huhn. Auch hier ist die Aussprache maßgebend für die Bedeutung des Wortes. Mit gedehntem o gesprochen ist es nämlich mit seinem hochdeutschen Ebenbild „Hohn“ (Spott) identisch. Et Hohn (Das Huhn), so möchte ich eine kleine Geschichte betiteln, die sich im Frühjahr 1956 zugetragen hat. Wir besaßen damals 10 oder 12 Hühner. Unser Garten hinter dem Schuppen, vom Hof her nicht einsehbar, war frisch bestellt. Schon dreimal war die Nachbarin erschienen: De Hohner sin en üërem Jade. Schon dreimal hatte ich die Biester hinaus gejagt, sie flogen immer wieder über den Lattenzaun und scharrten im frischen Saatbeet. Schon wieder kam die Nachbarin an: De Hohner, de Hohner… Da lag ein Stück Dachlatte herum, ich griff es, warf – und eins der Biester fiel um. Ich trug meine „Beute“ in den Hof, wo gerade Pap (Vater) aus der Werkstatt kam. Ihm fielen die Augen beinahe aus dem Kopf, er griff seinerseits nach einem Meterstück Dachlatte, während ich blitzartig in der Woltersjass untertauchte. An Melze (Haus Milz) schaute ich zurück, oben stand Pap und schwang die Latte: Komm du mir blos hejm! Bange zehn Minuten vergingen, das Heimgehen war aber nicht zu vermeiden und so schlich ich in unseren Hof zurück. Neben der Werkstattür (Werkstatttür, ein unmögliches Wort) lag noch mein erlegtes Huhn. Plötzlich stand es auf, kreischte jämmerlich und flitzte davon. Aus der Werkstatt kam Pap, ein Stück Dachlatte in der Hand: Jung do häß du noch ens Schwein jehatt!
Hohnerköttel (weiches ö)
Ein nicht besonders vornehmes, früher aber ganz alltägliches Wort für den Hühnerkot. Ein Köttel war ganz allgemein eine kleine Portion, interessanterweise war aber auch das Kleinkind ein Köttelche. Ein Spottlied auf die I-Dötzjer (Schulanfänger) lautete: i, a, Köttela, kanns jo noch kejn i on a. Die Ausscheidung der Hühner hieß eigentlich nur dann Hohnerköttel, wenn sie „fest“ war, in mehr oder weniger „instabilem“ Zustand nannte man die kleinen feuchten Flecken Hohnerkäckcher. Im Stall des Eifeler Kleinbauern befand sich über der Schweinebox unter der Decke die Hohnerhuët, das aus Latten gezimmerte Hühnerhaus mit etlichen „Schlafstangen,“ auf denen die Tiere während der Nacht hockten. Einmal im Jahr, wenn das Schwein geschlachtet wurde und die Box leer war, wurde die Hohnerhuët gereinigt und dabei eine Menge Köttele heraus gescharrt, - Dünger für den Garten. Et Hohndesch (Hühnerhaus) säubere war eine ekelhafte, staubige und übel riechende Angelegenheit. Bei Karl May (In den Schluchten des Balkan) hat seinerzeit Hadschi Halef Omar im „Taubenschlag“ böse Erfahrungen mit Guano machen müssen. Zum Hohndesch hinauf führte die Hohnerlejder (Hühnerleiter), oft nur ein Brett mit aufgenagelten Trittleisten, um die sich mannigfache Redewendungen ranken. Eine davon besagt: Das Leben ist wie eine Hühnerleiter, - beschissen von oben bis unten.
Hohnerlauch
Ins Hochdeutsche übersetzt: „Hühnerloch“, ein recht ungewöhnliches Wort, an dessen Anwendung sich nur noch wenige Senioren erinnern. Das Hohnerlauch war eine halbrunde Öffnung, etwa 30 Zentimeter hoch, in der Stalltür dicht über dem Boden. Es war der huhngerechte Durchschlupf für das Federvieh, das im Stall auf der Huet (Sitzstangen) seine Schlafstelle hatte. Die Stalltür war zweigeteilt, die obere Hälfte stand meistens zu Lüftungszwecken offen. Die Hühner hielten sich tagsüber in Peisch und Bongert (Wiesen vor und hinter dem Haus) im Freiland auf, durchs Hohnerlauch hatten sie jederzeit Zugang zu ihren Legeplätzen im Stall. Das Hühnertörchen war nachts durch ein nach oben verschiebbares Brett verschlossen, um Fuchs und Marder den Zugang zu versperren. Dem abendlichen Verschließen des Hohnerlauchs kam bei uns daheim enorme Bedeutung zu, nachdem einmal tatsächlich ein Fuchs in den Stall geraten war. Der Räuber hatte zwei unserer Hühner „gekillt“ und vermutlich den Ausgang nicht mehr gefunden. Sein Pech: In seiner Panik geriet er zwischen die Hufe unserer Kühe und wurde von Schwitt (Tiername) totgetrampelt.
Hohnerlejder
Es gibt Menschen, die können ihrem Dasein beim besten Willen nichts Positiven abgewinnen. Diese Pessimisten neigen leicht zu der Behauptung Et Lewwe os wie en Hohnerlejder, - beschesse van owwe bos onne (Das Leben ist wie eine Hühnerleiter, - beschissen von oben bis unten). Tatsächlich ist die Hohnerlejder nach einigen „Betriebsmonaten“ eine absolut vom Geflügelmist bekleckerte Angelegenheit. Schon Karl May schrieb über den Guano, der ihm und Hadschi Halef im Taubenschlag von Menelik arg zu schaffen machte. Mit Hohnerlejder bezeichnen wir in unserem Alltag ganz allgemein eine kleine schmale Leiter oder Treppe, die klappbare Haushaltsleiter beispielsweise ist ein Hohnerlejderche. Die echte Hohnerlejder ist ein „Treppenaufgang“ für das Federvieh am Hohndesch (Hühnerhaus). In den 1950-er Jahren war Vater von einer Siedlungsgesellschaft mit Schreinerarbeiten beauftragt, unter anderem hatte er zahlreiche mobile Hühnerställe anzufertigen. An diesen Bretterhäuschen führte an der Außenwand eine Hohnerleider hinauf. Das war ein etwa 20 Zentimeter breites Brett mit aufgenagelten Trittleisten. Bei uns daheim war die Hohnerhuërt (Schlafstelle in Gesstalt eines Lattengestells) unter der Stalldecke, über eine richtige schmale Leiter zu erreichen, die von den Tieren absolut sicher benutzt wurde. In bestimmten Abständen musste das total verdreckte Hohndesch und damit auch die Hohnerlejder gereinigt werden. Das war eine verhasste, weil staubige und geruchsintensive Arbeit, der Hohnerdreck war hart und vertrocknet und musste in der Regel abgekratzt werden.
Holzappel
Wo findet man heute noch einen Holzapfelbaum? Mir ist keine einzige Stelle mehr bekannt, wo sich ein solches Wildapfelgewächs noch gehalten hätte. Zu meiner Kinderzeit wuchsen sie an jedem Waldrand, in jedem Feldgehölz, an Feldwegen- und Straßenrändern. Kaum größer als ein Tischtennisbällchen, waren die grün-gelben Früchte unheimlich sauer und zum Verzehr nicht geeignet, – bei uns Hütebuben waren sie dennoch begehrt. Am Zweig belassen, rösteten wir die Holzäppel in der Weidefeuerflamme, bis die Schale schwarz verkohlt und das Äpfelchen aufgeplatzt war. Was dann von der Wildfrucht noch übrig war, schmeckte hervorragend, sauer zwar, aber weidegerecht-vorzüglich. Im Dichreich (Gebüschareal bei Schlemmershof am Waldorfer Weg) gab es damals einen Holzappelboum, der vermutlich ein „Mischling“ war: Er trug bemerkenswert große Früchte, die sogar ein wenig süßlich schmeckten und bei uns Kindern begehrt waren. Ohm Mattes (mein Onkel) hat einmal ein Holzapfelreis von der Kau (Flurname) daheim auf einen Apfelstock gepfropft, – poste nannte man diesen Vorgang. Es entstand eine seltsame Apfelsorte, der junge Baum ging nach zwei oder drei Jahren ein. Reife Holzäppel deponierte man damals in den Jromet auf dem Heustall (Heuboden), der Jromet war der zweite Heuschnitt, der oben auf das normale Heu zu liegen kam. Nach zwei bis drei Wochen nahmen die Äpfelchen eine wunderschöne gelbe Farbe an und ließen sich zu wohlschmeckendem Gelee verarbeiten. Im Jahr 1940 hat Vater aus einem entsprechend krumm gewachsenen Holzapfelbaumast die Kufen für meinen Rodelschlitten heraus gesägt, der alte Baumstumpf am Waldrand der Hardt ist noch heute vorhanden.
Holzbreefjer
Zur Zeit unserer Eltern wurde in Blankenheimerdorf das Brennholz aus dem Gemeindewald an die Abnehmer verlost. Rechtzeitig zuvor zog Scholle Pitter (Peter Reetz, der Gemeindediener) mit der großen Schelle durch die Straßen und verkündete, dass am nächsten Sonntag nach dem Hochamt in der Schule die Holzbreefjer ausgegeben würden. Diese Aktion war eine ziemlich wichtige Angelegenheit, die sich niemand entgehen ließ. Die Holzbreefjer waren Blanko-Abfuhrscheine mit dem Namen des Käufers, die in der Zusammenkunft an die Kunden ausgegeben wurden. Anschließend wurden „aus dem Hut“ die Holznummern gezogen und in den Abfuhrschein eingetragen. Diese Verlosung war ratsam, um jedem Käufer die gleichen Chancen einzuräumen: Oft lag das Brennholz in einem Siefen (Senke, Schlucht) oder an sonstiger unzugänglichen Stelle und musste zum Abtransport an den Weg geschleppt (gerückt) werden, - eine mühsame und aufwendige Zusatzarbeit. Willkürliches Zuteilen der Holznummern hätte zu Unstimmigkeiten geführt, die durch die Losziehung vermieden wurden. In manchen Ortschaften, beispielsweise in Nettersheim, wurden die Holzklafter versteigert. Dabei kamen, je nach Standort, Holzart und Abfuhrmöglichkeit, nicht selten erstaunliche Gebote zustande. (Siehe auch Böschbreefje).
nach oben
zurück
Hööksel
Fragen wir heute unsere Mitbürger, was unsere Eltern wohl unter einem Hööksel verstanden, so ernten wir in 99 von 100 Fällen ratloses Achselzucken. Wenn man aber weiß, dass die Höök in unserem Wortschatz Höhe bedeutet, kommt Licht ins Dunkel: Das Hööksel war eine Vorrichtung zur „Erhöhung“ eines Behälters und damit zur Erweiterung des Rauminhalts. Eine wörtliche Übersetzung ist fast nicht möglich, es ergäbe sich etwa Hochsal oder Höhensal, am einfachsten dürfte noch Erhöhung sein, doch ist das schon eine übertragene Definition. Aus dem Geräteturnen ist der Kasten bekannt, eine einfache rechteckige „Kiste,“ deren Höhe durch diverse Aufsätze verändert werden kann. Ein solcher Aufsatz ist in unserem Dialekt ein Hööksel. Auch im Krankenhaus werden Hööksele (Mehrzahl) gebraucht, wenn in besonderen Fällen der Patient durch aufsteckbare Gitter vor dem Herausfallen aus dem Bett geschützt werden muss. Und wenn daheim der Familiensprößling zu krabbeln beginnt, wird er des Nachts in seinem Bettchen ebenfalls durch seitliche Hööksele gesichert. Für den Transport großer Mengen leichtgewichtiger Güter, wird die Ladefläche des Lastwagens durch Hööksele „aufgestockt.“ Ein klassisches Hööksel gab es früher beim Ackerwagen, dessen alltägliche Form aus zwei halbmeterhohen Siddebredder (Seitenbretter) und zwei Kessele (Stirnbretter, mit weichem e gesprochen) bestand. Bei Kartoffel,- Rüben- oder Brennholzladungen wurden seitlich Hööksele aufgesteckt, deren Breite sich nach dem Überstand der Rungen über den Kasten hinaus richtete. Auch die Rungen selber können jehöök werden (hööke = höhen, aufstocken, hier: verlängern). Das ist heute noch beim Langholzwagen üblich: Die schweren Seitenrungen sind am oberen Ende ringförmig ausgeschmiedet. Durch Einstecken eines starken Rundholzes erhöht sich die Ladekapazität des Fahrzeugs.
Hoorschnegger
Einmal im Monat wurden wir Pänz bij dr Hoorschnegger (Zum Haarschneider = Friseur) geschickt, und das war eine ebenso ungeliebte und geradezu verhasste Angelegenheit wie die Monatsbeichte beim Pastor. Der einzige „richtige“ Friseur war der Salong Brang in Blankenheim, bei uns in Blankenheimerdorf ließ man sich bei Muuße Karl (Karl Breuer) oder bei Ruëseboums Hein (Heinrich Rosen) mehr oder weniger privat frisieren. Mein Hoorschnegger war meistens Plötzesch Schäng (mein Onkel Johann Plützer), er hat mir dr Kopp jeschoore (den Kopf geschoren). Im letzten Kriegsjahr, als der Weg ins Dörf wegen der Flieger zu gefährlich war, hat mich Mam daheim mit der mechanischen Hoormaschin behelfsmäßig und nach Augenmaß frisiert. Der Standardschnitt unserer Kinderzeit war ein halber Kahlschnitt an Nacken, Hinterkopf und Seiten, obenauf blieb ein „Haarteller“ stehen. Diesen Schnitt bevorzugte selbst die damalige braune „Reichsführung,“ wie man heute noch gelegentlich im Fernsehen bei Dokumentarfilmen beobachten kann. Die Hoormaschin erforderte eine sehr ruhige Hand und eine gute Portion Übung, bei falscher Handhabung nämlich gab es schnell eine helle Kahlstelle am Hinterkopf. Diese schmalen Kahlstreifen glichen entfernt einer Treppenstufe, sie hießen daher allgemein Trapp, – unser Wort für die Treppe. Trappen an Kinderköpfen waren eine Alltäglichkeit. Noch lange Jahre nach dem Krieg lag bei uns im Schaaf (Wandschrank) Mutters Hoormaschin, ein schönes Erinnerungsstück, das leider irgendwann verschwunden ist.
Hoppe
In unserem Sprachgebrauch ist der Hoppe generell eine Ansammlung, eine größere Menge, ein Haufen. Die Hausfrau hatte beispielsweise ene Hoppe Weisch (einen Berg Wäsche) zu bewältigen und im Sägewerk fiel hoppewies Säächmäel (haufenweise Sägemehl) an. Unser klassischer Hoppe war unterdessen der Heuhoppe, ein Haufen zusammengescharrtes und aufeinander gepacktes Heu auf der Heuwiese. Für unsere Eltern gab es eine unverzichtbare Voraussetzung für die Produktion von qualitativ wertvollem Heu: Vor dem Einfahren musste das an sich schon trockene Heu üwwer Nääch op Hoppe jestanne han (über Nacht auf Haufen gestanden haben). Das war absolut nicht unbegründet: Am Abend war das Heu in der Regel „rascheltrocken“ und hätte eingefahren werden können. Ein Rest Feuchtigkeit war aber doch noch enthalten, und dieser Rest konzentrierte sich über Nacht in Inneren des Hoppe. Der wurde am nächsten Vormittag jestölep (gestülpt, umgedreht, das Unterste nach oben gekehrt), bis zum Mittag war die Restfeuchtigkeit verdunstet und das Heu konnte in erstklassigen Zustand eingeholt werden. An besonders heißen Tagen wurde auch morgens früh das Gras gemäht, gewendet und abends schon eingefahren. Solches Heu erreichte nie die Qualität des zuvor jehoppten Materials. Beim Hoppen wurde das Heu zu dicken Jeringer (Wülste) von zwei Seiten her in doppelter Rechenstiellänge zusammen gescharrt und mit der dreizinkigen Heujaffel (spezielle Heugabel) grob aufeinander gepackt. Heuhoppe bedeuteten nicht zuletzt auch einen gewissen Regenschutz. Manchmal war, vor einem unverhofft einsetzenden Gewitter, das rechtzeitige Einfahren nicht mehr möglich. Dann wurde die Heusprejd (Spreite) in Windeseile zusammen gerecht und op Hoppe jestallt (auf Haufen gestellt). Die Hoppe gewährleisteten vorübergehend einen kurzfristigen Wasserabfluss über die „Außenhaut.“ Bei längerem Regen zog aber die Nässe ein und ließ das Heu verschimmeln und unbrauchbar werden. Solche Hoppe mussten später jestölep, jedrüch on verbrannt werden. Das ergab mächtigen stinkenden Qualm, der die ganze Umgebung beeinträchtigte.
hott on har
Heute ein Unding: Namensgebung für die Stall- und Weidetiere, beim Großbetrieb mit 50 Stück Rindern auf der Weide! Beim Eifeler Kleinbauern standen drei oder vier Kühe im Stall, und die hatten alle einen eigenen Namen, auf den sie hörten. Gängige Kuhnamen waren beispielsweise Minka, Schwitt, Olga, Fuss, Lona, und seltsamerweise auch Schweizer. Einen in Verbindung mit dem Namen gerufenen Befehl befolgte das angesprochene Tier sofort, beispielsweise rief der Hütebub Minka, hott eröm, und Minka bog gehorsam nach rechts vom Weg ab. Es gab eine Handvoll Befehle, die von den Tieren „verstanden“ und befolgt wurden: Nu jö, op de Wejd (Nun los, auf die Weide) oder ähnlich nu jö, aan de Baach (nun los, an die Tränke, - unsere Viehtränke war der Lohrbach), hott eröm (rechts herum, nach rechts), har eröm (links herum, nach links), jät monter (vorwärts, schneller, munter), oh jüüh (halt, stehen bleiben). Der Sammelruf zum Heimtrieb lautete Nu jö, op hejm aan. Auch bei den Fuhrleuten von damals waren hot und har Befehle zum Dirigieren des Gespanns. Heute gibt es keine Hütebuben und auch keine Fuhrleute mehr. Und der Traktor versteht kein Eifel Platt. Hott on har (rechts und links) ist schließlich auch ein Begriff für Ratlosigkeit: Kall net lang hott on har, saach endlich wat de wells (Rede nicht um den heißen Brei, komm endlich zum Kern der Sache).
höüfe
Wenn die Kartoffelsträucher auf dem Feld etwa 20 Zentimeter hoch gewachsen waren und trockene Witterung herrschte, wurde es Zeit, de Jrompere ze höüfe: Zwischen den einzelnen Reihen wurde eine Furche gezogen und dadurch die Pflanzenreihe beiderseits mit Erde angehäuft. Höüfe, regional auch höufele, hüwele oder höwele, bedeutet eigentlich „häufen,“ bezeichnet aber auch das Anhäufeln der Kartoffeln. Die Jrompere müssen jehöüf werden, damit die Knollen nicht ans Tagelicht kommen: Licht macht sie grün und ungenießbar. Das Gerät fürs Kartoffelhäufen war der Höufplooch (Häufelpflug), dessen schneepflugartige Schar verstellbar war und dem Reihenabstand angepasst werden konnte. Im Eifeldorf gab es meist einen oder zwei Höüfplööch (Plural), die reihum ausgeliehen wurden. Am Kasseschopp (Kassenschuppen) in Blankenheimerdorf stand ein Höüfplooch der Raiffeisenkasse zur Verfügung, neben weiteren Ackergeräten. Der leichte Pflug wurde von einem Gespanntier gezogen. Bei uns daheim war das unsere Schwitt, unsere älteste Kuh. Sie war aufs Jromperehöüfe regelrecht spezialisiert. Von uns Pänz am Zaum geführt, marschierte sie zielsicher zwischen den Reihen einher und nur ganz selten kam es vor, dass sie eine der Pflanzen zertrat. Wo jehöuf (gehäuft) wird, entsteht ein Houf (Haufen), mehrere Haufen sind Höuf. An der Ahr gibt es die Ortschaft Dümpelfeld, und dazu kannten meine Eltern ein interessantes Zitat: En Dömpelfeld, do litt et Jeld op Desch on Stohl op Höuf. Da lagen also die Groschen in ganzen Haufen auf Tisch und Stuhl, - Dümpelfeld muss eine reiche Ortschaft gewesen sein.
Houpmann
Das Wort wird „Ho-upmann“ gesprochen und bezeichnet in erster Linie den Offiziersdienstgrad „Hauptmann,“ gelegentlich aber auch eine besondere Führungsperson in einem Gremium. Hier heißt es allerdings dann oft houps Mann, was soviel wie wichtigster Mann, Vorsteher, Führer bedeutet. Ein anderes Wort für houps ist Höit, und das heißt „Haupt“ oder „Kopf,“ beispielsweise der Höit Jong (Hauptjunge, Anführer) der Kirmesgesellschaft. Für die einfachen Soldaten ist manchmal der „Spieß“ ein weitaus bedeutsamerer Houpmann als der Kompaniechef selber. In der Zeit zwischen 1967 und 1970 hielt die Fernmeldekompanie Butzweilerhof (Köln) der Bundeswehr zweimal im Raum Blankenheim ihr Herbstmanöver ab. Über die zweite Veranstaltung hatte ich für die Zeitung zu berichten und wurde von Hauptmann Larsen, dem Kompaniechef, zum Manöverball am Samstagabend im Saal Friesen eingeladen. Ein Teil der Soldaten kampierte für den Rest der Nacht im Flur unserer Schule, und da sah es morgens nicht besonders fein aus. Der „Spieß“ war außer sich, leider kenne ich seinen Namen nicht. Er ließ mich zuschauen, wie seine Mannschaften mit Schrupplomp und Schrubber den Schulflur säuberten und führte mich anschließend durch eine Fahrzeug- und Geräteschau am Blankenheimer Weiher. Da gab es auch einen MG-Stand, an dem ich sogar ein paar Schüsse abfeuern durfte. Mein immer noch „geladener“ Führer entdeckte unter den leeren Patronenhülsen zwei nicht abgeschossene Platzpatronen, - die beiden Soldaten am MG wären um ein Haar im Weiher gelandet.
Höüt
Wenn in meiner Kinderzeit mein Vater aus irgendeinem Grund ärgerlich oder sogar jeftich (giftig, böse) wurde, bediente er sich oft einer etwas seltsamen Redewendung: Bloos du mech em Höüt (wörtlich: Blas du mich im Haupt), was eine Umschreibung des Götz-Zitats bedeutete. In unserem Dialekt hat die Präposition höüt die Bedeutung von „Führer, Vorsitzender, Erster Mann,“ im übertragenen Sinne ist damit also das Haupt (Kopf) gemeint, und den bezeichnen wir im Dialekt als Höüt. Allgemein bekannt ist in unserer Eifel der Höüt Jong (Haupt-Junge, Anführer der Kirmesgesellschaft), und ihm zur Seite das Höüt Mädche. Im ländlichen Alltag unserer Eltern spielte das Höüt eine wesentliche Rolle. Unser Kohlgemüse nämlich wird wegen seiner runden und festen Form gerne als „Kopfgemüse“ bezeichnet, der Kohlkopf wird somit bei uns zum Kappeskopp (Kappes = Kohl). Das ist nun aber auch ein Wort für einen geistig etwas schwerfälligen Mitbürger, also formulierte man diesen Kopp zum Kappes-Höüt für unser Kopfgemüse um. Bei uns daheim wurde auf dem Rübenacker ein bestimmtes Areal für den wieße on ruëde Kappes (Weiß- und Rotkohl) reserviert, im Freiland gedieh das Gemüse am besten. Meistens wurden Spätsorten angebaut, im Spätherbst war Erntezeit. Die oft 30 und mehr Zentimeter durchmessenden Höüder (Häupter, Köpfe) wurden auf der metergroßen Schaav (Gemüsehobel, Schabgerät) zerschnitten und im mächtigen Stejndöppe (Keramikbehälter) im Keller als Suëre Kappes (Sauerkraut) angesetzt. Wir Hütebuben stibitzten uns gelegentlich ein Kappeshöüt von irgendeinem Feld, pflückten die grünen Außenblätter ab – die übrigens unseren Weidetieren hervorragend schmeckten – und verzehrten das rohe weiße „Herz“ der Pflanze, ebenfalls mit Genuss. Das war sogar gesund.
Hövvel (weiches ö)
Gelegentlich wird im Kreuzworträtsel nach dem Wort für „kleiner Berg“ gefragt. Das Lösungswort heißt Hügel, und den bezeichnen wir als Hövvel. Regional, in Nonnenbach beispielsweise und in den südlichen Ortschaften der Gemeinde Blankenheim, ist auch noch Hüwwel gebräuchlich, südwestlich von Schlemmershof gibt es zum Beispiel die Flurbezeichnung Kroohhüwwel (Krähenhügel), und in Blankenheimerdorf ist der Schloothövvel (Salathügel) in der Nähe von Olbrück ein Begriff. Ein weises altes Wort besagt mr moß ene Hövvel net für ene Berch hale und das bedeutet eine Warnung vor Übertreibungen. Ein klassischer Hövvel ist der allbekannte Maulwurfshügel, der bei uns Molthövvel (weiches o) oder auch Monthövvel genannt wird. Maulwurfshügel im Rasen und auf der Heuwiese sind seit jeher ein gewaltiges Ärgernis für den Besitzer, die fast blinden Tiere wurden und werden intensiv verfolgt, obwohl bestimmte Arten auf der Roten Liste stehen. Als Hövvel bezeichnen wir im Alltag auch gern eine größere Menge oder einen Haufen. Wenn beispielsweise die Kartoffelernte gut vonstatten ging, stellte der Bauersmann zufrieden fest: Höck hammer (haben wir) ene joode Hövvel Jrompere üßjedohn. Wenn besonders leckeres Essen auf den Tisch kam, schaufelte ich mir mehr als gewöhnlich auf den Teller und Jött hatte wieder einmal zu meckern: Jung du dejs dir jo ene Hövvel op dr Teller, als wennde vierzehn Daach nix ze eiße krijjen hätts.
Huhendall
Das „Hohental,“ ein Flurbereich östlich von Blankenheimerdorf im Bereich der belgischen Siedlung „in den Alzen“ in Blankenheim. Das Huhendall war noch nach dem Krieg ein kleines, aber beliebtes Ski- und Rodelparadies für uns Dörfer Jugendliche, heute ist es Neubaugebiet, über eine Erschließungsstraße gleichen Namens zugänglich und weitestgehend bebaut. Damals gab es in den Alzen noch keine Bebauung, das gesamte Hohental war Grünland bis hinab zur Bahnunterführung, wo heute der Busbahnhof ist. Unsere Skipiste führte von der bewaldeten Hügelkuppe oberhalb der heutigen Grundschule ins Tal, im unteren Teil gab es eine natürliche kleine „Sprungschanze“ in Gestalt eines Hubbels (Geländewelle). Unser Skigelände lag inmitten von eingezäunten Viehweiden, deren Stacheldraht uns naturgemäß arg störte und infolgedessen an den einschlägigen Pistenstellen „abgebaut“ wurde. Das ärgerte natürlich den Besitzer, der alljährlich seinen Zaun wieder reparieren musste. Es gab hin und wieder ein paar Jeftichkejte (Schimpfereien), ernsthafte Schwierigkeiten sind mir unterdessen nicht bekannt. Im Gegenteil: Der einsichtige Bauersmann baute an den einschlägigen Stellen leicht zu öffnende „Drahttore“ ein und hatte keinen Ärger mehr mit zerschnittenem Stacheldraht.
Huhkant
Fast jeder Körper, die Kugel ausgenommen, besitzt eine Huhkant, eine „Hochkante,“ eine „Schmalseite“ im Gegensatz zur „Flachseite.“ Eine vorspringende Leiste am oberen Türrahmen, am Schrank oder Wandregal, nannte man früher de Huhkant, daraus entstand die Redensart jät op de Huhkant läje (etwas auf die Hohe Kante legen), indem man dort Dinge versteckte, die so leicht niemand finden sollte, - in finanziellem Zusammenhang „sparen.“ Das Adjektiv ist huhkant, ein an der Wand lehnendes Brett beispielsweise stejt huhkant. Die Nacht vom 16. auf den 17. März 1974 verbrachte ich huhkant im „Novotel“ am Brüssel-Airport im belgischen Zaventem. In Sint Stevens-Woluwe war im Festsaal „Ons huis“ die „Verbrüderungsnacht“ gefeiert worden, ein Teil der Blankenheimer Gäste übernachtete im Novotel, als Zeitungsberichter teilte ich eins der breiten französischen Betten mit unserem Busfahrer. Gegen drei Uhr morgens kutschierte mich unser Gastgeber Romain Bliki ins Novotel. Als verantwortungsvoller Busfahrer, der uns am nächsten Tag wieder gesund nach Blankenheim bringen musste, war mein Zimmergenosse – er hieß Heinen, seinen Vornamen weiß ich nicht mehr – schon lange vor mir abgezogen. Er lag quer in unserem Bett und sägte an einem besonders knorrigen Eifeler Eichenast. Ich mochte ihn nicht wecken und nahm, huhkant auf der linken Seite liegend, mit dem mir zur Verfügung stehenden halben Meter Matratze vorlieb. Ich tat kaum ein Auge zu, mein Nachbar dagegen stellte am Morgen zufrieden fest: Hach, wat han ech joot jeschloofe.
Huhmess
Eine weitere Bezeichnung ist Huhamp (Hochamt), in Blankenheimerdorf war auch Huhmoss (weiches o) gebräuchlich. In allen Fällen ist eine feierliche kirchliche Festmesse gemeint, meist mit Gesang des Priesters unter Mitwirkung eines Chors. Als noch jedes Eifeldorf seinen eigenen Pastuër (Pastor, Priester) besaß, waren an allen Sonn- und Feiertagen zwei Messen an der Tagesordnung: Die „stille“ Fröhmess (Frühmesse) und meistens gegen 10 Uhr vormittags die festliche Huhmess. Längst haben sich die Zeiten geändert und damit auch die kirchlichen Feiern. Ich kann mich nicht entsinnen (im Jahr 2019), wann in Blankenheimerdorf zuletzt ein Festhochamt gefeiert worden wäre. Wegen des katholischen Nüchternheitsgebots – wir durften damals ab Mitternacht keine feste Nahrung mehr zu uns nehmen – war die um 07,30 Uhr beginnende Frühmesse von denjenigen Gläubigen bevorzugt, die die Kommunion empfangen wollten (dazu zählten in der Regel auf elterliche Anordnung auch wir Kinder). Für die Huhmess hätten wir zu lange „fasten“ müssen, kam man doch dabei erst um die Mittagszeit wieder zu Hause an. Bei der „normalen“ sonntäglichen Huhmess wurde der Priester durch zwei zusätzliche Ministranten assistiert – das habe ich selber häufig machen müssen – bei ganz seltenen hochfestlichen Anlässen war das Hochamt auch drei- oder sogar vierspännig besetzt. In der kleinen Eifelkirche war das gar nicht so unproblematisch: Im engen Altarraum standen sich die Zelebranten beinahe gegenseitig op de Fööß.
Huhwasser
Hochwasser ist eine Naturkatastrophe, gegen die wir weitgehend machtlos sind. Wolkenbruch, Dammbruch, Sturmflut, Tsunami, - dem Feuer können wir in vielen Fällen noch „aus dem Weg gehen;“ wenn plötzlich das Wasser kommt, können wir nur noch beten. Blangemerdörf liegt 540 Meter über NN auf Bergeshöhe und braucht Huhwasser und Überschwemmungen eigentlich nicht zu fürchten. Am 29. Mai 1956 allerdings, als der Kreis Schleiden von einem gewaltigen Wolkenbruch heimgesucht wurde, geriet man auch in Dörf in Bedrängnis. Selbst bei uns hoch auf dem Kippelberg konnte der Kanal die Wassermassen nicht mehr aufnehmen, unsere Küche stand kurzfristig unter Wasser, allerdings nur wenige Zentimeter hoch, Schaden entstand nicht. Aus der Gartenmauer von Keschesch Männ (Josef Rosen) uns gegenüber schoss mit mächtigem Druck ein armdicker Wasserstrahl zwischen den Bruchsteinen hervor. Im Telejelauch (heute Tilgenweg) entstand ein kniehoher See, auf dem das gehackte Brennholz aus der Nachbarschaft herum schwamm. Und Jüldens Häns (Hans Gölden) fischte seine Ferkelchen aus den Fluten, die das Huhwasser aus dem Stall gespült hatte. In Blankenheim-Wald stand der gesamte Bahnhof unter Wasser, die Unterführung war vollgelaufen, die Gleise überschwemmt. Das gesamte Urfttal war überflutet, zwischen Kall und Schmidtheim musste die Bahnstrecke gesperrt werden. Blankenheim war total überschwemmt, in Dahlem wurde die Ortsdurchfahrt durch aufgesprengte Kanalschächte unpassierbar. In Nettersheim fasste die Brücke am Bahnhof die Wassermassen nicht mehr, Das Elektrogeschäft Baden stand unter Wasser, weiter unterhalb der Brücke das gesamte Unterdorf, weil dort auch der Genfbach schwere Wassermengen heran führte. ein solches Huhwasser hatte es bei uns seit 1917 nicht mehr gegeben, wie die damalige „Eifeler Volkszeitung“ schrieb. Knapp sechs Jahre zuvor, am 22. Juli 1950, war Blankenheimerdorf von einem Hagelunwetter in nie erlebter Stärke getroffen worden. Damals wurde die gesamte Ernte zwischen Schmidtheim und Tondorf sowie zahllose Fenster und Hausdächer im Dorf zerstört, der Schaden war immens.
huppela
Ursprünglich hoppela als mundartliche Abwandlung von „hoppla,“ hat sich der Ausdruck besonders in der Kindersprache in huppela verwandelt. Wenn das Kleinkind beispielsweise üwwer de eije Fööß jestolepert war und längst am Boden saß, meinte die Mutter im Nachhinein noch besorgt: Huppela Herzje, fall mir net. Auch Ärger oder Unmut kommt durch huppela zum Ausdruck. Beim Kirmesball latschte der unbeholfene Dölefes (Adolf) seiner Tänzerin auf die Füße und Nies (Agnes) maulte böse: Huppela, dat woren de meng (…das waren die Meinen). An der Kasse im Supermarkt ging es nur schleppend voran. Eine „robuste“ Kundin drängte sich rabiat nach vorne und tönte gebieterisch: Huppela. Im Gedränge kommt es gelegentlich ungewollt zu einem leichten Rempler und man entschuldigt sich: Huppela oder auch huppela, T´schuldigung. Es war in den 1950er Nachkriegsjahren, bei uns im Saal Buhl gastierte das Wanderkino. Der Hauptfilm hatte begonnen, der Kassierer kam, die Blechkasse unterm Arm, vom Saaleingang herüber, stolperte in der Finsternis über den Rand der Kegelbahn und fiel der Länge nach auf die Nase. Klingelnd rollten die diversen Münzen über die Bodenbretter. Ob er sie wohl alle wieder gefunden hat? Immerhin, der Mann nahm es mit Humor, rappelte sich auf und erklärte: Huppela, do wär ech baal jefalle.
hutsche
Wenn wir Kinder Wintertags „mot Ieszappe“ (Eiszapfen) an Händen und Füßen – die Nase nicht zu vergessen – vom Schlittenfahren heim kamen und über die Kälte jammerten, wussten die Eltern Rat: Jank hutsch dech jät honner dr Herd, dann tüüste op (Geh und hock dich hinter den Herd, dann taust du auf). Hutsche ist auch heute noch in unserem Sprachgebrauch, es bedeutet hocken, hinhocken, hinkauern. Man hockt sich in den Kniekehlen, beinahe wie ein „Sitzen ohne Stuhl,“ auf den Fersen sitzen. Vierzehn Daach han ech eröm jehutsch, beklagte sich der allmählich genesende Klööß (Klaus) über zwei Krankheitswochen, et os für ze baschte, do hutschste eröm, kress nix jedohn on de Ärbed bliev lejje (nutzloses Her-umhocken, die Arbeit bleibt liegen). Unsere Eltern zogen gelegentlich drastische und „deftige“ Vergleiche. Von der Marktfrau beispielsweise behauptete man: Die hutsch do dr janzen Daach wie en Klotz (weiches e) op de Eier (wie die Henne auf den Eiern). Die Marktfrau besaß häufig auch einen Hutschpott („Hocktopf“). Das war ein mit Holz oder Kohle beheizbares kleines Öfchen – heute würden wir „Stövchen“ sagen – auf das man die Füße stellte, eine „Fußheizung“ sozusagen. Wenn in der Bauernstube die Buchenscheite im Ofen knackten und die Wärme „greifbar“ im Zimmer „stand,“ rieb sich der Besucher die Hände und lobte: Bie öch oß et ens emmer jät schön hutschelich wärm. Und wer suchet, der findet, beispielsweise ein hutschelich Plätzje für ungestörte Zweisamkeit.
Huus
Allgemeiner Ausdruck für das hochdeutsche Haus, aber auch eine Bezeichnung der Eifeler Küche. Im alten Bauernhaus gab es keinen Flur, von dem aus man das eigentliche Hausinnere erreichte. Durch die Haustür betrat man direkt die Küche, einen Raum des Hauses. Somit war man „im Haus“ und das gab wohl der Küche die Bezeichnung Huus. Der Boden im Huus bestand oft aus rohen Natursteinplatten, die Decke war nicht selten kohlschwarz vom Rauch des Backofens, wie beispielsweise bei uns daheim in Schlemmershof. Das Huus war sozusagen das „Zentrum“ des Bauernhauses, von hier führte die gewundene Owwenopstrapp (Treppe) ins Obergeschoß. Hier stand der aus Feldsteinen gemauerte Hausbackofen, dessen Rauchabzug unter der Küchendecke in einen hölzernen Rauchfang mündete. Unter dem Backofen führte die schmale und steile Kellertreppe hinab, die Kellertür befand sich meist unter dem verkleideten Aufgang der Owwenopstrapp. Im Huus standen der schwere Kochherd, ein ebenso stabiler Küchentisch und das Köcheschaaf (Schrank) aus massivem Eichenholz. Im Huus gab es schließlich noch den kleinen Zentrifugentisch mit der fest aufmontierten handbedienten Zentrifuuch, deren durchdringendes helles Arbeitsgeräusch noch draußen auf der Straße zu hören war. Die Beleuchtung bestand aus einer elektrischen 40 Watt-Birne mit weißem Emailleschirm, deren ohnehin dürftiges Licht durch die schwarze Küchendecke noch stark gedämpft wurde.
nach oben
zurück
|