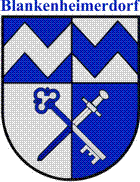|
Kaaf
Allgemein gebräuchlicher Ausdruck für die Spreu, den Abfall beim Getreidedreschen. Kaaf ist eigentlich kein echtes Mundartwort, es ist vielmehr vom hochdeutschen „Kaff“ abgeleitet, was ebenfalls Spreu bedeutet (Lingen 1978, Band 17). In der Vulkaneifel sagt man „Koof“ und bei unseren holländischen Nachbarn heißt es „Kaf.“ Ohm Mattes, mein Onkel, hat zeitlebens auf dem Kaafsack geschlafen. Das war ein bettgroßes, mit Kaaf gefülltes Kissen, das die Matratze ersetzte und Zeech genannt wurde. Als Unterbett war der frische Kaafsack weich und warm, mit der Zeit wurde er aber knubbelich und musste neu gefüllt werden. Die Matratze von heute hält unterdessen auch nicht ewig. Ein auch in Blankenheimerdorf üblicher Brauch war früher das Kaaf streuen in der Hielichnacht (heute Polterabend). Wenn Braut oder Bräutigam zuvor ein anderes Verhältnis gepflegt und dann aufgelöst hatten, wurde vom Hielighaus bis zum Haus des/der „Verflossenen“ eine Kaafspur auf die Straße gestreut und oft zusätzlich eine Stroh- oder Stoffpuppe mit verhöhnenden Plakaten angebracht. Bei uns wurde eine solche Puppe unter der Kastanie am Denkmalplatz aufgehängt, wo sie den Kirchgängern am nächsten Morgen ins Auge fiel. In diesem Fall führte dann die Kaafspur von der Puppe aus zum Haus des/der Verschmähten. Den Brauch gibt es seit den 1960er Jahren nicht mehr, seitdem auch das Dier jare (Tier jagen, siehe Dier jare) abgeschafft wurde. Aus einer solchen Kaaf- und Puppenaktion entstände heute unweigerlich eine Gerichtssache: Beleidigung, Ehrabschneidung, Hausfriedensbruch, Straßenverschmutzung und was weiß ich noch alles. Man kennt ja schließlich seine Rechte.
Kaasch
Der Kaasch oder auch Zweizannt (Zweizahn) ist ein Feld- und Gartengerät, eine massive Hacke oder Haue mit zwei flachen Zinken. Es gibt auch den Drejzannt (Dreizahn) mit drei Zinken. Der zweizinkige Kaasch war zur Zeit unserer Eltern ein unentbehrliches Gerät, in jedem Eifeler Bauernhaus gab es mindestens zwei Exemplare: Mit dem Kaasch wurden die Kartoffeln üßjekaasch (ausgehackt), und hierbei waren in der Regel mindestens zwei Mann im Einsatz. Der Kartoffelstrauch musste aus der Erde gehoben und die Früchte etwa zwei Meter weit nach hinten befördert werden, damit sie beim nächsten Durchgang nicht wieder zugedeckt wurden. Das geschah durch leichtes Flitschen mit dem Hackenzahn und erforderte eine gewisse Übung. Unsere Eltern beherrschten das Jrompereflitsche (Kartoffelflitschen) perfekt, der Laie flitscht fünfmal daneben und wenn er dann doch einmal trifft, fliegt die Kartoffel übers halbe Feld davon. Der Kaasch war auch das Werkzeug fürs Knöëdele kloppe (Zertrümmern harter Erdschollen auf dem Feld), – eine unsagbar mühsame Handarbeit, die aber für das Wachstum der jungen Kartoffelpflanzen unerlässlich war. Hierbei wurde mit dem Ouch (Auge, Oberteil) der Hacke auf die Erdklumpen losgedroschen. Das Arbeiten mit dem Kaasch wurde ganz allgemein kaaschte genannt, interessanterweise galt dieser Begriff unterdessen auch im Sinne von „die Flucht ergreifen, weglaufen.“ Wenn wir beispielsweise beim Stibitzen von Nachbars Äpfeln ertappt wurden, hieß es dringend nix wie kaaschte john (nichts wie weg). Und schließlich war das Adjektiv kaaschtich eine gängige Umschreibung für „Geiz,“ ein Kniesuhr (Geizhals) beispielsweise wurde auch als ene kaaschtije Hond bezeichnet.
Kabänes
Kabänes ist ein Ausdruck für etwas ungewöhnlich Großes, Mächtiges, für ein Prachtexemplar. Auch gibt es ein Getränk dieses Namens, in einem Karnevalshit der Höhner sagt der Wirt: han äwwer nur Kabänes, die Zechbrüder kommentieren: su ne Dreß, und „die Karawane zieht weiter.“ Die Herkunft des Wortes ist ungewiss, gebräuchlich ist es unterdessen fast ausschließlich im Rheinland. Alle Dinge, die über das normale Maß hinausgehen, sind in der Regel Kabänesse, ein besonders großer Baum beispielsweise, ein dicker Karpfen oder ein schwerer Felsbrocken. Ein gleichbedeutendes Wort, das den Kabänes in der Anwendung sogar fast „überholt“ hat, ist Kaventsmann, allerdings ist dies auch ein offizielles Wort aus der Seemannssprache und bezeichnet eine riesenhafte Wellenbildung auf dem Meer. Ein Kollege aus meiner aktiven Dienstzeit ist Urban Meyer aus Nettersheim. Er war Lokführer, kannte als solcher die halbe Bundesbahn und war überall bei seinen Kollegen beliebt. Seinen richtigen Namen kannten unterdessen die Wenigsten, als Kabänes dagegen war er landauf landab in Eisenbahnerkreisen ein Begriff. Verschiedentlich war Kabänes auch ein allgemeines Wort für den Liebhaber einer Dorfschönen (siehe: Kajöner), beispielsweise: Dat oß däm Schrengesch Liss senge Kabänes.
Kabejchel
Regional auch Kabeechel oder Kabeichel, Mundartwort für das Eichhörnchen. Das flinke Tierchen turnt bekanntlich kopfüber am Baumstamm abwärts, der Wortteil „kab“ ist vermutlich ein Hinweis auf diese Eigenart, möglicherweise bedeutet die Silbe aber auch nur eine Verniedlichung des Namens angesichts der Possierlichkeit des Nagers. Bei uns daheim war Kabejchel das allgemein übliche Wort. Ich erinnere mich, dass in meiner Kinderzeit im Holzschuppen daheim ein Kabejchelche unter einem umgestülpten Flechtkorb steckte. Das Tierchen hatte ein lahmes Hinterbein, ich weiß nicht mehr, wer es gefangen und unter den Korb gesteckt hatte. Ich jedenfalls wollte es unter seinem Gefängnis hervor holen, – und wurde ganz eklig in den Finger gebissen. Dabei entwischte das Hinkebein und verschwand für immer. In 2015 war ein munteres Kabejchel häufiger Gast am Vogelhaus vor unserem Fenster, wo es sich an den Sonnenblumenkernen gütlich tat. Aus drei Metern Entfernung dem Tierchen beim Futtern zuschauen, das war spannend und vergnüglich. In den 1980er Jahren war im vom Revierbeamten Otto Premper mit größeren Dachreparaturen an der Brotpfadhütte im Nonnenbacher Salchenbusch beauftragt. Am Abfallkorb vor der Hütte sah ich mehrfach ein fast schwarzes Kabejchel an Apfelresten knabbern. Das Tierchen war beinahe zutraulich, meine Anwesenheit störte es wenig. Ein auf die Außenbank der Hütte gelegtes Apfelstückchen wurde nach kurzem vorsichtigem Zögern angenommen, obwohl ich nur eine Armlänge davon entfernt saß. An den folgenden Tagen brachte ich Sonnenblumenkerne mit, die verzehrte mein kleiner Gast besonders gern.
kacke
Ein im Eifeler Dialekt üblicher „fieser“ und im Sinne des Wortes „anrüchiger“ Ausdruck für „Stuhlgang haben“ oder medizinisch auch „defäkieren,“ im Duden unter kacken zu finden. Hintergründig ist auch e Ei läje (ein Ei legen) in unserem Sprachgebrauch, und die derbe Soldatensprache kennt das Abprotzen. Beim Kleinkind heißt es mundartlich e Käckche maache oder vornehmer auch A-a machen, und daraus zog seinerzeit der deutsche Komiker und Entertainer Heinz Erhardt den Schluss, dass in Griechenland die Kinder Alpha-alpha machen. Kacke ist zwar angeblich vom lateinischen Wort cacare hergeleitet, irgendwie scheint es aber auch mit dem Griechischen verwandt zu sein, denn dort ist kakós das Wort für „schlecht, übel.“ In unserer Kinderzeit war Kakaasch ein abfälliges und beleidigendes Wort für einen kleinen oder schmächtigen Mitschüler. Kacke ist sogar bis in unser Farbspektrum vorgedrungen: Kakjell ist beispielsweise ein sehr hellgelber Farbton, und kakbrong beschreibt ein tiefdunkles Braun. Unsere Standardsprache selber kennt die Redewendung Da ist die Kacke am Dampfen, und das besagt, dass mit Ärger zu rechnen ist. Trotz aller Unfeinheiten: Kacke ist eine unverzichtbare und absolut lebensnotwendige Einrichtung, der Kölner kennt das so genannte Kackliedchen, und darin heißt es mit voller Berechtigung: Wennste nit mieh kacke kanns dann beste dud. In 1986 lag ich nach umfangreicher Darmoperation (Hemikolektomie) auf der Intensivstation in Mechernich. Zwei Tage lang hatte ich, trotz starker Schmerzmittel, massive Bauchschmerzen, weil die „Nahtstelle“ im Darm nicht durchlässig werden wollte. Dr. Kurt Udo Freiberger, der Chef der Station, raufte sich beinahe die Haare und wusste keinen Rat mehr. Am Morgen des dritten Tages drehte er mich auf die Seite und rief hocherfreut: „Der Vossen hat ins Bett geschissen, jetzt haben wir´s geschafft.“ Meine Bauchschmerzen waren weg, von da an ging es aufwärts.
Kadangs
Kadangs ist ein anderes Wort für Angs (Angst) und zielt eigentlich mehr in die Richtung von „Respekt,“ Die Belegschaft hat beispielsweise Kadangs vür dem Chef (Respekt vor dem Chef) und als Schüler hatte man stets ziemliche Kadangs vür dem Zeuchnis. In bestimmten Fällen stand und steht Kadangs aber auch als Ausdruck besonders großer Angst, sozusagen der Todesangst. Echte Kadangs in der Bedeutung von Muffensausen erlebte ich erstmals im Sommer 1944, als ich mit meinen beiden „großen“ Schwestern und ein paar Nachbarskindern im Schmidtheimer „Eichholz“ bei Nonnenbach beim Waldbeerenpflücken war. Über den Bäumen kreisten ein paar Feindflieger, die wieder einmal das nicht weit entfernte Munitionsdepot der Wehrmacht beim „Kaiserhaus“ mit Bomben belegten, was uns daheim unterdessen bisher kaum gestört hatte. Einer der Jagdbomberpiloten muss wohl unter den Bäumen Bewegung entdeckt haben, er strich mit seiner „Lightning“ dicht über den Baumkronen hin und feuerte mit dem Bord-MG in den Wald, – glücklicherweise weit genug von uns weg. Dann machte er kehrt und schoss aus der Gegenrichtung auf uns. Das tat er noch mehrmals, ohne uns jedoch zu treffen. Wir rannten wie die Hasen um einen etwa 20 Meter durchmessenden dicht bewachsenen Erdhügel herum. Als das Flugzeug endlich in Richtung Schmidtheim verschwand, verschwanden auch wir Hals über Kiopf in Richtung Heimat. Kaum hatten wir freies Gelände erreicht, als es im Eichholz gewaltig krachte, in der Richtung, aus der wir kamen, stieg Rauch über den Bäumen auf. Selber nicht mehr im Besitz von Bomben, hatte der Lightning-Pilot offensichtlich ein paar Kameraden angefordert und die Stelle bombardieren lassen, an der er uns unter den Bäumen entdeckt hatte. Seit diesem Tag hatte ich Kadangs vor den allgemein gefürchteten Doppelrumpf-Fliegern.
Kaffeekauch
Den Kaffeekauch (Kaffeekoch) traf man früher in jeder größeren Arbeitsgemeinschaft an, beispielsweise in der „Rotte“ bei der Bundesbahn. Die Leute arbeiteten weitab von Ansiedlungen auf der freien Strecke und führten ihre Verpflegung in der Mitt (Kochgeschirr, Essenbehälter) und in der Möüt (Feldflasche, Metallflasche) mit sich. Längst nicht jeder besaß eine Thermosflasche. Der Kaffeekauch war eigens dafür abgestellt, zum Frühstück für heißen Kaffee zu sorgen und zur Mittagspause die Essentöpfe pünktlich und möndchesmooß (mundgerecht) aufgewärmt zu präsentieren. Zum Handwerkszeug des Kaffeekochs gehörte eine große flache Blechwanne, die mit Wasser gefüllt und über dem Feuer erhitzt wurde. Im heißen Wasser wurden die Mitten aufgewärmt. Der Kaffeekauch war ein wichtiger Mann in der Gruppe. Er hatte für das leibliche Wohl seiner Kameraden zu sorgen und wehe ihm, wenn ihm einmal etwas danebenging. Ein altgedienter und erfahrener Kaffeekauch in der Rotte der Bahnmeisterei Kall, war zu meiner aktiven Bundesbahnzeit Karl Zimmermann aus Nettersheim. Er hatte unter anderem für ständigen Nachschub an „Kornkaffee“ fürs Rottenfrühstück zu sorgen, Karl hatte stets einige dieser weißen Pakete mit den dicken blauen Punkten auf Vorrat.
Kaffeewassong
Was ist aus Blankenheimerdorf geworden! Nach dem Krieg gab es bei uns im Dorf vier gutgehende Gaststätten, drei Bäckereien, Schmiede, Schumacher, Schreiner, – und nicht zuletzt sieben Geschäfte, die auch ihre Existenberechtigung besaßen. Heute ist von alledem nur noch eine Bäckerei da, es gibt ein Bürgerhaus, das man mieten kann und das für Kirmesveranstaltungen zu klein ist. Eins der früheren Kaufhäuser war die Gemischtwarenhandlung von Johann Wassong in der Woltersgasse in unserer Nachbarschaft auf dem Kippelberg. Johann Wassong betrieb zusätzlich eine Kaffee-Großrösterei und das trug ihm den Zunamen Kaffeewassong ein. Wenn bei Wassongs geröstet wurde, duftete der ganze Kippelberg nach Bohnenkaffee. Ich habe einmal zuschauen können, wie die aus dem Trichter fallenden Bohnen auf der rotierenden Platte von Hand sortiert wurden. In den 1960-er Jahren baute Johann Wassong oberhalb des kleinen alten Ladens das neue Geschäfts- und Wohnhaus mit moderner Ladeneinrichtung und ebenso modernisierter Rösterei. Wie die übrigen Geschäfte, so hatte auch Kaffeewassong sonntags morgens nach der Frühmesse seinen Laden eine Stunde lang geöffnet, insbesondere für die Kundschaft aus Nonnenbach, die auf diese Weise (Ladenschlußzeiten gab es nicht) den Kirchgang mit dem Einkauf verbinden konnte. Mein Onkel Matthias beispielsweise kaufte sich beim Kaffeewassong regelmäßig seinen Wochenvorrat an Rauchtabak.
Kajöner
Vielfach auch Kajönes genannt, bezeichnete das Wort ganz allgemein eine männliche Person, einen „Kerl“ oder „Burschen“ mit besonderen Eigenschaften, die ihn vom einfachen „Mann“ unterschieden. Das konnten sowohl positive als auch weniger gute Merkmale sein. Der pflichtbewusste Zeitgenosse beispielsweise war ene treue Kajöner, während es im gegenteiligen Fall Dat schengk mir ad esu ene Kajöner ze sen hieß, und das bedeutete, dass diesem Mann mit Vorsicht zu begegnen sei. In den meisten Fällen war der Kajöner unterdessen speziell der Begleiter einer Dame in der Öffentlichkeit. Kick ens, dat Liss hät ene nöije Kajöner, tuschelte die dörfliche Damenwelt, wenn sich die Freundin erstmals mit ihrem neuen Liebhaber zeigte. Der Kajöner war nicht zuletzt ein Kriterium für die jungen Burschen bei der Auswahl der Tänzerin auf dem Kirmesball. Wer da zum Beispiel wiederholt dieselbe Tänzerin bevorzugte, an den erging die gut gemeinte Warnung der Kumpels: Paß blos op, dat Jret hät senge Kajöner drbej, dä kick ad jeftich (Gretchens Begleiter schaut schon giftig). Ein ähnliches, aber nicht verwandtes Wort ist Kajützer, das gleichbedeutend mit Kabänes ist und einen ungewöhnlich schweren oder großen Gegenstand bezeichnet.
kakele (gedehntes a)
Gesprochen wird das Wort mit gedehntem a, vielleicht sollte ich besser kaakele schreiben. Es ist aber unverkennbar dem Holländischen entnommen, wird dort „kakelen“ geschrieben und bedeutet dort wie bei uns dasselbe: Gackern. Kakele ist in erster Linie ein Charakteristikum unserer Hühner, die mit schallendem Geschrei eine erfolgreiche Eiproduktion verkünden. Dabei sagt unterdessen das Sprichwort: Et Hohn, wat am lauteste kakelt, lääch noch lang net emmer de beste Eier, was frei übersetzt bedeutet, dass der lauteste Schreier längst nicht immer der Beste ist. Kakele lässt sich aber auch auf den Menschen übertragen: Wenn in einer Gruppe lauthals, keifend und schreiend diskutiert wird, herrscht dort Jekakels wie em Hohnerstall (Gackern wie im Hühnerstall). Kakele erinnert mich an den amerikanischen Soldaten, der seinerzeit unserer Jött das Gewehr vor den Bauch hielt und wiederholt „äck“ verlangte. Dass der Mann „Egg“ sagte und „Ei“ meinte, begriffen wir erst, als er wie ein Huhn zu gackern begann. Kakele war nicht zuletzt eins der ersten Wörter, die ich bei Dechant Hermann Lux im Lateinunterricht lernte: „Gallina clamat“ heißt auf Deutsch „Das Huhn schreit“ (gackert), und wir Dörfer übersetzen das in unser Platt: Et Hohn kakelt.
Kalekbrööt
Als es noch keine Dispersionsfarben und erst recht keine speziellen Fassadenfarben gab, war Kalekbrööt (Kalkbrühe) d a s Mittel besonders für den Außenanstrich des Eifelhauses. Einfacher Löschkalk wurde mit Wasser vermischt, - fertig war die Kalekbrööt. Weiß wurde sie gebraucht, um dr Jewwel ze käleke (den Giebel zu kalken), ein Schuss Oker (Ocker-Farbpulver) oder Umbra wurde beigemischt, wenn et Huus (Eingangsbereich des Eifelhauses = die Küche) zur Kirmes neuen Glanz erhielt. Auf die hellgelben Wandflächen im Huus wurden mittels selbst gebastelter Schablonen und gefärbter Kalekbrööt dekorative Blumenmuster aufgemalt. Auf dem Gymnasium hatten wir in „Kunst“ die Aussagekraft von „Formen und Farben“ kennen gelernt, ich dekorierte also daheim unsere Küchenwände mit ein paar Dreieckskombinationen, aus denen Picasso möglicherweise eine „weinende Frau“ herausgelesen hätte. Unsere Dörfer Mitbürger schüttelten allerdings nur staunend den Kopf. Kalekbrööt war wenig dauerhaft, sandete nach dem Abtrocknen und ließ sich relativ leicht vom Untergrund abreiben. Zur Erhöhung der Haltbarkeit kam ein kräftiger Guss Magermilch in die Brühe, ein offenes Geheimnis war auch die Zugabe einer geringen Menge Urin, so seltsam das auch scheinen mag. Mein Onkel Stoffel (Christoph) aus Esch in der Verbandsgemeinde Obere Kyll war Anstreicher von Beruf, für ihn war das ungewöhnliche Farbmischverfahren eine Alltäglichkeit.
Kamasche
Wenn der Eifelbauer wintertags en dr Bösch (in den Wald = zum Holzfällen) ging, trug er in der Regel kräftige Ledergamaschen als Beinschutz sowohl gegen die Kälte als auch gegen das oft sperrige Unterholz und Geäst. Bei Rodungsarbeiten waren de Kamasche nützlich wegen der dornigen Brombeerranken, und Hausschlachter Theodor Baales aus Blankenheimerdorf trug die lederne Wadenbekleidung häufig bei seiner Arbeit: Schutz vor Sengfeuer und heißem Brühwasser. Die massiv-ledernen „Beinlinge“ reichten bis über die Schuhe herab und umschlossen den Unterschenkel bis unters Knie. Der Lederschutz wurde um die Waden gelegt und über dem Fußgelenk durch eine Steckvorrichtung geschlossen, der Schaft wurde am oberen Ende durch einen schmalen Riemen oder durch einen Hakenverschluss gebunden. Die Kamasche wurden über dicken Strümpfen getragen oder einfach über die Hose geschnallt. Im Krieg, wenn der Schandarm (Polizist) wie ein Blitz aus heiterem Himmel über das Bauernhaus herfiel und „Inspektion“ hielt, trug er wadenstramme braune Ledergamaschen. Vor dem Schandarm hatten die Leute Kamasche und das bedeutete, dass sie ihn fürchteten. Der Ausdruck Kamasche ist auf das französische Wort gamache zurückzuführen (Wikipedia).
Kamer
Neben der Stov (gute Stube, Wohnzimmer) und nur von dort aus zugänglich, gab es im Eifelhaus in aller Regel die Kamer (Kammer), ein kleines Nebenzimmer, das Schlafgemach der Eltern oder des Hausherrn. Bei uns daheim schlief Ohm Mattes in diesem kleinen Raum, der neben Bett und Näächskommödche gerade mal einen Kleiderschrank und einen Waschtisch aufnehmen konnte. De Kamer war die allgemeine Bezeichnung, die auch in Holland üblich ist und dort offiziell für „Zimmer, Stube“ angewandt wird. Über der Kamer lag bei uns daheim im Obergeschoß ein gleich großer Raum, Kämerche (Kämmerchen) genannt, das bei den Niederländern „Kamertje“ heißt. Das Kämerche war vom Jang (wörtlich = Gang) aus erreichbar, dem breiten, flurartigen Treppenabsatz. Das Kämerche diente mehr oder weniger als Gästezimmer, wenn Tant Marie aus Köln auf Besuch kam. Hier stand anstelle des Kleiderschranks eine schwere eisenbeschlagene Truhe aus Eichenholz, de Kess (die Kiste) genannt. Einen Blick in die Eifeler Kamer konnte man seinerzeit im Freilichtmuseum Kommern tun. Mit „huch“ und „hach“ begaffte eine aufgetakelte „Touristenfregatte“ das winzige Zimmerchen und stöhnte am Arm ihres muskelstrotzenden Begleiters: „Nein, Egon, stell dir vor, wie die hier . . . “ Der Rest war ein bezeichnendes Kichern. Ich hätte die Tante ohrfeigen mögen, da das aber untunlich gewesen wäre, suchte und fand ich auf der Stelle das Weite.
Kamerpott
Dieser „Kammertopf“ erscheint uns heutzutage als ein fieses (hässliches) und unhygienisches Gerät. Ein solches war es auch. Der in der Regel weiß emaillierte Topf ist gottlob völlig aus der Mode gekommen, wenn man einmal von der artverwandten Bettpfanne im Krankenhaus absieht. Als aber die „Entsorgung“ noch über das „Herzhäuschen“ hinter dem Haus erfolgte, war der Kamerpott unter dem Bett oder im Nachtkommödchen geradezu unentbehrlich. Wer dringend aus dem warmen Bett musste, der wusste dieses Nachtgeschirr sehr wohl zu schätzen, ersparte es ihm doch den Gang durch Schnee und Kälte zum Abtrett, durch dessen breite Bretterritzen der Winterwind pfiff. Es gab eine Menge verschiedenerartiger Bezeichnungen für den Kamerpott, Näächsjeschier (Nachtgeschirr) beispielsweise, „Mitternachtsvase,“ etwas hinterhältig Brölldöppe (Brülltopf) oder einfach nur dr Pott. Und selbstverständlich auch die unvermeidlichen Bezeichnungen aus der Gossensprache, die hier aber unerwähnt bleiben sollen. Eine erfreuliche Erscheinung ist dagegen das Kindertöpfchen: Baby auf seinem „Thrönchen,“ – das Foto fehlt auch heute noch in keinem Familienalbum.
kamesööle (harte ö)
Es gibt eine positive und eine negative Deutung dieses Mundartausdrucks. Der Positive zuerst: Wenn Klein-Albertchen seinen Teller ratzeputz leer gegessen hatte, verkündete er stolz: Ech han dr janze Teller verkamesöölt. Die weniger angenehme Version von kamesööle ist „verprügeln.“ Das eine oder andere Eifeldorf stand früher wegen wiederholter Kirmes-Schlägereien in wenig gutem Ruf: Do wiëd sech rejelmäßich kamesöölt. Damals wie heute gab es Stänkerer und Hetzer, die auf Randale aus waren und von den Besonnenen gewarnt wurden: Net dat se dech ens verkamesööle (Nicht dass du mal Prügel beziehst). Früher trugen die Männer warme Unterjacken, Kamesol genannt, und jemandem aan et Kamesol john (ans Kamesol gehen) hieß ihm auf den Leib rücken. Daraus entstand vermutlich kamesööle als allgemeines Wort für prügeln. Den Ausdruck Kamesol gibt es heute noch hier und da als allgemeiner Begriff für die Kleidung. Als es die Jeanskleidung noch nicht gab, unterschieden die Leute noch zwischen Joot Kamesol (Gute Kleidung = Sonntagskleidung) und Ärbedskamesol (Arbeits-, Alltagskleidung). An Feiertagen trug man das Fesskamesol, zu besonderen Gelegenheiten gab es auch besondere Anziehsachen: Das Huhzittskamesol (Brautanzug) beispielsweise, oder auch das Kirmeskamesol.
Kanegg
Die Kanegg, regional auch „Knegg“ oder „Knigg“ genannt, war die massive Handbremse am Heck des eisenbereiften Ackerwagens. Bei schweren Fahrzeugen, etwa beim Langholzwagen, gab es gelegentlich auch an den Vorderrädern eine Kanegg. Die eigentliche Kanegg war die eiserne Handkurbel, die über eine Drehspindel und entsprechendes Hebelwerk die beiden hölzernen Bremsblöcke gegen die Eisenreifen der Räder drückte. Wenn dabei Steinchen zwischen Block und Reifen gerieten und zermahlen wurden, entstand ein nervtötendes Knirschen und Kreischen. Der „Bremser“ an der Kanegg, etwa beim beladenen Heuwagen, musste viel Fingerspitzengefühl besitzen. Bergab musste so gebremst werden, dass der Wagen gerade noch rollte und die Zugtiere nur lenken mussten. Wenn bergauf die Zugtiere einmal puëse (pausieren, verschnaufen) sollten, musste auf Zuruf des Fuhrmanns blitzschnell so stark zojedräht (zugedreht = Bremse angezogen) werden, dass der Wagen zum Stehen kam, ohne auch nur eine Handbreit zurückzurollen. Beim erneuten Anfahren musste ebenso rasch opjedräht (Bremse gelöst) werden. Beim Heu- oder Getreidewagen die Kanegg bedeene (Bremser spielen) war eine undankbare Sache: Man musste gebückt, mit der Hand an der Kurbel, unter der überhängenden Ladung gehen, Stöb on Jrömmele (Staub und Krümel) gerieten unters Hemd und kratzten jämmerlich auf der schweißnassen Haut.
Kappes
Sankt Martin ritt durch Kappes on Schawuër, do koom dä Buër on schlooch en aan e Uër, – wenn Sankt Martin seinerzeit, diesem abgewandelten Liedtext folgend, durch Kohl und Wirsing geritten wäre, so hätte er sich durchaus ein paar Ohrfeigen seitens des Feldbesitzers einhandeln können. Kappes ist bekanntlich unser unentbehrlicher Weißkohl, ohne den es den Suëre Kappes (Sauerkraut) nicht gäbe, unsere Nationalspeise, die uns im Krieg bei den Amis den Spitznamen „Krauts“ eintrug. Das abwertende Verzäll doch kejne Kappes (Rede doch keinen Kohl) ist angesichts der hohen Bedeutung der Pflanze als Nahrungsmittel eigentlich absolut fehl am Platz, wird aber häufig angewandt. Und schließlich ist auch nur im Eifeler Dialekt jeder Kohl ein Kappes. In den 1950er Jahren gab es bei uns einen, wegen seiner Strenge gefürchteten Führerscheinprüfer namens Kappes. Auf der Prüfungsfahrt durch Schleiden geriet ich beim Schalten im nur teilsynchronisierten Getriebe des VW ans falsche Zahnrad. Das fürchterliche Ratschen hätte normalerweise „aussteigen, in vierzehn Tagen wiederholen“ zur Folge gehabt. Herr Kappes war aber offensichtlich heute gut gelaunt: „Macht nichts, ist ja Pfeiffers Auto.“ Paul Pfeiffer aus Blankenheim war unser beliebter Fahrlehrer.
Karels Mechel
Karels ist der Hausname der Familie Jentges im Ortsteil Kippelberg in unserer mittelbaren Nachbarschaft in Blankenheimerdorf. Der Hausbesitzer Michael Jentges, ortsüblich Karels Mechel genannt, war ein Begriff in seinem Heimatort und hat dessen Geschichte deutlich mitgeprägt. Jahrzehntelang war Kares Mechel Organist und Leiter des Kirchenchores, zeitweise auch Küster im Dörf, die Amerikaner setzten ihn nach dem Krieg als ersten kommissarischen Nachkriegs-Bürgermeister von Blankenheimerdorf ein. Der berufliche Kleinlandwirt hat uns eine Menge wertvoller privater Aufzeichnungen aus den Kriegsjahren hinterlassen, er hat auch jahrzehntelang die Poststelle des Ortes geführt, er war Postbote und Zusteller für Blankenheimerdorf, Blankenheim-Wald und die Altenburg. Karels Mechel starb im Oktober 1979 mit 87 Jahren, seine Tochter Christel Jörres führte die Poststelle weiter, das „Office“ lag gleich neben der Haustür links im Flur des Karels-Anwesens, es gab da ein kleines Schalterfensterchen in der Flurwand für den Brief- und Päckchendienst, für größere Paketsendungen gab es einen separaten Zugang. Noch gut habe ich Karels Mechel in Erinnerung, wie er als Zusteller mit dem hochbepackten Fahrrad durch unseren Ort zog, hier ein paar Briefe an die Haustür brachte, dort ein Paket ablieferte. Es gab wohl kein Haus im Dorf in dem Mechel nicht ein- und ausgegangen wäre. Mich nannte er stets Jerhann und das war vermutlich auf seinen Bruder Johann Jentges zurückzuführen, der in Sichtweite von Karels wohnte und den Mechel ebenfalls mit Jerhann anredete.
Kässack
Zur deutlicheren Definition sollte man besser Käs-Sack schreiben, es handelt sich nämlich um einen „Sack“ zur Herstellung von Klatschkäs (Quark), der früher in jedem Eifeler Bauernhaus fabriziert wurde. Bei uns daheim war es ein weißer Leinenbeutel, in den unsere Jött die Dickmilch zum Abtropfen tat. Ich sehe den Kässack noch jetzt am Balken unter der schwarzen Küchendecke hängen, auf einem Stuhl darunter stand ein Döppe (Topf, Schüssel) zum Auffangen der Flüssigkeit. Artverwandt war der Press-Sack (Presssack!) zum Auspressen von Obstsaft, der aber aus einem einfachen Tuch bestand, dessen Zipfel hochgeschlagen wurden und so einen provisorischen Beutel bildeten. Das genaue Rezept ist mir nicht bekannt, ich meine aber mich entsinnen zu können, dass die Dickmilch mit Buttermilch vermengt wurde und längere Zeit „ziehen“ mußte. Dann kam dieses Gemenge in den Kässack. Nach dem Abtropfen war der hausgemachte Quark eigentlich verzehrfertig, Jött verdünnte ihn meistens noch leicht mit Frischmilch. Unser Klatschkäs schmeckte ganz leicht säuerlich, dick auf die Brotschnitte geklatscht war er eine Köstlichkeit. Zur Gewinnung von Suër Melech (Sauermilch, Dickmilch) standen bei uns ständig etliche Stejndöppe (Steintopf, Keramik) mit Rohmilch herum, aus der sich die Dickmilch, auch Klattermelech genannt, von selber bildete. Ich selber habe die Sauermilch nie gemocht und mag sie auch heute nicht. Die Erwachsenen daheim fielen aber beinahe über solch ein Döppe her, wenn sie von schwerer Arbeit in brüllender Hitze – etwa bei der Heuernte – nach Haus kamen. Genüsslich löffelten die „Großen“ ihre Dickmilchpötte leer: Kühle Labsal in der Hitze, so schworen sie.
Kasseschopp
Ein typisches Blankenheimerdorfer Wort, übersetzt „Kassenschuppen“. Es bezeichnete die große Halle im Ortsteil Zollstock, in der die Dreschanlage der Raiffeisenkasse untergebracht war. Die Genossenschaftsbank stellte damals in vielen Gemeinden landwirtschaftliche Geräte - Pflug, Kultivator, Egge, Ackerwalze - zur Verfügung, die gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen werden konnten. Ebenso unterhielt die „Raika“ Dreschanlagen wie den Kasseschopp in Blankenheimerdorf. In einem kleinen Nebenbau stand hier auch ein „Trieur“ (Reinigungsmaschine für Saatgut) zur Verfügung. Im Ähr (Erntemonat, August) war am Dreischkaaste (Dreschkasten) täglich Hochbetrieb bis spät in die Nacht. Der Mähdrescher hat längst den Dreschkasten verdrängt, der Kasseschopp wird heute privat genutzt. Typisch für den Dörfer Kasseschopp war der auf Schienen laufende Holzverschlag, der außerhalb der Halle stand und in dem der mächtige elektrische Antriebsmotor der Dreschanlage untergebracht war. Der breite Treibriemen mag sechs oder acht Meter lang gewesen sein, durch die Länge war die Elastizität des Antriebs gewährleistet. Die Kaaf (Spreu) wurde beim Dreschen über ein Rohr nach draußen geblasen, wo sich mit der Zeit ein mächtiger Kaafberg bildete, - ein nicht ganz un- gefährlicher „Spielplatz“ für die Dorfkinder.
Kasteieboum (Bild)
Der Ausdruck hat absolut nichts mit „kasteien“ gemeinsam, dem hochdeutschen Wort für asketische Lebensweise oder Selbstzüchtigung. Unser Kasteie wird Kaschteie ausgesprochen, ist der Plural von Kaschtei und bedeutet „Kastanien.“ Die wunderschönen braunroten Früchte waren ein beliebtes Spiel- und Bastelobjekt. Leider gab es daheim in Nonnenbach keine Kastanienbäume, wir Pänz nutzten also den sonntäglichen Kirchgang nach Blankenheimerdorf und stopften uns dort am Denkmalsplatz die Taschen voll Kaschteie, sofern sie nicht schon von den Dörfer Pänz aufgesammelt wurden. Der riesenhafte Kasteieboum am heutigen Dechant Lux Platz ist geradezu ein Wahrzeichen von Blankenheimerdorf. Hier hängt seit Menschengedenken das Schwarze Brett, hier stand auch früher das Spritzenhaus. Bürgermeister Johann „Schang“ Leyendecker und auch sein Nachfolger Toni Wolff richteten nach der Messe ihren Neujahrsgruß unter dem Kasteieboum an die Dorfbevölkerung. Und am 01. August 1971 spielten die Uedelhovener Musikanten unter Franz Josef Groß beim Sonntagskonzert unter dem Blätterdach unseres Kasteieboums die Mosch-Weise „Unterm Kastanienbaum hab ich dich einst geseh´n.“ Solche Darbietungen heimischer Musikvereine waren damals vom Kur- und Verkehrsverein Blankenheim als Besonderheit für die Touristen angeregt worden, wurden aber nach relativ kurzer Zeit leider wieder eingestellt.
Katejissem
Ein beinahe unheimliches Wort, man muss es mehrmals und intensiv lesen, um den Sinn zu begreifen: Katechismus, den wir auch als „Handbuch des christlichen Glaubens“ bezeichnen können. Zu meiner Kinderzeit gab es für uns Schulkinder den Klejne Katejissem. Das war ein handliches Lehrbuch, das wir aber nur für die Chreßlich Liehr (Christenlehre) bei Dechant Lux in Blankenheimerdorf brauchten, in der Schule war Religionsunterricht von der „braunen“ Regierung untersagt. Unser Katejissem begann mit der dogmatischen Frage: Wozu sind wir auf Erden und die Antwort mußten wir auswendig lernen: Wir sind dazu auf Erden, dass wir den Willen Gottes tun und dadurch in den Himmel kommen. Warum eigentlich belächelt man heute diesen Lehrsatz? Der Herrgott verlangt ganz sicher nichts Schlechtes von uns, – sind Mord und Terror, Porno und Horror, Korruption und Raub „vernünftiger“ als die Gottesgebote? Der Klejne Katejissem enthielt auch eine Menge Bilderzeichnungen. Das erste Bild zeigte einen Engel, der ein Kind über einen schmalen Steg geleitet. Der Engel besaß mächtige Flügel und war für mich das Leitbild für meinen persönlichen Schutzengel. Den nämlich gibt es, da bin ich mir sicher. „Mohr noo dr Aandaach os Katejissem, kannste och alles?“ Dechant Lux hielt den Katechismusunterricht häufig in der Kirche in Anschluss an die Sonntagsandacht ab oder auch privat im Pfarrhaus. Da hatten auch wir Nonnenbacher Kinder teilzunehmen und Mutters obige Erkundigung war tagesüblich. Wer seinen Katejissem gut ge- lernt hatte und die Fragen auswendig beantworten konnte, dem widerfuhr des Pfarrers Lob und Lohn in Gestalt eines Heiligenbildchens, oft sogar mit einer Widmung auf der Rückseite. Gelegentlich galt das Bildchen als „Zeugnis“ für die Religionstüchtigkeit des Besitzers, in der Schule gab es das Fach „Religion“ ja nicht, außerdem war unserem Pfarrer der Zutritt zur Schule „wegen politischer Unzulässigkeit“ untersagt. Ein solche Zeugnisbildchen aus dem Jahr 1943 von meiner Schwester Ursula ist in meinem Besitz, „Gut – recht gut“ lautet des Pfarrers Note auf der Rückseite. Mit Katejissem bezeichnet man auch heute noch gelegentlich eine spezielle Pflicht oder Aufgabe. Vor einer wichtigen Prüfung beispielsweise wird der Teilnehmer gefragt: Häste och denge Katejissem joot studiert?
Katrill
Bei diesem Ausdruck handelt es sich um die „Vermundartlichung“ des französischen Wortes „Quadrille,“ was soviel wie „Viererformation“ bedeutet und früher ein beliebter Gesellschaftstanz war. Zur Zeit unserer Eltern verging kein Tanzabend, ohne dass wenigstens einmal zur Katrill aufgespielt wurde. Als nach dem Krieg die moderne Tanzmusik aufkam, verschwand die Katrill vom Kirmesball, im Tanzunterricht der 1950er Jahre wurde die Quadrille schon nicht mehr gelehrt. Einzelne Senioren pflegten unterdessen den altbeliebten Tanz weiter, in Blankenheimerdorf waren das vor allem Manns Pitter (Peter Schlemmer), Konsums Ann (Anna Rosen) und Kuhle Klööß (Nikolaus Görgens). Die Quadrille wurde um 1820 in Deutschland als „Les Lanciers“ (Die Ulanen) eingeführt, im Eifeler Dialekt Lanzië genannt. Lanciers war der eigentliche Name des Tanzes, Quadrille bezeichnete lediglich die Tanzformation. Die Katrill wurde als Formation von vier Paaren getanzt, die sich im Quadrat gegenüber standen. Die klassische französische Quadrille bestand aus fünf „Figuren,“ von denen uns eine aus dem Kreuzworträtsel geläufig ist: „Ete,“ das französische Wort für „Sommer.“ Als „Les Lanciers“ war der Tanz in ganz Europa bekannt, in den deutschsprachigen belgischen Ortschaften um Elsenborn und Büllingen wird er heute noch gepflegt (Quelle: Wikipedia).
Katzekuhl
Vom Wort her müsste die Katzekuhl eigentlich eine Senke oder Grube sein (Kuhl = Grube, Kuhle). Tatsächlich handelt es sich aber um das genaue Gegenteil, nämlich um die Anhöhe links der Kreisstraße K.69 zwischen Blankenheimerdorf und Nonnenbach im Bereich „Maiheck.“ Katzekuhl bedeutet „Katzengrube,“ woher der Höhenrücken seinen Name hat, – keiner weiß es. Verschiedentlich taucht auch die treffendere Bezeichnung Katzeberg auf. Das Gelände zählt heute zum Naturschutzbereich Seidenbachtal – Froschberg, bedingt durch den Kalk-Magerboden gedeiht auf der Katzekuhl unter anderem die prächtige dunkelviolette gemeine Kuh- oder Küchenschelle, die wir Kinder wegen ihrer „Giftigkeit“ nicht zu berühren wagten. Auf der Katzekuhl wächst ebenfalls, allerdings nur vereinzelt, das Flejeblömche (Fliegenblümchen), die recht seltene Fliegen-Ragwurz oder Fliegenorchidee, auf deren Vorhandensein uns seinerzeit erstmals Dechant Hermann Lux aufmerksam machte. Noch nach dem Krieg gab es op dr Katzekuhl vereinzelte Waachhecke (Wacholderbüsche), die aber bei den Bauern aus Blankenheimerdorf und Nonnenbach als „Würzkraut“ beim Röüche (Räuchern) begehrt waren und so gut wie ausgerottet sind. Direkt an der Kreisstraße, die damals noch Gemeindeverbindungsstraße war, sind noch zwei kleinere alte Steinbrüche sichtbar, hier wurde das Material für den Ausbau der schmalen Straße gewonnen. Auf der Höhe der Katzekuhl hatte die Wehrmacht Unterstände und MG-Stellungen angelegt, dabei kam weißer Sand ans Tageslicht, später gruben hier die Leute weiter und holten sich kostenlosen Putz- und Mauersand. Im Berghang zu Thommesdall (Thomastal = Flurname) hatte die Wehrmacht unter einen Gruppe dichter Buchen eine Baracke errichtet, die sie „Villa Duck dich“ nannten. Hier kampierte die Besatzung einer 20 Millimeter-Vierlingsflak, die nahebei im Wald auf dem Maihecker Kopp (Flurname) stand. Nach dem Abzug der Amerikaner im Frühjahr 1945, fanden ein Schulkamerad und ich auf der Katzekuhl zwei gerippte amerikanische Handgranaten, die wir „fachmännisch“ scharf machten und über die Straße hinweg in den Bergabhang zum Jöllendall (Gillental = Flurname) warfen. Nach der Explosion galoppierte eine Wildsau aus dem Gebüsch am Berghang.
Kau (kurzes au)
Unser Wort für die hochdeutsche „Kaue,“ die in der Bergmannssprache das Gebäude über dem Schacht und außerdem den Wasch- und Umkleideraum der Bergleute bezeichnete (Waschkaue). Ganz allgemein ist unsere Kau ein grober Bretter- und Lattenverschlag, gelegentlich auch ein Tierkäfig: Die Holländer sagen „Cooi,“ das ist offensichtlich mit der „Koje“ der Seeleute verwandt, bedeutet aber „Käfig.“ Gehässig oder spöttisch bezeichnen wir ein baufälliges altes Haus als Kau, ebenso ein vernachlässigtes kleines Zimmer: Die ahl Kau mööch ech noch net ens jeschenk (Die alte Hütte möchte ich nicht mal geschenkt), oder auch Wie kammer blos en esu ener Kau huuse (Wie kann man nur in einer solchen Bruchbude hausen). In Anlehnung an die Koje gibt es die Redewendung en de Kau läje (in die Koje, ins Bett legen). Wenn bei der Bundesbahn auf der freien Strecke eine länger dauernde Baustelle eingerichtet werden mußte, dann gehörte dazu auch de Kau. Das war ein transportables Büdchen, meistens aus Wellblech hergestellt, das einen Telefonanschluß erhielt und die „Bauleitung“ aufzunehmen hatte. Bei Arbeitsschluss wurden auch die einfachen Werkzeuge in der Kau verwahrt. Eine sehr bekannte Kau und auf jedem Bauernhof zu finden, war die Hondskau, die meist selbst gezimmerte Hundehütte. Die Hondskau diente manchmal auch als Versteck beim Sööke spelle (Suchen spielen = Versteckspiel), allerdings roch es in dem engen Gehäuse immer unangenehm nach Hund und die Kiste war voller Haare. In der mageren Nachkriegszeit stiegen Einbrecher bei unserem Nachbarn durch ein Kellerfenster ein und klauten die unendlich kostbaren Hälften der frisch geschlachteten Sau. Bei uns wurde daraufhin schleunigst ein „Laufdraht“ gespannt, an dem unser Schäferhund „Tell“ von der Kau aus den gesamten Hof einschließlich der Kellerlaucher (Kellerschächte) kontrollieren konnte.
Kellerlauch
Auf dem Eifeler Bauernhof gab es früher eine Reihe von „Löchern“ mit ganz bestimmter Funktion und entsprechender Bezeichnung, einige Beispiele: Heulauch (Heuluke), Maarlauch (Jauchegrube), Piefelauch (Wanddurchführung für das Ofenrohr), Hohnerlauch (Hühnerdurchschlupf in der Stalltür), Eischelauch (Aschengrube unter dem Backofen). Eine besondere Funktion besaß auch das Kellerlauch (Kellerloch), das fälschlicherweise manchmal auch „Kellerfenster“ genannt wurde. Das Kellerlauch nämlich war ein durch die Außenwand in den Keller hinab führender fensterloser Schacht, ein offenes „Loch“ also, das lediglich ein herausnehmbares Eisen- oder Holzgitter als Verschluss besaß und somit unter anderem der Belüftung des Kellers diente. Das Kellerlauch mündete über der geräumigen Kartoffelbox und ermöglichte somit ein bequemes Einkellern der vom Feld kommenden Ernte. Die umfasste in der Regel einen stattlichen Berg der goldenen Erdfrucht: Kartoffeln waren, neben dem Brot, das Hauptnahrungsmittel des Eifelbauern, und wo, wie bei uns daheim, acht Mäuler zu stopfen waren, da läpperten sich leicht etliche Zentner Jrompere (Kartoffeln) zusammen. Beim Einkellern rollten die Kartoffeln über einen schrägen Lattenrost ins Kellerlauch, dabei löste sich zum Großteil die etwa noch anhaftende Ackererde und fiel zu Boden. Im Winter wurde das Kellerlauch mit ein paar Brettern von außen verschlossen und das Ganze mit einer Lage Stallmist „zugemauert,“ – ein wirksamer Frostschutz. Bei uns daheim mündete das Kellerlauch im offenen Holzschuppen.
Kemmel (weiches e)
Wer jemals die Krützhau (Kreuzhacke, Spitzhacke) hat schwingen müssen, beispielsweise beim Ausheben von Fundamenten, der weiß sehr wohl ein Lied über den Kemmel zu singen, an dem unsere Eifel ziemlich reich ist. Kemmel nennen wir die oberen Gesteinschichten, die durch Verwitterung aus ursprünglich „gewachsenem“ Felsen entstehen. Bei uns gar nicht so selten: Nach 50 Zentimeter Mutterboden stößt der Bagger auf Kemmel, der zunächst noch relativ weich ist und sich in Schichten abheben lässt. Die Schichten werden fester und härter und gehen schließlich in massiven Felsen über. So sah es unter anderem in unserem heutigen Vorgarten aus, der ursprünglich aus einem gut meterhohen Felshügel bestand. Nachdem wir in 1949 ins Haus „Muuße“ eingezogen waren, ging Vater daran, den Steinhügel abzutragen, selbstredend von Hand, denn Maschinen hierfür gab es bei uns noch nicht. Unter 30 Zentimeter Gartenerde kam auf einem knappen Ar Fläche Kemmel zum Vorschein, den wir in mühevoller Handarbeit abtragen mussten. Wenn man einmal den richtigen „Ansatz“ gefunden hatte, ging das Abheben der Schichten relativ leicht, trotzdem aber dauerte die Arbeit ungefähr drei Wochen. Nachbarschaftshilfe war damals selbstverständlich, der halbe Kippelberg beteiligte sich, und Berlings Jüpp (Josef Berlingen Junior) stellte uns wiederholt unentgeltlich seinen Kastenwagen an die Baustelle, den wir dann mit Abraum füllten und den Jüpp abends mit seinem Pferdegespann abtransportierte. Die Einebnung des felsigen Hügels bot sich an, weil beim Bau einer „Panzersperre“ vor unserem Haus bereits eine beachtliche Lücke im Gestein entstanden war. Das Sperrwerk stand im Engpass zwischen unserem Garten und dem Nachbargrundstück Rosen, es besaß nur einen schmalen Durchlass für Fußgänger. Beim Abbau hat Vater für ein paar Groschen die dicken Fichtenstämme gekauft und bei Zalentengs Pitter (Peter Steffens, besaß eine schwere Kreissäge) zu Schreinerholz sägen lassen.
kenz (weiches e)
„Wenn ens bei uns einmal heißt, dann kann kenz nur keinmal bedeuten,“ mögen sich unsere Vorfahren gesagt haben, als sie nach einem Kurzwort für niemals suchten. Kenz wird heute kaum noch angewandt, bei uns daheim war es noch an der Tagesordnung. Heute ist niemools sehr viel geläufiger. Jetz han ech dech ad driemool für aan dr Desch jeroofe, du häß äwwer kenz jefolech, nächstens kreßte nix mieh ze eiße. „Jött“ meckerte also, dass sie mich schon dreimal zum Essen gerufen habe, dass ich aber nicht gefolgt sei und demnächst nichts mehr zu essen bekommen würde. Die Kniep han ech ad zichmool om Wellstejn jehatt, et hät äwwer bos höck kenz jenotz, – das war eine Beschwerde über ein minderwertiges Messer, das trotz wiederholen Schleifens auf dem „Wellstein“ nicht scharf zu kriegen war. Es gibt tatsächlich derart „faule“ billige Werkzeuge. Ens os kenz sollte man eigentlich die Eifeler Version von Einmal ist keinmal in der Übersetzung erwarten. Irrtum, da nämlich halten wir uns an die hochdeutsche Regel, allenfalls kommt noch ejnmool os kejnmool zustande. Ech han kenz en Antwoëd krijje ist eine Reaktion auf andauerndes vergebliches Fragen. Wenn du kenz de Muul opkress, moßte dech net wonnere, wenn sech kejner mieh mot dir onnerhält, – Wer immer nur die anderen reden lässt und selber schweigt, darf sich nicht wundern, wenn sich niemand mehr mit ihm unterhält. Ech han kenz jät jemerk, ärgerte sich der Gartenbesitzer, weil ihm die Mösche (Spatzen) die jungen Erbsenkeimlinge ausgezupft hatten.
Kettestrüch
Kettestrüch sind die Löwenzahnblumen, deren leuchtend gelbe Wiesenteppiche im Frühjahr unser Auge erfreuen. Der Löwenzahn gedeiht in derartigen Massen, dass er längst zum lästigen Unkraut geworden ist und als Gewächs keinerlei Bedeutung hat. Nur der Feinschmecker sammelt im Frühjahr die zarten Blättchen und bereitet sich einen köstlichen und gesunden Salat daraus. Und der Heidedichter Hermann Löns beschrieb den Löwenzahn in „Da draußen vor dem Tore“ als „Die allerschönste Blume,“ nachdem er das gelbe Wunder einmal intensiv betrachtet hatte. Früher fertigten die Kinder aus den leuchtenden kleinen Sonnen prächtige Kränze und Halsketten, die leider aber viel zu schnell verwelkten. Hieraus ergab sich der Name Kettestrüch. Die hohlen Stengel dienten uns als Fuëpsch, das war eine Art Pfeife oder Flöte, der sich die seltsamsten Töne entlocken ließen. Bei uns daheim hieß der Löwenzahl Suumerke, ein seltsames Wort, das möglicherweise auf den bitter schmeckenden weißen Saft der Pflanze zurückzuführen ist. Kettestrüch waren ein begehrtes Kaninchenfutter, das wir unseren Stallhasen massenhaft vorlegen konnten und das genüsslich „gemümmelt“ wurde. Vielleicht gewinnt der Löwenzahn demnächst mächtig an Bedeutung. Im Fernsehen erfuhren wir nämlich kürzlich (Mai 2012), daß Bestrebungen im Gang sind, aus Löwenzahnpflanzen Kautschuk für Autoreifen zu gewinnen.
Kid
Auf den ersten Blick möchte man das Wort mit dem aktuellen Kid unserer Tage in Verbindung bringen, mit dem der „Insider“ das ganz normale Kind bezeichnet. Das wäre aber völlig daneben geraten, im Dörfer (und auch Eifeler) Dialekt nämlich ist das Kid ein Wort für Korn oder deutlicher noch Körnchen, für eine Winzigkeit also. Beim Flegeldreschen auf der Scheunentenne wies mich Ohm Mattes immer wieder an, nicht zu stark auf die Ährenspitzen zu schlagen, denn domot häußte de Kidder kapott (damit schlägst du die Körner kaputt). Ein anderes Mal, am Dreischkaaste (Dreschkasten), griff er sich eine Handvoll von den aus der Maschine rieselnden Körnen und stellte zufrieden fest: Dat Koor os prima, de Kidder sin jruëß on hart (…groß und hart). Das Gegenteil war der Fall, wenn das Getreide umknickte und längere Zeit an der Erde lag, oder auch bei langdauernder Regenperiode. Dann war et Kid om Halem üßjewaaße (das Korn auf dem Halm ausgewachsen) und damit für die Mehlherstellung unbrauchbar geworden. Wie das hochdeutsche Korn, so brauchen wir auch unser Kid als Ausdruck einer Winzigkeit. E Kid Wohrhejt bedeutet „ein Körnchen Wahrheit, und jank ens e kitches op Sitt heißt „rück mal ein wenig zur Seite.“ Als Kinder hatten wir gar nicht so selten e Kid am Ouch, eine schmerzhafte Entzündung am Augenlied, das so genannte Gerstenkorn. Hier trat wieder einmal unser Allheilmittel Kamillentee in Aktion, intensive Behandlung mit heißem Kamillensud wirkte tatsächlich wohltuend und heilend.
Kiëschte
Heuer (im Jahr 2018) gab es wieder einmal Obst in Hülle und Fülle, beispielsweise musste ich fast einen Zentner Promme (Pflaumen) in den Kompost geben, weil wir sie nicht alle verarbeiten konnten und ansonsten kein Mensch Pflaumen haben wollte. Auch die Suër Kiëschte (Sauerkirschen) gediehen hervorragend, gut drei Wochen hindurch gab es bei uns Kiëschte-Köjelcher (Sauerkirsch-Pfannkuchen) noch und noch, und das war eine leider nur kurze Zeit vorhandene Delikatesse. Und wie die Wespen sich am süßen Saft der Pflaumen labten, zankten sich Amsel, Star und Spatz im Kiëschteboum (Kirschbaum) um die sauer-süße Köstlichkeit. Suër Kiëschte direkt frisch vom Baum, von der Hand in den Mund sozusagen, sind nicht nur lecker, sie sind obendrein auch wegen ihres Gehalts an allen möglichen Gesundstoffen sehr empfehlenswert, wie ich bei „Doktor Google“ las. Was heute den „Kids“ viel zu banal wäre, war in unseren Jugend- und „Flegeljahren“ nach dem Krieg beinahe eine Selbstverständlichkeit: Obst-Klauen aus Abenteuerlust, aber auch aus Appetitgründen. Ein besonderes Erlebnis aus dieser Zeit bleibt unvergessen. Bei halber Dunkelheit waren wir mit vier Mann im Ortsteil Zollstock beim Kiëschteklaue, als plötzlich eine dunkle Gestalt auf uns zu kam. In der Annahme, es handle sich um den Eigentümer, ergriffen wir die Flucht ohne zu merken, dass wir nur noch drei Mann waren. Durch die heutige Neulandstraße ging es, am Feuerwehrhaus machten wir atemlos Halt – und hörten, dass hinter uns der Verfolger kam. Wir drei trennten uns, ich verzog mich die Tröüt abwärts, am Jean Leyendecker-Platz wollte ich aufatmen, hörte aber den Verfolger die Tröüt herab kommen. Mühsam arbeitete ich mich durch die Eppejass auf den Kippelberg hinauf und schleppte mich mit letzter Kraft in unseren finsteren Hof, wo ich mich platt auf den Bauch hinter das niedrige Gartenmäuerchen legte: Das Aufschließen der Haustür hätte zuviel Zeit gekostet, der Verfolger nämlich war mir gefolgt, hatte mich in der Eppejass aber aus den Augen verloren und stand nun gute zehn Minuten lang unter der Straßenlampe am Kippelberg-Kreuz. Erkennen konnte ich ihn nicht, wagte unterdessen kaum zu atmen. Warum war er ausgerechnet mir gefolgt, wir waren doch zu vier! Als er endlich gegangen war, schlich ich ohne jedes Licht anzumachen im Finstern ins Haus und kroch ins Bett. Am nächsten Tag stellte sich heraus: Mein „Verfolger“ war unser vierter Mann gewesen.
kieve
Ein gleichbedeutendes Dialektwort ist schänne, beides heißt „schimpfen, zurechtweisen, tadeln.“ Kieve war zu unserer Kinderzeit alltäglich, inzwischen ist das Wort weitgehend in Vergessenheit geraten, - wie so mancher schöne alte Mundartausdruck. Moß ech mot dir kieve (Muss ich mit dir schimpfen) drohte Jött, wenn ich mal wieder eine Uëz (Essenrest) auf dem Teller zurück ließ. Eine sehr häufige Redewendung beim aufziehenden Gewitter und fernem Donner war dr liebe Jott kiev. Das beeindruckte uns mächtig und wir forschten insgeheim in unserem „Sündenregister“ nach möglicherweise schlimmen Taten, die den Zorn des Himmelsherrn hervorgerufen haben könnten. Regional ist heute noch beim Gewitter das Zitat zu hören: Et Herrjöttche kiev. Der Ursprung unseres kieve ist unverkennbar das holländische Wort „kijven,“ was in unserem Standardhochdeutsch als „keifen“ gebräuchlich ist. Es gab ein altes Sprichwort: Wenn Spotzbove sech kieve, hüet dr iehrliche Mann, wo seng Saache blieve, übersetzt: „Wenn Spitzbuben sich streiten, erfährt der ehrliche Mann, wo seine Sachen bleiben,“ und das will besagen, dass sich Diebe im Streit unter einander leicht selbst verraten.
Kipche
Ein prächtiges Beispiel für die Verwandtschaft der holländischen Sprache mit unserem Dialekt. Kip nämlich heißt auf Deutsch „Huhn, Henne,“ und wenn wir daheim unsere frei laufenden Hühner lockten, klang das kip,kip,kip, worauf das Federvieh im Eiltempo aus allen Richtungen herbei stürmte. Das allgemein gebräuchliche „put-put-put“ war bei uns nicht üblich. Jeff de Kipcher jät (gib den Hühnern etwas) war der Auftrag an uns Pänz (Kinder) zum Füttern unserer Hühnerschar. Die stob auf unseren Lockruf hin von Peisch und Bongert (Wiesen beim Haus) oder aus dem Lohr (Tal nahe unserem Haus) herbei, die Kipcher kannten sich bestens aus und pickten ihre Mahlzeit aus unseren Kinderhänden. Zu bestimmter Tageszeit kamen sie von alleine, schlüpften durchs Hohnerlauch (Hühnerloch = Öffnung in der Stalltür) und erledigten ihr Eierlegegeschäft oder bezogen Nachtquartier auf den Hockstangen in der Huërt (Hühnersteige). Diese Stangenkonstruktion nennen die Holländer Kippenhok (Hühnerstall, Hühnerkäfig). Unsere Kipcher bewegten sich ganztägig freilaufend in der Nähe des Hauses, waren also nach heutigen Begriffen „glückliche Hühner.“ Sie suchten sich ihr Futter weitgehend selber, erhielten aber zusätzliche Portionen und besonders auch Trinkwasser am heimischen Stall. Einen Steinwurf vom Haus entfernt war die Hardt, und aus diesem Waldbereich kamen gelegentlich Fuchs oder Habicht herüber und stibitzten sich einen Hühnerbraten am hellen Tag dicht vor unseren Augen von der Wiese weg. Ab und zu kam auch eins unserer Kipcher in den Kochtopf. Das wurde zwar als Leckerbissen besonders von uns Kindern freudig begrüßt, insgeheim aber trauerten wir dem „geopferten“ Tier ein wenig nach.
Kisshamer
Wer hier eventuell eine Wortverwandtschaft mit dem englischen „kiss“ (Kuss) vermutet, ist auf dem Holzweg. Der Kisshamer war ein Werkzeug und wurde vordringlich im Straßenbau gebraucht: Der „Kieshammer“ zum Zertrümmern von Gesteinsbrocken bei der Herstellung von Schotter. Den Kisshamer gab es, wie alle Arten von Hämmern, in verschiedenen Größen und Gewichtsklassen, die Form allerdings glich nur entfernt einem Hammer, man könnte sie als faustförmiges Stahlstück mit zwei in massive stumpfe Kegel auslaufenden Enden – anstelle von Finne und Bahn – beschreiben. Das Gewicht des Werkzeugs allein war nicht ausschlaggebend für effektives Kisskloppe (arbeiten mit dem Kieshammer), es sollte in jedem Fall dem Körperbau des Arbeiters angepasst sein, denn stundenlanges Hammerschwingen strapazierte die Armmuskeln. Mit einem 400 oder auch 500 Gramm schweren Kisshamer ließen sich schon ganz brauchbare Ergebnisse erzielen und die Muskeln wurden nicht übermäßig beansprucht. Maßgebend für erfolgreiches Hämmern war nicht zuletzt der Werkzeugstiel, den sich der Kissklöpper selber aus elastisch-zähem Haselnussholz anfertigte. Der Stiel war 40 bis 50 Zentimeter lang, das Mittelstück war in Schlagrichtung (oben und unten) deutlich abgeflacht und wurde dadurch zur elastischen „Holzfeder,“ deren Wirkung mit der einer Schlagbohrmaschine vergleichbar war. Diese Eigenschaft in Verbindung mit geübten Augen und Ohren des Kissklöppers garantierten effektives Arbeiten. Optische Kriterien für den richtigen Hammeransatz waren möglichst flache Stellen am Steinbrocken, akustisch außerdem die „Stimme“ des Steins: Der Klang beim Hammerschlag verriet dem Kissklöpper die „Schwachstellen“ seines Werkstücks. Wildes Drauflosschlagen brachte gar nichts, allenfalls war ein zerbrochener Hammerstiel und damit Ärger die Folge.
Klaatschkoëd
Den Ausdruck gibt es heute nicht einmal mehr bei den wenigen, in unserer Eifel noch schaffenden Landwirten, und gerade bei ihren Berufskollegen war früher die Klaatschkoëd ein fester Begriff. Die Klaatschkoëd nämlich war ein Teil der Schmeck (weiches e), wie die beim Bauern durchweg gebräuchliche Fuhrmannspeitsche genannt wurde. Häufig im Gebrauch war die „Harzer Fuhrmannspeitsche“ mit meterlangem elastischem und geschnitztem Holzstiel und ebenso langer lederner Schmeckekoëd (Peitschenschnur). Deren Spitze bestand aus einer besonderen, etwa 50 Zentimeter langen festen Hanfschnur, und das war die Klaatschkoëd, in Hochdeutsch auch „Treibschnur, Schnäpper oder Knallschnur“ genannt. Klaatschkoëd bedeutet wörtlich „Klatschkordel,“ sie ermöglicht das Schmeckeklaatsche (Peitschenknallen), das der geübte Fuhrmann mit einem blitzschnellen Bewegung des Stiels zustande brachte. Massives Peitschenknallen war für die Zugtiere das Signal zu höchstem Körpereinsatz, es wurde nur ganz selten angewandt. Im „Normalbetrieb“ genügte eine leichte Berührung mit dem Peitschenstiel zum Dirigieren und Anfeuern von Schwitt und Rüët (Tiernamen). Die Klaatschkoëd musste naturgemein aus besonders widerstandsfähigem Material hergestellt sein, die Beschaffung war im und nach dem Krieg schwierig. Wir behalfen uns daheim mit alter Binderkoëd (Bindegarn des Mähbinders), die allerdings kaum mehr als ein scharfes „Zischen“ erzeugte und sehr rasch zerfledderte.
nach oben
zurück zur Übersicht
Klattere
Mit diesem Ausdruck sind für den Kenner unangenehme und sogar etwas „anrüchige“ Erinnerungen verbunden: Klattere nannte man die harten Kotklümpchen am Hinterteil der Stalltiere, speziell der Rinder. Selbst im gepflegtesten Kuhstall konnte es nicht ausbleiben, dass sich die Tiere beim Niederlegen mit den eigenen Ausscheidungen bekleckerten, die früher ja meistens nur einmal täglich beim Stallmeste (Stall ausmisten) entfernt wurden. Die Produktion von Gülle (Schwemm-Mist, Schwemmmist!!) war noch wenig bekannt, Jauche war keine Gülle. Die Bildung von Klattere war ein Zeichen mangelnder Tierpflege und absolut kein vorteilhaftes Renommee für den Stallbesitzer. Der Kleinbauernbetrieb unserer Eltern umfasste im Schnitt zwischen drei und fünf Rinder, eine Pflege mit Köhkamm und Striegel wenigstens einmal wöchentlich wäre durchaus möglich und sinnvoll gewesen, war aber eine lästige und anstrengende Arbeit und wurde angelegentlich immer wieder hinausgeschoben. So wuchsen die Klattere mit der Zeit zu manchmal zentimeterdicken harten Gebilden heran und waren dann nur noch schwer und für die Tiere unangenehm aus dem Fell zu entfernen. Leicht konnte es passieren, dass Schwitt oder Fuss (Tiernamen) ihren Peiniger beim Köhkämme mit dem Hinterhuf traktierten. Der Köhkamm war ein hässliches eisernes Werkzeug, eine quadratische Platte mit mehreren ziemlich spitzzahnigen Kratzleisten und einem Handgriff.
Klenkemöll
Örtlich auch Klinkemöll, eine Sammelbezeichnung für Molche, Lurche, Unken und Salamander. Bei uns daheim war mit Klenkemöll besonders der Feuersalamander gemeint. Das glänzend schwarze Tier mit den leuchtenden gelben Flecken war uns Kindern unheimlich, zumal es angeblich auch Gift versprühen konnte. Das „Gift“ verursachte allerdings bei Berührung nur ein leichtes Hautbrennen, wir registrierten es kaum. Unweit vom Haus besaßen wir om Lohr (Flurname) einen Acker, auf dem wir unter Steinen des Öfteren den gefleckten Feuersalamander fanden. Der Ausdruck Klenkemöll ließe sich eventuell mit „Klingmolch“ übersetzen, wobei Klenke auf das „Läuten“ (Klingeln) der Geburtshelferkröte zurückzuführen und Möll von „Molch“ abzuleiten wäre. Diese Deutung trifft unterdessen nicht auf den Feuersalamander zu, denn der hat keine „Stimme“ wie etwa die zuvor erwähnte Kröte. Im damaligen Staatsforst Salchenbusch bei Nonnenbach gab es im Rosensiefen in den 1970er Jahren ein Biotop in Gestalt eines Feuerlöschteichs, an dem ich häufig im Auftrag des Revierbeamten mit Pflegearbeiten beschäftigt war. Dort hatten sich, neben Fischreiher, Stockenten, Eisvogel und mehreren Libellenarten, sowohl die Geburtshelferkröte als auch der gefleckte Feuersalamander angesiedelt.
Klobbe (weiches o)
Mit gut bürgerlichem Namen hieß er Johann Friederichs, im Dörf und darüber hinaus in der halben Eifel, war er unterdessen weit eher als Klobbe ein Begriff, so genannt in Anlehnung an den dörflichen Namen seines Elternhauses. Klobbe Johann war lange Jahre Geschäftsführer des ortsansässigen Getränkevertriebs Heinrich Handwerk und als Geschäftspartner bei den Freunden eines gepflegten Bierchens in nah und fern ein Begriff. Viele Jahre lang leitete er auch die heimischen Karnevalssitzungen. Er war ein aktiver Freund und Förderer der Ortsvereine, die ihm eine Menge zu verdanken haben. Klobbe war nicht zuletzt lange Jahre Vorsitzender des Vereinskartells. Sein Bruder Peter wurde wegen seiner frappanten Ähnlichkeit mit einem früheren Zentrumspolitiker Brüning genannt. Johann Klobbe Friederichs starb 80-jährig am 17. Juni 2001, es war der Festsonntag anlässlich der 90-Jahr-Feier der Dörfer Feuerwehr. Sein Tod war ein Schock fürs Dorf. Klobbe Johann war Mitglied in fast allen Ortsvereinen und dort meistens auch im Vorstand tätig. Er war aus dem Dorfgeschehen nicht wegzudenken. Es gab keine Veranstaltung, kein Fest im Dorf, an dem Klobbe nicht in irgendeiner Form mitgewirkt hätte, sei es als aktiv Beteiligter oder als Gönner und Förderer im Hintergrund.
Kloppeitsch
Dieses Wort fiel mir im Zusammenhang mit „Klaatschkoëd“ ein (siehe: Klaatschkoëd). Zum besseren Verständnis sollte ich eigentlich Klopp-Peitsch schreiben, nach der neuen deutschen Rechtschreibung, die nach der Übergangszeit seit 2005 allein gültig ist, müsste ich sogar Klopppeitsch formulieren, – ein geradezu unmögliches Wort. Drei P hintereinander, da fabriziere ich lieber absichtlich einen Schreibfehler! Das hochdeutsche Wort lautet fast genau wie unser Mundartausdruck: „Klopfpeitsche“ oder vornehm auf Französisch „Martinet.“ Da die Peitsche bei uns Schmeck (weiches e) heißt, wäre eigentlich Kloppschmeck der richtige Ausdruck, das war unterdessen seltsamerweise nicht der Fall. Bei uns daheim gab es tatsächlich ein derartiges Schlaginstrument, es hing im Uhrkaaste (Uhrenkasten, Wandnische) in der Stube neben Regenschirmen und Spazierstöcken, und wurde höchstens mal zu Demonstrationszwecken hervorgeholt: Ein daumendicker kurzer Holzstiel mit fünf oder sechs dünnen Lederriemchen, etwa einen halben Meter lang. Dem Vernehmen nach war die Kloppeitsch früher ein Instrument zur „Erziehung“ von unartigen Kindern oder bösartigen Hunden, die geschmeidigen Lederriemen dürften auch tatsächlich eklige Pein etwa auf dem blanken Hinterteil verursacht haben. Unsere Kloppeitsch daheim wurde laut Behauptung von Jött und Mam in ihrer Jugend fürs Teppichklopfen gebraucht, was mir aber nie einleuchtete: Noch zu meiner Kinderzeit gab es im ganzen Haus keinen einzigen Teppich. Im Haushalt meiner Großeltern gab es aber sieben Sprösslinge, – wer weiß, was es da alles zu „klopfen“ gab! Schließlich wurde ja auch unsereinem schon mal gedroht: Jeff dech en de Rouh oder ech hollen de Kloppeitsch. Immer diese leeren Versprechungen, ich habe unsere Kloppeitsch – Gott sei Dank – nie „in action“ erleben müssen.
Klopper
Klopper bedeutet eigentlich „Klopfer,“ in Blankenheimerdorf bezeichnet man unterdessen damit das Klappergerät der Kinder und Messdiener, mit dem sie an den Kartagen in der Osterwoche durchs Dorf ziehen. An diesen Tagen nämlich sind die Kirchenglocken „nach Rom geflogen,“ ihr Morgen-, Mittag- und Abendläuten wird durch das Klappern ersetzt. Mancherorts heißt dieser Umzug Kläppere, Klappere oder Kleppere, in Blankenheimerdorf bestand man früher unbedingt auf Kloppere und das Gerät hierfür war eben die Klopper. Als ich seinerzeit in einem Aufsatz einmal „die Klapper“ zitierte, erntete ich den bitterbösen Protest einer Seniorin. Die Klopper ersetzte an den Kartagen auch die Altarschelle beim Gottesdienst. Die zünftige Klopper wurde total aus Holz gefertigt, nicht ein Gramm Metall war an dem Gerät, in Vaters Schreinerwerkstatt habe ich seinerzeit eine Menge dieser Krachmächer (Krachmacher) basteln müssen. Ein zehnjähriger Junge aus ärmlichen Verhältnissen bezahlte seine neue Klopper mit einem Ei, weil mir doch kee Jeld han. Das Nahrungsmittel Ei war damals noch geschätzt, niemand benutze es als Wurfgeschoss gegen Politikerköpfe, und Dioxingift suchte man vergebens darin.
Klotz (weiches o)
Die Klotz mit weichem o gesprochen ist eine Bruthenne, eine Glucke. E klotzich Hohn ist ein „brütelustiges“ Huhn, das seine Bereitschaft zur Nachwuchsförderung durch glucksende Laute dokumentiert. Ähnliche Laute sind später der Lockruf für die Küken. Zum Brüten wird de Klotz jesatt (die Glucke gesetzt), das heißt sie wird auf ein vorbereitetes umfangreiches Gelege gesetzt, das sie in der Regel bereitwillig annimmt. Um ein klotzich Hohn ohne Brüten in den „Normalzustand“ zu versetzen, wurde es früher jestölep, was wörtlich „gestülpt“ bedeutet: Das Tier kam für eine gewisse Zeit unter einen dichten Korb oder wurde sogar brutal in einen Sack gesteckt und an die Wand gehängt. Eine Klotz mit Nachwuchs war recht „giftig“ und hackte uns empfindlich in die Kinderfinger, wenn wir den Küken zu nahe kamen. Klotz net esu lang, maach vüëraan (trödele nicht herum, beeile dich) ist auch heute noch eine übliche Aufforderung an „schwerfällige“ Zeitgenossen: Die Klotz muss ihren zahlreichen Nachwuchs dauernd unter Kontrolle halten und kommt daher nur langsam voran. Und eine etwas behäbige Zeitgenossin bezeichnen wir gelegentlich etwas hintergründig als Klotz, was man allerdings tunlichst nicht laut werden lässt.
Kluëch
Gesprochen wird das Wort Klu-e-ch, wobei das ch nicht als Rachenlaut, vielmehr wie in „weich“ zur Anwendung kommt. Die mundartliche Kluëch war die hochdeutsche Feuerzange, die es in verschiedenen Größen gab, je nach ihrem Anwendungsbereich. Heute gehört das Gerät zum modernen Kaminbesteck, früher war es im Haushalt unentbehrlich, unter anderem holte man mit der Kluëch den rotglühenden Eisenbolzen aus dem Herdfeuer, mit dem das Büjeliese (Bügeleisen) beheizt wurde. Zum besseren Greifen waren die beiden Zangenspitzen als talergroße Platten ausgeschmiedet. Die wohl größte Kluëch war ungefähr einen Meter lang, sie wurde beim Backen zum Verteilen von Jlohn (Glut) und Backschegger (Backscheite, armlange Holzstücke) im Backofen gebraucht, musste also möglichst lange Greifzangen haben. Was mit der Kluëch zu berühren war, hielt man sich naturgemäß vom Körper fern. Daraus entstand ein Eifeler Wort als Ausdruck der Abscheu oder der Vorsicht: Dat dät ech mot dr Kluëch net aanpacke (Das würde ich nicht mal mit der Feuerzange anfassen). Im Kölner Dialekt heißt die Feuerzange Klooch, unsere Nachbarn in Holland sagen „Vuurtang.“
Klüësterche
Noch lange nach dem Krieg war et Klüësterche in Blankenheim und Umgebung ein fester Begriff. Das Klösterchen stand am Nonnenbacher Weg gegenüber dem Amtsgericht, es war eine Filiale der „Dernbacher Schwestern,“ die 1959 in ihr neues Haus auf Hülchrath umzogen. Die Schwestern waren die Engel von der Oberahr, sie waren äußerst aktiv in der Krankenpflege tätig und unterhielten in den Sommermonaten, wenn die Leute vor Arbeit net mieh üß de Oure kicke (nicht mehr aus den Augen sehen) konnten, eine Verwahrscholl (Verwahrschule, Vorläufer des Kindergartens). Für 50 Pfennig im Monat konnten die geplagten Eltern ihre Kinder bedenkenlos ins Klüësterche in die allerbeste Obhut geben, und wem auch die halbe Mark „hart ankam,“ dem wurde die Gebühr völlig erlassen. Das Klösterchen wurde im Juni 1898 gegründet, erste Patientin der Krankenschwester war bereits acht Tage später die Ehefrau des Nonnenbacher Eifeldichters Johann Ehlen, der nach dem Tod seiner Frau ein umfangreiches Dankgedicht ans Klüësterche verfasste. Für den Unterhalt des Klosters sammelten die Schwestern alljährlich zu Allerheiligen an der Oberahr Naturalien und selbstverständlich auch Geld, und nur ganz selten wurden sie abgewiesen. Ich entsinne mich noch sehr genau: Beim Jromperekaaschte im Garten reservierte unsere Mutter regelmäßig 20 Pfund Kartoffeln, dazu kamen noch fünf Eier und fünf D-Mark, das Ganze wurde dann für de Schwestere bereitgelegt. Am Klüësterche war es, wo seinerzeit ein Mann aus dem Gebüsch sprang, mich packte und loss de Fengere van dem Mädche oder ech drähen dir dr Hals eröm drohte. Das Mädchen war meine Cousine Christel Müllenmeister, ich hatte sie vom Kirmeszelt zu ihrem Elternhaus am Nonnenbacher Weg begleitet, meine Finger waren garantiert nie „an ihr.“ Das alles aber war meinem Widersacher nicht bekannt. Wir beide haben uns übrigens später ganz passabel vertragen, er hat allerdings Cousinchen Christel nicht erobert.
klüftich
Wenn eine Angelegenheit, ein Ereignis oder ganz allgemein eine Sache „undurchsichtig, unbegreiflich, unerklärlich oder unverständlich“ ist, dann bezeichnen wir das als klüftich. Klüftich für mich ist zum Beispiel die Herkunft von klüftich. Im Duden steht, dass es sich bei klüftig um einen veralteten und nur noch im Bergbau und in der Geologie vereinzelt angewandten Begriff für „zerklüftet, rissig“ handelt. Denkbar ist auch hier wieder einmal die Verwandtschaft mit der holländischen Sprache. Dort nämlich gibt es „kluchtig“ (gesprochen: klüchtich) als Ausdruck für „komisch, spaßhaft, possenhaft.“ Klüftich steht auch für „riskant“ und als Ausdruck der Bedenklichkeit: Dat Wedder os mir jät klüftich, mir blieven drhejm (Das Wetter ist mir zu unsicher, wir bleiben daheim) verschob man beispielsweise den geplanten Familienwandertag. Irgendwann einmal streikte seinerzeit mein Diensttelefon im Bahnhof Dahlem. Der Kollege von der Leitungsaufsicht, der einen leichten Sprachfehler besaß, brasselte (werkelte, bastelte) ein Weilchen erfolglos am Gerät herum und ärgerte sich schließlich: Dat es mir äwwer ze kl - ze kl - ze kl – Scheiße, dat es mir ze klüftich.
Kluuster
Wir kennen ein weiteres, ähnlich klingendes Mundartwort: Kluëster. Beide Ausdrücke gehen auf das lateinische Wort claustrum zurück, was soviel wie „abgeschlossener, verschlossener Ort“ bedeutet. Das Kluëster ist unser Wort für „Kloster,“ mit Kluuster bezeichnen wir ein Vorhängeschloss. Das Kluuster war zu meiner Kinderzeit noch ein sehr primitives Verschlussmittel, das der Kundige mit einem einfachen gebogenen Draht zu öffnen verstand. Heutige Vorhängeschlösser sind kleine Wunderwerke aus Edelstahl mit Zahlenschließwerk und Spezialschlüssel. Im Krieg stand nahe unserem Haus an der Hardt eine Holzbaracke, die seinerzeit das „Kulturamt“ im Zuge der seit 1937 laufenden „Umlegung“ (Flurbereinigung) für die Aufbewahrung von Werkzeugen errichtet hatte. Schon die Wehrmacht hatte dort während der Einquartierung 1939/40 kampiert, wir selber wohnten dort zehn Tage lang während der amerikanischen Besatzung im März 1945, weil wir unser Haus räumen mussten. Die Barackentür besaß anfänglich eins jener primitiven Kluuster, das mein Schulkamerad Werner und ich zu öffnen verstanden, und damit ist ein Abenteuer verbunden. Wir trieben uns also öfter in und an der Baracke herum, obwohl es dort eigentlich für uns nichts Interessantes zu sehen gab, abgesehen vielleicht von einer Feldschmiede. In Sichtweite wohnte Heinrich Baum, bei uns nach seinem Elternhaus Ewe Hein genannt, der beim Kulturamt beschäftigt war. Wegen eines Nervenleidens – er stieß in kürzeren Abständen weithin hörbare Schreie aus – mußte er nicht zum Militär und beaufsichtigte die Holzbaracke. Er konnte sich naturgemäß nicht unbemerkt anschleichen, wir beide hatten also immer Gelegenheit zu rechtzeitiger Flucht. Einmal hatte er es doch bis fast ans Holzhaus geschafft, sein erster Schrei ertönte wenige Schritte vor der Tür. Da wurde es „eng“ für uns. Wir flüchteten bachabwärts ins Nonnenbachtal, Ewe Hein dicht auf den Fersen. Hännesje, wenn ech dech kreje, hangen ech dech op, keuchte Hein hinter uns zwischen fürchterlichen Schreien. Die Todesangst verlieh uns Flügel, Hein erwischte uns nicht. Ob er mich tatsächlich opjehange hätte? Immerhin: Er schwang ein entsprechend langes Seil wie ein Lasso.
Knauch
Mir dohn all Knauche wieh (Mir tun alle Knochen weh) kuump (von küüme = jammern, klagen) Pitterjuësep beim Jrompere üßdohn (Kartoffeln aushacken) und stützte sich auf den Kaasch (zweizinkige Hacke). Ohm Mattes hatte sich beim Holzfällen de Knauche jeschend (die Hände verletzt, geschunden) und Tant Bärb (Barbara) konnte sich schlecht bücken, weil sie Jiëch en de Knauche (Gicht in den Knochen) hatte. Ein kleiner Knochen war und ist ein Knäuchelche, beispielsweise et Stätzknäuchelche (das Steißbein). Wir Pänz mussten daheim auf dem Trittstein vor der Haustür Knauche kloppe (klopfen, zerkleinern), als Hühnerfutter. Die Kipcher (Hühner, holländisch: Kip = Huhn) rissen uns die Bröckchen geradezu aus der Kinderhand. Im Eifeler Dialekt ist der Knochen unabdingbar weiblichen Geschlechts: Die Knauch, die Kirmesknauch zum Beispiel. Dä (der) Knauch ist gegen jede Eifeler Dialektform, wird aber hier und da angewandt. Knauchendrüch ist unser Wort für „knochentrocken,“ und ein ziemlich böses Zitat lautet: Wenn ech dech en de Fongere kreje, kannste deng Knauche em Sackdooch hejm drare (Wenn ich dich in die Finger kriege, kannst du deine Knochen im Taschentuch nach Hause tragen).
Knidd
Das Wort ist heute (2015) nicht mehr im Sprachgebrauch, selbst viele Senioren wissen damit nichts anzufangen. Vor 60 Jahren drückte mir Vater ein paar Groschen in die Hand: Jank aan Thomens zwei Pond Knidd koufe, und das war für mich der Auftrag, im Geschäft Thomé ein Kilo gemahlene Kreide zu erstehen. Bei Thomens Tünn (Anton Thomé) kaufte man alles, was das Maler- und Anstreicherherz begehrte. Neben Tapeten und Rauhfaser, neben Jebönnfärv (Fußbodenfarbe) und Fensterlack, gab es Lengollich (Leinöl), Terpentin und Sekrativ (Sikkativ, Trockenfirnis), und nicht zuletzt auch öl- und wasserlösliche Pulverfarben vieler Schattierungen. Darunter war auch Knidd, weißes Kreidepulver, aus dem Vater unter Zugabe von Leinöl, Terpentin und Lack Fensterfarbe herstellte. Das war billiger als fertige Farbe zu kaufen. Die Eifeler Fenster von damals waren standardmäßig sämtlich weiß gestrichen. Knidd war auch beim Kaufmann das normale Wort für die Kreide. Ich habe nie verstanden, warum es ausgerechnet Knidd hieß und nicht etwa Kridd, was doch dem richtigen Namen weit eher entsprochen hätte. Aus Knidd und Leinöl wurde übrigens bei uns auch Fensterkitt geknetet, eine ziemlich matschige Angelegenheit. Immerhin roch das Leinöl sehr viel angenehmer als Fensterlack oder Jebönnfärv, die ich heute noch „nicht riechen kann.“
kniepe
Schon wieder ein Mundartwort holländischer Abstammung. Kniepe bedeutet generell „kneifen, zwicken.“ Ein ähnliches Wort ist petsche, das gelegentlich durch „pitschen“ verhochdeutscht wird. Die Holländer sagen „knijpen.“ Im Eifeler Dialekt bedeutet kniepe häufig auch „blinzeln, mit den Augenlidern zwinkern. Dat Jänn hät mir jekniep freute sich Köbes beim Kirmesball über das Augenzwinkern vom Nachbartisch. Für manche Menschen ist die TV-Mattscheibe ein wirksames Schlafmittel, das sich durch Kniepe mot de Oure (Augenzwinkern) ankündigt. Vielfach war früher auch kniepe das Wort für den Tretvorgang beim Hahn. Wenn wir Pänz fragten, warum unser Hahn auf eins der Hühner stieg, hieß es lapidar dä kniep dat Hohn, warum er das tat und was da detailliert geschah, das erfuhren wir nicht. Den Begriff kniepe deuteten wir dahingehend, dass der Hahn bei diesem seltsamen Vorgang das Huhn in den Kopf kniff, weil er sich an den Kopffedern festhielt. Im gekochten Ei stießen wir ständig auf die „Hagelschnur,“ die wir fälschlicherweise mit dem Kniepen in Zusammenhang brachten und einfach de Kniep nannten. Beim Hahnenköppen zur Kirmes in Blankenheimerdorf kommt in der „Anklageschrift“ der Ausdruck knibbele zur Anwendung: Der Junker Theobald von Kamm und Knibbel wird zum Tod verurteilt, weil er eine Junghenne „auf bestialische Weise dreimal hintereinander geknibbelt hat.“ Knibbele steht auch für „knabbern, nagen“ oder für feine Handarbeit.
Knödde
Ein Knödde ist schlicht und einfach ein Knoten, die Wortverwandtschaft ist unverkennbar. Der Mundartausdruck hat mehrfache Bedeutung. So ist beispielsweise ein kleingewachsener Mensch ein Knöddche (Knötchen) und der Suffknödde (Saufknoten) ist ein Eifeler Wort für den Adamsapfel. Beim Holzhacken mühte sich Hahnebrochs Schäng mit einem besonders astknotigen Haustöck (Hackstück) ab und knirschte : Dech fraggech Loder krejen ech klejn on wennde duusend Knödde hätts, - er würde also das zähe Holzstück klein kriegen, auch wenn es tausend Knoten darin gäbe. Ein Knödde em Sackdooch (im Taschentuch) war und ist eine gebräuchliche Gedächtnisstütze, und der Kinderschuh ließ sich nicht vom Fuß bringen, weil der Schohreeme (Schnürsenkel) sich verknöddelt hatte. Einen dicken oder massiven Knoten nannte man auch Knodde. Wenn auf engem Raum die ausgestreckten Beine des Nachbarn zusätzlichen Platzmangel verursachen, wird ihm geraten: Maach dir ene Knödde en de Bejn. Ein am Hinterkopf zu einem Knödde aufgesteckter Zopf war früher eine sehr häufige Haartracht der Eifeler Frauen, allerdings nannte man dieses Gebilde meistens Knutz. Artverwandt mit Knödde ist der Ausdruck Knüüles als abwertende Bezeichnung für eines grobschlächtigen, sturen und dickköpfigen Menschen.
Knöddele (weiches ö)
Ein sehr einfaches und billiges, trotzdem schmackhaftes Gericht, eine Eifeler Version der schwäbischen Spätzle. Knöddele – bei uns daheim hießen sie Knüddele – ist vom Wort her eigentlich eine Bezeichnung für „Knödel,“ optisch sehen sie unterdessen nicht wie Knödel aus. Neben Jrompere (Kartoffeln), Melechzupp (Milchsuppe) und Suëre Kappes (Sauerkraut), waren Knöddele ein Hauptgericht auf dem Eifeler Mittagstisch, und ein billiges dazu: Diese Speise konnte man restlos aus eigenen Erzeugnissen herstellen. Bei uns in Schlemmershof kamen mindestens einmal in der Woche Knüddele auf den Tisch, und auch heute noch im „Dörf“ stehen Knöddele auf Muttis Küchenzettel. Als im Eifelhaus noch das Abstinenzgebot befolgt wurde, waren Knöddele, neben Herring mot Quellmänn (eingelegte Heringe mit Pellkartoffeln) das gängige „fleischlose“ Freitagsgericht, es wurde sogar bevorzugt, weil Fische gekauft werden mussten und Geld kosteten. Tatsächlich kommt man bei Knöddele sehr leicht ohne Fleisch auf dem Teller aus. Bei uns wird bei der Teigherstellung nicht mit Eiern gespart, das ergibt zwar eine etwas „festere“ Substanz, verbessert und intensiviert aber deutlich den sonst vorherrschenden Mehlgeschmack. Ich selber mag die Knöddele sehr gerne mit ein paar Salzkartoffeln zusammen, das Ganze mit brauner (in der Pfanne erhitzter) guter Butter übergossen, oder auch mit Speckwürfelchen garniert, – hmmmh! Da ist Fleisch überflüssig. Obst anstelle von Butter und Speck, eingemachte Pflaumen beispielsweise, auch das ist köstlich. Und was im großen Knöddelspott noch übrig bleibt, wird am nächsten Tag zusammen mit ein paar Salzkartoffeln und untergeschlagenen Eiern in der Pfanne leicht angebraten, – nochmals hmmh.
knommele (weiches o)
Verwirren, durcheinander bringen, Unordnung stiften, basteln, zustande bringen, tüfteln, – alles das und noch mehr besagte das Mundartwort knommele. Da war beispielsweise der Schnürsenkel am Schuh verknommelt und ließ sich nicht aufziehen, und wenn sich heutzutage das Kabel am Rasenmäher verheddert, gerät manch ein Hobbygärtner aus der Fassung: Dr Düwel soll esu en elende Knommel holle. In einem solchen Fall den Teufel zu bemühen, wäre ein ziemlich sinnloses Unterfangen, nützlicher wäre da eine funktionierende Kabeltrommel. Am Reichel (Rechen) mussten abgebrochene Zähne erneuert werden und das war en lästich Knommelsärbed (lästige Fummelei). Wer unordentlich gekleidet war, der sah knommelich aus. Knommele kam sowohl in positiven als auch in weniger angenehmen Redewendungen vor, fein üßjeknommelt beispielsweise bedeutete „fein ausgetüftelt,“ Knommelskroom dagegen war schlechte oder ungenaue Arbeit. Ein Knömmeler im positiven Sinn war ein handwerklich geschickter Mensch, der selten einen Fachmann brauchte. Ein Knommelspitter dagegen war sozusagen ein „Ersatz-Handwerker.“ Und weil Finchen beim Kirmesball zweimal den Röb (Robert) bei der Damenwahl zum Tanz holte, tuschelte man: Die zwei han bestemp e Knömmelche.
Knotterdöppe (weiches ö)
Ein urtümliches Eifeler Wort, wörtlich übersetzt Meckertopf, denn knottere bedeutet soviel wie „ständig nörgeln, meckern, kritisieren,“ und ein Döppe ist bekanntlich ein Topf oder Pott. Höck boste noch ens e richtich Knotterdöppe, stutzte mich unsere Jött zurecht, wenn ich wieder einmal vor lauter Langeweile knaatschich (weinerlich, unzufrieden) war und an allem etwas auszusetzen fand. Früher wie heute erwischte jeder einmal einen schlechten Tag, an dem er mom verkierte Bejn üß dem Bett (mit dem falschen Bein…) gestiegen war und seine schlechte Laune – heute vornehm „Frust“ genannt – ungerechterweise an seinen Mitmenschen abreagierte. Wenn das beispielsweise bei Jött oder Mam der Fall war, gingen wir Pänz den Beiden tunlichst und angelegentlich aus dem Weg. Ich schrieb es schon an anderer Stelle: In unserer Nachbarschaft wohnte Hubert Klinkhammer, ein alter eingefleischter Junggeselle, der mit sich und der Welt fast immer unzufrieden war. Bei uns hieß er allgemein Kaue Patt und wir Kinder bezeichneten ihn hinter der Hand als et Knotterdöppe. Wir gingen ihm aus dem Weg, weil er dauend über irgend etwas schimpfte und wetterte. Wenn er anders nichts fand, schimpfte er eben mit uns, deshalb mieden wir ihn. Und wenn er ganz schlecht gelaunt war, so wussten wir aus Erfahrung: Et Knotterdöppe ärgert sich, weil er nichts Handfestes zu kritisieren findet. Ähnliche Bezeichnung für das Knotterdöppe sind unter anderem Knotterpitter, Knurjelspitter, Kneiesköbes oder auch Meckerfritz.
Knüetschele
Im Frühjahr hatte ich von den noch grünen Beeren in unserem Garten „genascht,“ unglücklicherweise danach auch noch am Lohrbach Wasser getrunken, und bekam wenig später jämmerliche Bauchschmerzen. Für unsere Jött war die Sache absolut klar: Aha, woorste wier aan de Knüetschele, dat schad dir nix! Der Begriff Knüetschele war und ist auch heute noch in erster Linie das Wort für die Stachelbeeren. Bei uns daheim waren eher die roten, weißen und schwarzen Jannsdruve (Johannistrauben, wegen der traubenförmigen Fruchtstände) gemeint. Die diversen Sorten der Stachelbeeren nannten wir daheim bei ihrem hochdeutschen Namen. Aus Knüetschele fabrizierte Jött köstlichen Knüetschels Schelee (Gelee), wenn sie uns beim Stibitzen im Garten erwischte, gab es gehörig etwas auf die Finger und im Beichtstuhl mussten wir später bekennen: „Ich habe genascht.“ So streng waren damals die Sitten. Ein paar weitere Ausdrücke für die Knüetschele: Wimmele (Raum Aachen), Knuëschele, Knuaschele (Rheinland-Pfalz) oder Griescheln (Raum Trier). Mein Vater, der aus Wiesbaum im Kreis Daun stammte, sagte Grüenschele. Bei uns in der Hardt wuchsen vereinzelt wilde Johannisbeersträucher, Ohm Mattes, der alle heimischen Pflanzen kannte (ausgenommen die Pilze), hatte mir die essbaren roten well Knüetschele (wilde…) gezeigt. Sie sahen wie die Beeren im Garten aus, schmeckten aber fad und eigentlich „nach gar nix.“
Koëd (hartes o)
Die Koëd ist im alltäglichen Gebrauch derart häufig vertreten, dass uns ihre Bedeutung erst dann bewusst wird, wenn sie uns einmal fehlt: Starker Bindfaden, im erweiterten Sinne Schnur, Garn, dünnes Seil, allgemein Kordel. Zur Zeit unserer Eltern wurde Koëd ausschließlich aus Hanf hergestellt und war somit ein Naturprodukt, die heute übliche Kunststoffkoëd gab es damals noch nicht. In der kriegsbedingten Notzeit war der Hanf Mangelware, der Bindfaden wurde durch Papierkoëd ersetzt. Die aus braunen Papierstreifen gedrehte Koëd war nicht einmal ein Ersatz, sie war ein Nichts, das selbst wir Kinder mit der Hand zu zerreißen vermochten. Ein Tropfen Feuchtigkeit machte diesen „Bindfaden“ unbrauchbar. Ein absolutes „Unding“ war beispielsweise das Papier-Bindegarn des Mähbinders, papiergebundene Getreidegarben brauchte man beinahe im Sinne des Wortes „nur scharf anzuschauen“ und sie fielen auseinander. An dünne Hanfkoëd für unsere Dilldoppschmeck (Kinderpeitsche, siehe: Dilldopp) war schon gar nicht heran zu kommen, wir beschafften uns Ersatz aus dem Baumwoll-Bindegarn der Nähte an Papiersäcken. Diese Schmeckekoëd (Peitschenschnur) hielt allerdings nur kurze Zeit. Sech durch de Koëd maache war früher die Umschreibung für „abhauen, stiften gehen, sich verdrücken.“ Es gab beispielsweise den Kölner Gassenhauer vom „Zillekovens Chreß“: Dä hät sech durch de Kood jemaad, wejß kejner wo hä es? Diese Rheinländer-Melodie wurde auch bei uns auf jedem Ball gespielt.
Köhsteckel
Der Köhsteckel war ein fast unentbehrliches Alltagsgerät im Eifelhaus. Die Übersetzung lautet „Kuhstecken“ oder „Kuhstock,“ und das war in erster Linie das Werkzeug des Hütebuben zum Dirigieren seiner Weidetiere. Im Stall lehnten ständig mehre Steckelexemplare unterschiedlicher Stärken und Größen griffbereit an der Wand. Köhsteckele (Mehrzahl) schnitt man, wie auch Werkzeugstiele, in der nächsten Noßheck (Haselbusch), deren schlanke und schnack (gerade) gewachsene Gerten bestes Steckelmaterial ergaben. Der Köhsteckel wurde auch am Eingang der eingezäunten Viehweide als Sperre in die Verschlussbalken gesteckt, die zu diesem Zweck am Kopfende ein daumendickes Loch besaßen. Manche Weidetiere verstanden es nämlich, die Balken mit den Hörnern zur Seite zu schieben und stiften zu gehen (auszubrechen). In der Nummer 6 des Dörfer Heimatboten erzählt Hupperes Wellem (Willi Hoffmann) die Geschichte Wie Mam mom Köhsteckel koom (Als Mutter mit dem Kuhstecken kam). Die Mutter holte damals ihre beiden Sprösslinge vom Kirmesball, für den sie noch zu jung waren. Hupperes Drautche (die Mutter) war eine resolute Frau, die man ihm Alltag tatsächlich selten ohne ihren Köhsteckel sah.
Konsums Ann
In jedem Dorf gab und gibt es Personen, die sich durch ungewöhnliche Tätigkeiten oder Eigenarten die Gunst der Dorfgemeinschaft erworben haben und auf Grund dessen einen markanten Beinamen erhielten, in Blankenheimerdorf beispielsweise Klobbe (Johann Friederichs), Schang (Johann Leyendecker) oder et Schmedche (Josef Friederichs). Zu diesem Personenkreis zählte auch Konsums Ann. Mit richtigem Namen hieß sie Anna Rosen und war die Tochter von Johann Jakob Friesen, dem Inhaber des Hotels Friesen, von dem sie das Haus an der Einmündung Olbrücker Weg / Nürburgstraße (heute Nürburgstraße 57) übernahm und hier bis 1963 einen Konsum-Laden führte. Diesem Umstand verdankt sie den Beinamen Konsums Ann, aus dem ursprünglichen Hausnamen „an Heinens“ wurde „et Konsum.“ Konsums Ann war eine etwas korpulente Frau, ihr Ehemann Nikolaus, Konsums Nik genannt, war Eisenbahner, er hat mir noch zu meiner Steinfeld-Zeit die Schülermonatskarte verkauft. Konsums Ann war eine große Förderin des Dörfer Karnevals. Neben Hans Klaßen (die Hääp), Heinz Kastenholz und Walter Zimmermann, war sie eine „Triebfeder“ bei der Gründung des Karnevalsvereins im Jahr 1959, sie gehörte auch dem ersten Vorstand als Kassiererin an. Nicht zuletzt hat sie mit der einheimischen Jugend bis zum Geht-nicht-mehr Katrill (Quadrille) und Lancier einstudiert in dem Bemühen, altes Lied- und Tanzgut im Dorf nicht aussterben zu lassen. Ihre Mitstreiter in diesem Vorhaben waren Kuhle Klööß (Nikolaus Görgens) und Fräulein Maria Hitzges, die damalige Lehrerin und spätere Frau von Matthias Rosen.
Koorschloot (hartes o)
Die offizielle Bezeichnung ist „Feldsalat,“ bei uns wurde daraus Koorschloot (Kornsalat), weil die Salatpflanze häufig auf abgeernteten Getreidefeldern zu finden war, vornehmlich auf Koor- und Wejßstöcker (Roggen- und Weizenfeldern). Dieser wildwachsende Salat war wesentlich aromatischer als der Zuchtanbau, ich selber mochte allerdings die Koorschloot nicht, eben wegen ihres für meine Zunge etwas bitteren Geschmacks. Der Salat ist in unserem Dialekt weiblichen Geschlechts: Die Schloot. Nach Abschluss der Getreideernte wurden wir Kinder zum Koorschloot steiche (stechen) auf die Stoppelfelder geschickt. Feldsalat durfte man damals offiziell auch auf fremden Äckern sammeln, dasselbe galt für das Ähreraafe (Ähren auflesen). Wer das nicht dulden mochte, der stellte am Zugang zum Acker ein so genanntes Wehrries (Wehrreis, Verbotszeichen) auf. Das war ein in die Erde gerammter Stock mit einem Büschel Ginster oder Stroh am oberen Ende. Das Wehrreis war ein gültiges Verbotszeichen, die Nichtbeachtung konnte empfindliche Folgen nach sich ziehen, beispielsweise wenn der Übeltäter vom Feldhüter erwischt wurde.
Körvje
Ein Körvje ist in unserem Dialekt die Bezeichnung für „Körbchen.“ Die Holländer sagen körfje, kennen aber auch mand als Begriff für „Korb,“ was bei uns mit Mang umschrieben wird. Et Körvje war früher und ist bei uns hier auch heute noch ein fester Begriff: Ein etwa 30 Zentimeter großes, flaches Weidenkörbchen. Es ersetzt schon seit meiner Messdienerzeit in den 1940-er Jahren in unserer Kirche den „Klingelbeutel“ beim „Opfergang“ bei kirchlichen Anlässen. Mom Körvje john (mit dem Körbchen gehen) war und ist die Aufgabe des Kirchenvorstands. Das war früher bei uns der „ewige“ Kirchenrendat Nikolaus Brück. Er hatte in einer der Kirchenbänke seinen mit einem Emailleschild „Kirchenvorstand“ gekennzeichneten festen Platz, von dem aus er zur „Opferung“ mit dem Körvje startete. Das offene Sammelbehältnis hatte und hat seine Vor- und Nachteile, indem es nämlich dem Kirchenbesucher Einblick in die Spendenfreudigkeit des Nachbarn vermittelt. Da ist beispielsweise zu beobachten, wie einer verschämt ein paar Cents ins Körvje tut, sein Nachbar dagegen stolz die Faust über dem Behältnis öffnet und eine Zehnerschein hineinfallen lässt, aus geziemender Höhe, damit auch aus weiterer Entfernung das “Opfer“ zu sehen ist. Früher war es bei Beerdigungen üblich, dass die Leute in langer Reihe an der Kommunionbank vorbei marschierten, ihren Obolus in das dort aufgestellte Körvje taten und sich dafür einen der Totenzettel mitnahmen, die daneben ausgelegt waren. Heute werden kaum noch Totenzettel angefertigt. Wenn doch, dann liegen sie im Körvje und jeder Spender bedient sich nach Belieben.
Koss (weiches o)
Das Wort bedeutet im Dörfer Dialekt Kiste und wird mit weichem o gesprochen, im Unterschied zu Koss mit hartem o (wie Schloss), was dann aber Kost bedeutet. Die Umwandlung i in o kommt häufig vor: Et Kond hät en de Koss jedrosse beispielsweise besagt, dass „das Kind in die Kiste gesch… hat.“ Die Koss muss in unserem Alltag für zahllose Anwendungen herhalten. Ech john en de Koss beschreibt beispielsweise der Arbeitsmann nach rechtschaffenem Werktag sein Zubettgehen. Mir han kostewies de Äppel opjeraaf (…kistenweise Äpfel aufgesammelt) war die Folge eines heftigen Sturms. Ein ausgedientes altes Fahrrad ist en aal Koss, ein schrottreifes Auto oder auch ein ausrangiertes Möbelstück. Maach die Jammerkoss doch endlich üß lautet die Aufforderung, den „Jammerkasten“ (Fernseher) doch endlich auszuschalten. Dunnerkiel, dat hät äwwer en Koss sagt sich mancheiner insgeheim, wenn ihm ein ungewöhnlich stattliches weibliches Hinterteil zu Gesicht kommt. Wenn einer de janz Koss jeschmosse hät, so bedeutet das: Er hat eine Aufgabe voll und ganz erfüllt. Etwas makaber, aber alltäglich ist Koss in der Bedeutung von Sarg. Ein gängiges Zitat ist beispielsweise Wemmer bos en de Koss ze lejje kon, dann hammer üßjesörch (Wenn wir erst im Sarg liegen, haben wir ausgesorgt). Und schließlich: Der Kistenhersteller Alois ist Koste-Allwis.
Koster (weiches o)
Unser Dialekt ist geradezu gespickt mit Wörtern holländische Abstammung, hier ist wieder eins: Der holländische „koster“ ist der deutsche „Küster“ und der wird bei uns genauso ausgesprochen wie in Nederland: Koster. Das Urwort ist wohl das lateinische „custos,“ womit der Hüter des Kirchenschatzes bezeichnet wurde. Früher hatte in der Regel der Dorflehrer auch das Amt des Küsters auszuüben, nicht zuletzt weil er musikkundig war, Orgel oder Harmonium spielen konnte und auch zum Führen der Kirchenbücher imstande war. Mehr als 50 Jahre lang war Karels Mechel (Michael Jentges) Koster und Organist in Blankenheimerdorf. In den Kriegsjahren versah Frau Franziska Schlemmer (Hanze Fränz) den Küsterdienst. Nach dem Krieg wurde Berchs Pitter (Peter Berg) Küster, während Karels Mechel sich weiterhin der Kirchenmusik widmete. Zu meiner Messdienerzeit unter Dechant Lux wurde der Koster in einem unserer „Klepperlieder“ besungen: Paternoster / joof dem Koster / ejne aan e Uhr / dat hä fuhr / bos noo Ruhr / bie dr Pastur / en dr Flur. Der arme Küster bekam also eine derart kräftige Ohrfeige, daß er bis in den Flur des Pfarrhauses von Rohr flog. („Ruhr“ ist der Mundartname des heutigen Blankenheimer Gemeindeteils Rohr).
nach oben
zurück zur Übersicht
Köttel (weiches ö)
In vielen Fällen bringen wir den Begriff unwillkürlich mit der Maus in Verbindung, die klassische Eifeler Köttel nämlich ist die Muusköttel, wegen ihrer Gestalt und Größe. Köttele, das sind geformte Kotteile von Mensch oder Tier, meistens kleineren Ausmaßes und fest strukturiert. Bekannte Köttele sind auch die Haseköttele, die wir wegen ihrer kugeligen Form und Zentimetergröße auch Hasekneckele nennen (Kneckele = Murmeln). Beim Kaninchenzüchter fallen sie als Kanengskneckele (Kaninchenmurmeln) an. In böser Erinnerung sind mir Köttele aus dem Jahr 1989. Da hatte nämlich eine Schafherde zwei Tage vor dem Wiesenfest den Platz total „versaut,“ wir wateten buchstäblich durch Schoofsköttele (Schafskot) und es stank fürchterlich. Wir konnten damals kurzfristig das Fest auf den neuen Sportplatz verlegen. Geradezu verhasst sind Hohnerköttele (Hühnerkot), wer eventuell einmal einen Hühnerstall hat reinigen müssen, der weiß sehr wohl ein „Guanoliedchen“ zu singen. Allbekannt sind Päedsköttele (Pferdeäpfel), die früher als Gartendünger von der Straße aufgesammelt wurden. Auch dazu eine persönliche Erinnerung aus den 1980-er Jahren: Das Ross des Prominen- tensöhnchens pflanzte mir einen dampfenden Köttelshaufen direkt vor die Bahnhofstreppe auf die samstäglich frisch gekehrte Straße. Meine erboste Frage wer macht das jetzt weg wurde standesgemäß beantwortet: „Sie wissen wohl nicht, wer ich bin!“ Erhobenen Hauptes trabte das Kerlchen von hinnen und ward nicht mehr gesehen. Damals nahm ich Kehrblech und Besen zur Hand, um Ärger zzu vermeiden. Heute würde ich es auf den Ärger ankommen lassen. Kleinkinder werden auch gelegentlich Köttel genannt, das Neugeborene ist zum Beispiel e leev Köttelche. Und als der Chefarzt nach der Darmoperation am dritten Tag auf der Intensivstation in meinem Bett eine Spur Darminhalt entdeckte, rief er sichtlich erfreut: Der Vossen hat geköttelt, jetzt sind wir über´n Berg.
krabitzich
Schon vom Klang her erregt das Wort irgendwie Missfallen und Ablehnung, hier wird ersichtlich: Der Ton macht die Musik. Das Eigenschaftswort krabitzich lässt sich im Hochdeutschen unter anderem mit „unverträglich, zänkisch, reizbar, aufsässig“ beschreiben. Soweit weibliche Personen einbezogen werden, wäre„kratzbürstig“ ein besonders treffendes Wort. Krabitzich nämlich ist aus kratze und bieße (kratzen und beißen) zusammengesetzt. Das vom Adjektiv hergeleitete Hauptwort ist die Krabitz, und dieser „Titel“ wird auf alle Geschlechter und alle Altersklassen angewandt. Die Alte os höck noch ens krabitzich, der jehste am beste üß de Fööß ist der gut gemeinte Rat, die Nähe der misslaunigen Weiblichkeit zu meiden. Aber auch die Herrn der Schöpfung bleiben nicht ungeschoren: Je ähler die Böck were, desto krabitzijer werense och (Je älter die Böcke werden, desto aufsässiger werden sie auch). Ein solch krabitziges Knotterdöppe war beispielsweise zu meiner Kinderzeit unser Nachbar Kaue Patt, ein mit sich und der Welt unzufriedener alter Junggeselle. Bos net esu krabitzich, oder et jitt jät honer de Horchlöffele (Sei nicht so aufsässig, oder es setzt Ohrfeigen) war eine meist recht wirksame Elternmahnung, und Mensch wat boßte höck noch ens für en Krabitz beschwerte sich Lieschen bei der Spielkameradin. Selbst Tiere konnten krabitzich sein. Die Katzenmutter beispielsweise fauchte und kratzte ziemlich unangenehm, wenn wir ihren Kindern zu nahe kamen. Und die Brong (die Braune), eine unserer Gespannkühe, war ein ständig aufgeregtes und bockiges Vieh und galt daher ganz allgemein als krabitzich Loder.
Krall
Ein Wort mit mehrfacher Bedeutung. In erster Linie bezeichnet es die Tierkralle, nach deren Form auch die „Teufelskralle“ benannt ist. Diese Blume hieß bei uns Düwelskrall. Überlange Fingernägel, wie sie heutzutage vielfach Mode sind, darf man getrost auch als Kralle (Plural) bezeichnen. Bei der samstäglichen Ganzkörper-Generalreinigung war für uns Pänz das Kralle schnegge (Fingernägel schneiden) eine unbeliebte, von Mam aber unnachsichtig geforderte Prozedur. Weniger bekannt ist die Krall als Schmuckgegenstand. Du häß jo en nöü Krall aan, bestaunte Lieschen ihre Schulfreundin und war ein wenig neidisch, weil ihre eigene Krall nur aus bunten Glasperlen bestand. Es gab damals Halsketten aus Korallenästen, dem so genannten „Korallenskelett“, die wegen ihrer ungewöhnlichen Form und ihrer kräftigen roten Farbe bei den Mädchen sehr beliebt waren. Eine solche Kette nannte man Krall, wobei offensichtlich die Koralle über „Korall“ zur Krall verstümmelt wurde. Vielleicht auch erinnerten die bizarren Korallenäste ein wenig an die Tierkrallen. Die Bezeichnung Krall übertrug sich in der Umgangssprache auf Halsketten jeglicher Art. Schließlich gab es noch krall als Eigenschaftswort, das soviel wie „lebhaft, munter, drall“ bedeutete. Von einer nicht mehr ganz jungen, aber noch gut aussehenden Frau wird gesagt: Dat os noch e krall Mensch, und wenn die „Munterkeit“ in eine spezielle Richtung zielt, fügt man noch wohlmeinend hinzu: Dat os wahl noch jauker.
Krampe
Im Lexikon wird die Krampe als „u-förmige Eisenklammer“ beschrieben, im Dialekt dagegen ist es ein massiver eiserner Haken beispielsweise am Gartentörchen, der zum Zusperren oder Fixieren in eine Öse eingehängt wird. Im Dialekt wird die Krampe männlich: Dä (der) Krampe. Den Krampen fand man früher häufig als Verschluß an der zweiteiligen Stalltür, an Fensterläden und nicht zuletzt an der Tür des bekannten „Herzhäuschens.“ Das Ein- oder Aushaken des Krampens nannte man krämpe. Das Gegenstück des Krampens, die Öse zum Einhängen, war das Ouch (Auge). Zumindest früher war ein gewisses weibliches Bekleidungsstück mit winzigen Krämpcher „verschlossen,“ deren Öffnen spannend und mühsam zugleich war. Daran dürfte sich bis heute nichts geändert haben. Der Komiker und Sänger Mike Krüger wusste darüber ein Liedchen zu singen: „Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche zieh´n.“ Ein früher häufig gebrauchtes Schmähwort aus der Gossensprache war Aaschkrampe, es ist auch heute noch nicht völlig aus der Mode gekommen. Und schließlich war Krampe auch regional der Ausdruck für „Krampf.“ Wenn etwa Hermännchen sich jammernd die Wade massierte, hatte er ene Krampe em Bejn.
kriesche
Wer den Ausdruck nicht kennt, vermutet vielfach kreischen als Bedeutung dahinter. Das wäre unterdessen absolut falsch, „kreischen“ nämlich heißt bei uns krejsche, das hier erwähnte kriesche bedeutet ausschließlich weinen. In Holland gab es den Ausdruck „krijten.“ Interessant sind die Vergangenheitsformen: Kresch und jekresche. Es ist etwas dran an der Weisheit unserer Vorfahren: Wä net kriesche kann, dä kann och net laache (Wer nicht weinen kann, der lacht auch nicht). Dass echtes Weinen in manchen Fällen heilsam sein kann, ist bekannt: Mot kloor jekreschene Oure sieht mr alles janz annesch (Mit klar geweinten Augen sieht man alles ganz anders). Kriesche ist nach mancher Leute Ansicht eine Untugend der Kinder: Du moß net wäje jedem Futz kriesche (nicht wegen jeder Kleinigkeit heulen), und für den Karl May-kundigen Westmann galt der Vorsatz Indianer kriesche net. Wenn man im „Kampf“ mit dem Spielkameraden den Kürzeren gezogen hatte, lief man all Krieschens (bitterlich weinend) zu Mam oder Jött und klagte dort sein Leid. Manche Mitmenschen haben „nahe ans Wasser gebaut“ (weinen leicht), von ihnen sagen wir dem stejt et Kriesche noher wie et Laache. In einer rat- oder ausweglosen Situation entfährt uns oft der Seufzer Jung et os für ze kriesche (es ist zum Heulen). Am Grab eines Verstorbenen fließen nicht selten die Tränen der Angehörigen in Strömen und die Leute sagen dä hät jekresche wie e klejn Kond (…wie ein kleines Kind). Und wenn ein Weinender ganz und gar nicht zu trösten ist, gibt es noch den letzten Versuch hüer op ze kriesche, sons fangen ech och aan.
Krockstoppe (weiches o)
Eine weitere, aber irreführende Schreibweise ist Kroggstoppe, was übersetzt „Unkrautstopfen“ heißt und keinerlei Sinn ergibt (Krogg, Krugg, Krütt = Unkraut). Krockstoppe ist das Eifeler Wort für eine klein gewachsene und in der Regel auch dicke Person vornehmlich männlichen Geschlechts. Aber auch eine dicke kleine Frau kann ein Krockstoppe sein. Kleine Leute machen gern durch große Worte und vermeintlich kluges Reden auf sich aufmerksam, und das quittieren wir ein wenig gehässig: Kick ens dä Krockstoppe, dä dejt wie ene Jrueße (Sieh nur den Zwerg, der tut wie ein Großer). Als Vierzehnjähriger kam man früher üß dr Scholl (aus der Schule = Volksschulentlassung) und fühlte sich unendlich erwachsen. Das ließ man dann auch den noch schulpflichtigen Kumpel bei jeder Gelegenheit spüren: Du Krockstoppe, komm du iësch ens üß dr Scholl, dann kannste mot kalle (Du Zwerg, absolviere erst mal die Schule, dann kannst du mitreden). Der Wortteil Krock ist vom hochdeutschen „Krug“ hergeleitet, was besonders auch beim holländischen kruik (Krug) erkennbar wird. Der früher übliche bauchige „Steinkrug“ mit oft mehreren Litern Fassungsvermögen, wurde mit einem kurzen und besonders dicken Stopfen verschlossen: Der „Krugstopfen,“ der bildlich ja auch mit einem dicken kleinen Menschen in Verbindung zu bringen ist. Im Kölner Dialekt wird unser Krockstoppe zum Kruckestoppe. Es gibt eine etwas hintergründige Rätselfrage: Wat oß ene Krockstoppe, dä en eejene Mejnung hät? (Was ist ein kleiner Mann mit einer eigenen Meinung). Die Antwort: Em Onräëch (Im Unrecht).
krogge (weiches o)
Die wörtliche Übersetzung müsste „krauten“ sein, Krock nämlich ist Kraut und im allgemeinen Sprachgebrauch das Wort für Unkraut. In Blankenheimerdorf allerdings sagt man Krütt oder auch Krutt. Krogge oder auch Krütt üßmaache bedeutet also „Unkraut jäten.“ Das Werkzeug hierfür ist das allbekannte Kroggiese (Jäteisen) in seinen verschiedenen Bauarten. Das Kroggiese ist ein spitzes oder krallenartiges Instrument, dessen Aussehen und Eigenschaften gelegentlich auf bestimmte Personen übertragen werden und sie zum Kroggiese abstempeln. Wellem (Wilhelm) war in seinem Garten am krogge, ein Urlauber aus der Stadt schaute ihm über den Zaun herüber ein Weilchen zu und bat dann um einen guten Tip, wie man am sichersten das Unkraut von den Nutzpflanzen unterscheiden könne. Er selber sei sich da noch nicht so ganz sicher. Wellem empfahl, alles handhoch wachsen zu lassen, dann alles auszureißen und wat dann wier wääß, dat os Krütt (was dann wieder wächst, das ist Unkraut). „Das muss ich mir merken,“ freute sich der Stadtmensch und zog zufrieden vondannen. Es gibt ein altes Schmunzelwort vom Bauern, der in der freien Natur sein „Geschäft“ verrichtete und eine Handvoll Kraut und Blätter, darunter auch Brennesseln, zum „Abwischen“ benutzte. Der Schlussvers besagt: Hätt dä Buër dat Krutt jekannt, hääf hä net seng Fott verbrannt.
Krollekopp
Viele Leute finden ihn „schön, super, geil und in“ und lassen ihn sich vom Spezialisten künstlich und künstlerisch anlegen. Ich besaß von Natur aus einen und habe seinetwegen manche Kinderträne vergossen: Den Lockenkopf. Das waren allerdings bei mir nicht etwa schön sanfte und geschmeidige „Engelslocken,“ das war vielmehr ein Wuschelkopf, ein fast undurchdringliches krauses Haargewirr, ein echter Krollekopp. Auf ein paar Kinderfotos erscheine ich zwar dem Betrachter wie e lecker Kerlche mit meinem wuscheligen blonden Krollekopp, die dahinter versteckte Pein, das Kinderleid und die Tränen, die bleiben unterdessen unsichtbar. Im Schlaf verfilzten und verwirrten sich meine Krolle allnächtlich zum regelrechten Dickicht, das morgendliche „Lichten“ beim Kämmen gng nicht ohne jammervolles Ach und Wehe vonstatten, sowohl Mam als auch ich selber gerieten nicht selten an den Rand der Verzweiflung. Einen mittleren Krollekopp besaß ich noch auf dem Gymnasium, allerdings weniger verfilzt als in Kindertagen. Auch früher waren Kröllcher in der Damenwelt beliebt, manche Kirmes- oder Festtagsfrisur zielte auf derartigen Kopfschmuck ab: Mit der Brennscheer verhalf man dem strähnigen Haar zum vollendeten Krollekopp und ließ sich beim abendlichen Ball bewundern: Kick ens, wat dat Rös Kröllcher hät (sieh nur die Locken von Rosa). Ob weiblich oder männlich, – der Krollekopp unserer Tage weist nach Meinung des Nichtfachmanns ein wesentliches Merkmal auf: Je wööster, desto besser, der Phantasie und dem persönlichen Geschmack sind keinerlei Grenzen gesetzt.
kromm (weiches o)
Alles, was nicht schnack (gerade) ist, das ist eben kromm (krumm). Kromm ist ein absolut negatives Wort, das in einer Vielzahl von Redewendung zur Anwendung kommt. Da ist beispielsweise der allgemein unbeliebte Mitmensch ene krommen Hond (ein krummer Hund), ein störrisches Tier ist e kromm Loder (ein krummes Luder). Loder bezieht sich in diesem Fall auf ein Tier, es wird aber auch ganz allgemein auf Gegenstände angewendet, die ihre Funktion nicht ordentlich erfüllen: Dat kromm Loder van ener Sänßel schnegg net drückt beispielsweise den Ärger über eine stumpfe Sense aus. Der Krommstevvel (Krummstiefel) ist eigentlich ein krummbeiniger Mensch, das Wort wird aber auch etwas hintergründig für einen „Schlauberger“ verwendet. Statt Krommstevvel kannte man früher auch den Ausdruck Kromm Botz (Krumme Hose), einer meiner damaligen Kollegen hatte diesen Spitznamen. Weitere Redenwendungen sind op kromm Jedanke komme oder auch sech kromm läje (sich krumm legen = einschränken) und sech komm on schwazz ärjere (sich krumm und schwarz ärgern). „Krom“ ist das holländische Wort, unser „krumm und lahm schlagen“ heißt in Holland „bont en blauw slaan“ (bunt und blau schlagen)
Krömmsteckel (weiches ö)
Die Übersetzung lautet Krummstock oder Krummstab, und da bei uns der Stab zum Steckel wird, ergibt sich im Dialekt eben der Krömmsteckel. Das ist in der Regel ein normaler Stock mit einer Rundung (Krümme) am oberen Ende, das Gerät wird vorwiegend in der Liturgie verwendet und ist als Bischofsstab bekannt. Unser mundartlicher Krömmsteckel gehörte allerdings zum Handwerkszeug der Hütebuben und wurde in Eigenproduktion angefertigt. Beste Voraussetzungen für die Herstellung eines Krömmsteckels boten uns die Haselbüsche mit ihren zweijährigen schlanken und gerade gewachsenen Trieben. Die wuchsen nicht selten etwas abseits vom eigentlichen Busch aus der Erde hervor und kündigten uns an: Darunter befindet sich eine waagerechte Wurzel, ein natürlicher Handgriff für unseren Steckel. Die Wurzel wurde ausgegraben, handgerecht abgeschnitten und sauber geglättet. Der rechtwinklig abstehende Trieb wurde entsprechend den Körpermaßen des Besitzers „abgelängt“ und fertig war der neue Krömmsteckel, in der „Bauart“ in etwa einem normalen Krückstock ähnelnd. Der Alltags-Hütesteckel besaß keinen derartigen Handgriff. Mancher Hütebub schälte das neue Werkzeug, damit es schön weiß und sauber wurde, ein anderer beließ die Rinde am Holz und schnitzte die tollsten Ornamente, Zahlen und Namen hinein, – am Weidefeuer hatte man ja alle Zeit der Welt für solch eine mühselige Arbeit zur Verfügung.
Kroppsack
Manche Erwachsene kommen sich den Kindern und jungen Leuten gegenüber ungeheuer wichtig, weise und für die Umwelt bedeutsam vor und bringen diese „Würde“ zum Ausdruck, indem sie die Jüngeren mit Kroppsack titulieren. Das Wort klingt in der Regelziemlich arrogant und ein wenig gehässig und soll auf „Minderwertigkeit“ und „Kleinheit“ des Angesprochenen hinweisen. Auf erwachsene, kleinwüchsige Menschen angewendet, ist Kroppsack ein echtes gehässiges Schimpfwort, bei einem körperlich Behinderten kann es sogar eine schwere Beleidigung bedeuten. In der „Elternsprache“ dagegen ist Kroppsack ein Alltagswort, in manchen Fällen sogar ein Kosewort. Ich selber beispielsweise war so lange ich denken kann, als Kind für meinen Vater immer nur der Kroppsack, und das war niemals negativ gemeint. Nu kick ens, wie dä Kroppsack mot dem Roller ömjohn kann freute er sich mit Mutter über mein Hantieren mit dem neuen Roller, den er für mich geschreinert hatte. In der Schulpause sonderten sich oft die „Großen“ von der Masse ab und tuschelten untereinander. Wenn einer von uns ihnen zu nahe kam, wurden sie grob: Hau ab, Kroppsäck könne mir hie net bruche (nicht brauchen). Ein fast gleichwertiges Schimpfwort ist Kroppaasch, das aber weniger zur Anwendung kommt, meist in verächtlicher Form einem kleinen Frechdachs gegenüber: Paß blos op, du Kroppaasch, jlich kreßte e paar honner de Horchlöffele (…gleich fängst du ein paar Ohrfeigen). Das Adjektiv zu Kroppsack lautet schlicht kroppich. Ein dreistes Kind wird beispielsweise kritisiert: Dat kroppich Loder os esu frech wie ene Jrueße (…ist so frech wie ein Großer).
Krütt
Das Wort ist weit eher als Krutt im Gebrauch und bedeutet allgemein „Kraut,“ vielfach wird es auch anstelle von „Unkraut“ angewandt. Hierbei hat sich unterdessen überwiegend Onkrutt eingebürgert. Den Senioren speziell in Blankenheimerdorfer ist dagegen noch Krütt ein Begriff. Et Krütt wääß vanselever, dat bruch kejne Konsdönger (Das Unkraut gedeiht auch ohne Kunstdünger) klagt so mancher Kleingärtner. Der Feriengast schaute dem Eifeler Hobbygärtner ein Weilchen beim Unkrautjäten zu und fragte, ob es vielleicht Anhaltspunkte zur Unterscheidung zwischen Nutzpflanzen und Unkraut gäbe, er selber sei sich da noch nicht so ganz sicher. Zufrieden nahm er den Rat von Jannespitter mit nach Hause: Alles handhuh waaße losse, dann alles üßrieße, wat dann wier wääß, dat os Krütt (Alles handhoch wachsen lassen, dann alles ausreißen, was dann wieder wächst, das ist Unkraut). Das würde er zu Hause ausprobieren, freute sich der Urlauber. Ein anderer Urlauber verrichtete im Eifeler Gebüsch ein „großes Geschäft“ und säuberte sich in Unkenntnis der Gewächse mit einer Handvoll Brennesseln, was naturgemäß ein wenig „brenzlich“ wurde. Jannespitter zog daraus das Fazit: Hätt dä Mann dat Krütt jekannt, hätt hä net seng Fott verbrannt, – eine Übersetzung ist wohl nicht erforderlich. Krütt steht also bei uns hauptsächlich für „Unkraut,“ in vielen Fällen ist auch Krutt üblich. Bekannt und beliebt ist beispielsweise Röbekrutt (Rübenkraut) und davon hergeleitet die Redewendung wie Krutt on Röbe (wie Kraut und Rüben).
Kruttwösch
Am 15. August feiert die katholische Kirche das Fest Mariä Himmelfahrt. Zum festlichen Gottesdienst bringen die Kirchenbesucher selbstgepflückte Kräuter mit, die im Verlauf der Feier gesegnet werden. Mit Blick auf diese „Kräuterweihe“ nannten unsere Eltern den 15. August Kruttwöschdaach oder auch Kruttwöschfess. Kruttwösch bedeutet „Krautwisch, Krautbündel, Krautstrauß.“ Der gesegnete Strauß sollte Unheil von Haus und Stall abwenden, unter dem Dach aufgehängt, sollte er beispielsweise das Haus vor Blitzschaden bewahren. Dasselbe galt für das Verbrennen gesegneter Kräuter im Herdfeuer während eines Gewitters. Unter das Viehfutter gemischt, schützten die Kräuter die Tiere vor Krankheiten, wie auch die an Fronleichnam für die Altarteppiche verwendeten Blumenblüten. Der Kruttwösch bestand aus einer bestimmten Anzahl von Kräutern, dabei spielten die Drei als „heilige“ Zahl und die Sieben mit ihren Vielfachen eine bedeutende Rolle. So ein Wösch konnte 77 oder 99, mindestens aber drei verschiedene Kräuter umfassen. Das Fest Mariä Himmelfahrt war der „Auftakt“ Zum Sammeln der Kruttwösch-Kräuter, ab diesem Tag wurde den Kräutern besondere Schutz- und Heilkraft zugeschrieben (Quelle: Brauchtumsseiten.de).
Küel
Das Wort wird Kü-el gesprochen. Küel sind ganz allgemein junge Gemüsepflanzen zum Ausbringen in Feld oder Garten. Bei uns waren es speziell die Koleraweküel, die Setzlinge der weißen Steck- oder Futterrüben. Mancheiner zog sich den Eigenbedarf mühsam im Garten heran, meistens wurden die Küel aber in Form einer Sammelbestellung fürs halbe Dorf aus bestimmten Anbaugebieten bezogen, zum Beispiel aus Baasem. Die Pflanzen wurden einzeln von Hand hinter dem Pflug auf die frische Fuhr (Ackerfurche) gesetzt. Das ging im üblichen Pflanzverfahren vonstatten: Mulde graben, Pflanze hinein, andrücken. Unser Jahresbedarf daheim waren 500 Stück, - abends war der Rücken kromm on lahm wie nach dem Kartoffelpflanzen, und dauerhafte „Trauerränder“ verunzierten die Fingernägel. Wenn es bei feuchtem und kühlem Mai- oder Juniwetter Küel setze hieß, war die gesamte Hausmannschaft gefordert. Wir Kinder mussten dabei Küel läje (legen), das heißt mit einem Packen Pflanzen auf dem Arm hinter dem Pflug her stapfen und die Küel pflanzgerecht im richtigen Abstand auf die Fuhr legen. Am nächsten Tag ließen die Pflanzen de Flutsche hange (sie hatten sich zur Erde geneigt), im Regelfall und bei guter Witterung hatten sie sich wenig später wieder aufgerichtet und standen schnack wie de Soldate. Ohm Mattes kam von einem Kontrollgang zurück und stellte zufrieden fest: De Küel stohn joot (stehen gut = sind angewachsen). Heute sieht man keine Kolerawefelder mehr: Der Anbau von Steckrüben ist zu aufwendig.
Kuttekopp
Mundartwort für die Kaulquappe (Froschlarve). Zu meiner Kinderzeit gab es in jedem flachen und ruhigen Gewässer im Frühjahr Kutteköpp (Plural) in Massen. Wir Pänz fingen mühsam die wibbeligen (unruhigen, beweglichen) Tierchen mit der Hand ein und sperrten sie in ein Einmachglas mit Wasser, - wo sie nach kurzer Zeit verhungerten, weil ihnen die „Babynahrung“ fehlte: Froschlaich. Unser damaliger Zeitvertreib wäre heute geradezu eine Freveltat gegen den Naturschutz. In der Südeifel heißt die Kaulquappe „Koutsekopp“. Auch unsere Nachbarn in Holland kennen den „kuttenkop“ als abwertenden Begriff für eine „afschuwelijke vrouw“ (wörtlich = abscheuliche Frau), im übertragenen Sinn also eine unangenehme Person. Unverkennbar besteht hier eine Verbindung zu unserem Kuttekopp, dem ja auch eine besondere Schönheit nicht nachzusagen ist. Ein weiteres, zumindest regional gebräuchliches Eifeler Wort für die Kaulquappe ist Küülkopp, und das wiederum übertragen wir auch auf den Menschen: Ein halsstarriger, dickköpfiger und sturer Mitmensch ist ein Küülkopp oder ganz einfach ein Küüles. Regional ist Küüles auch ein allgemeiner Begriff für „Kopf,“ Wenn ich beispielsweise einem elterlichen Befehl nicht unverzüglich Folge leistete, konnte sich Pap (Vater) mächtig aufregen: Dä Kerl moß doch dauernd senge Küüles durchsetze.
küüme
Stöhnen, heulen, jammern, wehklagen, sich beschweren, - diese und noch etliche Untugenden“ mehr fassen wir in unserem Dialektwort küüme zusammen, ein „All-in-one-Wort“ also, um es in unserer aktuellen Computersprache auszudrücken. Küüme ist meistens mit einer negativen Vorstellung verbunden: Schon bei jeder Kleinigkeit sich beklagen, jammern ohne einen echten Grund, beim geringsten Anlass stöhnen. Wer also bei jeder Gelegenheit küümp on lamentiert, der stempelt sich selber als Küümes oder Küümpitter ab und macht sich unbeliebt. Os dat Liss ad wier am küüme! Dem seng Küümerej kann ejnem äwwer op dr Wecker john (Elisabeths Jammern kann einem auf den Geist gehen). Dä küümp üwwer jedem Dress, dem senge Küüm hät kejn Hand on Fooß (völlig unbegründetes Jammern wegen jedem Sch..dreck). Wenn es im heißen Sommer wieder einmal tagelang en et Heu john hieß, blieb unser kindlicher Protest – wir mußten selbstredend mit an die Arbeit – naturgemäß nicht aus, allerdings ohne Erfolg: Et Küüme notz dech nix, dat Heu moß eren (Gejammer oder nicht, das Heu wird eingefahren). Die Vergangenheitsformen sind kuump und jekuump. Am Abend fühlte sich Mattes nicht wohl und Drinche erkundigte sich besorgt: Nu häßte dr janz Daach eröm jekuump, wat deijt dir dann ejjentlich wieh (…was tut dir denn echt weh). Und Mattes kuump ratlos und verdrießlich: Ech wejß et selever net, mir deijt ejnfach alles wieh (er wusste es also selber nicht, ihm tat einfach alles weh).
nach oben
zurück zur Übersicht
|