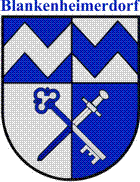 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Aktualisierung |
|||||||||||||||||||||||
|
15.03.2024 |
|||||||||||||||||||||||
 |
|||||||
|
Herzlich willkommen in Blankenheimerdorf |
|||||||
|
Gedanken am Heiligabend Es wird mir immer ein Rätsel bleiben, warum während meiner aktiven Dienstzeit so oft ältere Menschen ausgerechnet mir, dem damals doch relativ „jungen Spund“ hinter dem Schalterfenster im kleinen Eifelbahnhof, ihr Herz ausgeschüttet haben. Von Freude und Leid erfuhr ich, hörte von Sorgen und Problemen manchmal persönlichster Art, was mich nicht selten recht verlegen werden ließ. Da war zum Beispiel die ältere Dame aus dem Ort, die mir unter Tränen von den schlimmen Taten ihres missratenen Sohnes berichtete. Da war der Obdachlose, der aus dem Zug stieg und mir seinen Leidensweg schilderte. Da war auch der junge Mann, den seine Große Liebe verlassen hatte und der nicht weiter wusste. Es war vor gut 40 Jahren. Heiligabend, Spätdienst, die am meisten gehasste Dienstschicht. Als Junggeselle bin ich selbstredend „dran“, die verheirateten Kollegen gehören an diesem Abend in den Kreis ihrer Lieben. Daß auch auf unsereinen daheim die Angehörigen warten, ist nebensächlicher Natur. Mittags war der „Alte“ da und einer vom Personalrat: Das übliche Päckchen, ein Händedruck und ein abgedroschenes „Einer muß sich ja opfern, heute der, morgen jener, der Dienst geht ja weiter“, und weg waren sie. Daß sehr oft ich der besagte „der“ war, blieb angelegentlich unerwähnt. Eigentlich hätte ich ja stolz sein müssen: Je mehr Dienst, desto mehr Ehre. Nur: Für diese Ehre kann ich mir wenig kaufen und Dienstfrei an Heiligabend wäre mir lieber. Es gab „zeitnahe“ Kollegen, für die Weihnachten „antiquierter Blödsinn“ war. Wenn sie selber aber dienstplanmäßig zum Spätdienst an der Reihe waren, wurden sie rechtzeitig krank. Ein älterer Kollege, Ruheständler, schaut auf einen Sprung herein, für „Frohe Weihnachten“ und einen Händedruck. Draußen läuft der Personenzug ein, der Lokführer winkt. Zwei Kollegen sind die einzigen Zusteigenden bei uns, arme Hunde, sie müssen nach Köln zur Nachtschicht. „Frohe Weihnachten“ über die Bahnsteiglautsprecher, – mein Brötchengeber möge mir diese unvorschriftsmäßige Durchsage nachsehen. Es ist früh dunkel geworden. Helle Pünktchen hinter verhangenen Fenstern lassen Lichterbäume erahnen. Leere Straßen, selbst die Dorfkneipen haben zu. Daheim warten sie jetzt auf mich. Es gibt gebackene Forellen, mein Leibgericht, Mutter ist sicher schon bei den Vorbereitungen. Noch dreieinhalb Stunden bis zum Feierabend. Ich denke an all die „Leidensgenossen“ dieses Abends und dieser Nacht: Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Ärzte, Krankenhäuser, – Not und Tod, Leben und Freude machen nicht Halt vor dem Heiligabend. Auch nicht das Verbrechen und der Krieg. Mein Besucher hat lange Zeit schweigend in die stille Nacht hinaus geschaut. Als er sich am Fenster umwendet, scheint er merkwürdig verändert, irgendwie fremd, als sei er nicht mehr bei mir im nüchternen Dienstraum. Mit leiser Stimme beginnt er zu erzählen. Ich höre zu, lange Zeit, ohne selber viel zu reden. Was ich höre, klingt manchmal wie billiges Plagiat aus einem sehr bekannten Kriegsroman, den aber mein Besucher nie in Händen gehalten, geschweige denn gelesen hat. Er war selber dabei, 1942 in Stalingrad, aus dessen Todeskessel er auf wundersame Weise mit einer JU 52 vom Flugplatz Pitomnik aus entkam. Daß er dabei, selbst verwundet, einen Kameraden mit zerschossenem Knie auf dem Rücken geschleppt und ihm im Wellblechbauch der überladenen „Tante JU“ einen Platz erkämpft hat, das erzählt er nicht. Ich weiß es aber, aus Berichten eines anderen Kollegen. Vom Hunger erzählt mein Besucher. Der Hunger war schlimmer als der russische Scharfschütze in der Hausruine. An dessen „Schießsport“ gewöhnten sich die vier Landser im halb zerfallenen Keller im Westteil von Stalingrad, nicht aber an den Hunger, der die abgezehrten Körper marterte. Eine ruppige Katze, der die Rippen durchs Fell stachen, kam den Männern wie ein Geschenk des Himmels. Fünf Tage lang ein Fettauge auf der Schneewassersuppe und ein fast unsichtbares Stückchen Fleisch, – wenigstens die Illusion einer Mahlzeit. Von Franz erzählt der Kollege. Franz war der fünfte Mann der Gruppe. Der russische Scharfschütze erwischte ihn beim Verrichten seiner Notdurft. Tagelang konnten sie den halb entkleideten Toten nicht bergen, weil der Russe das Gelände einsehen konnte und auf jede Bewegung schoß. Ein paar Tränen glänzen auf den Wangen des Erzählers, er wischt sie nicht einmal fort. Von Heiligabend in Stalingrad höre ich. Eine der seltenen Verpflegungsbomben, unter Lebensgefahr geborgen, hatte Bunkerlichter beschert. Die konnte man zwar nicht essen, man konnte sie aber anzünden und drei Stück in eins der zerschossenen Kellerfenster stellen, das der Scharfschütze einsehen konnte. Lambert, einer der Vier, zieht eine Mundharmonika hervor, die er über sämtliche Fährnisse hinweg gerettet hat. Daß etliche Tonzungen inzwischen ihren Dienst versagen, was macht das schon, hier in Stalingrad? Stille Nacht, heilige Nacht, – beim dritten „Anlauf“ singen die Kameraden mit, leise erst, verhalten, wie schüchterne Kinder, dann kräftiger. Der Russe drüben staunt ob der Vorgänge bei den Germanskis. Die sind nicht mehr im zerschossenen Keller von Stalingrad. In Gedanken sind sie daheim: Die Angehörigen, die Stube, der Lichterbaum, Tannenduft. Einer von ihnen ist tausende Kilometer weit weg in einem kleinen Eifeldorf... Drei bellende Gewehrschüsse beenden jäh den Traum der Vier. Drei rußende Bunkerlichter zerfetzen unter den Kugeln, verspritzen ihr stinkendes Öl an die Kellerwand. Der Krieg hat die Träumer eingeholt. Mein Besucher schweigt, wir beide schweigen. Was ich gehört habe, würde ein Buch füllen. Das ist umso bemerkenswerter, als der an sich wortkarge Mann fast nie über Kriegserlebnisse spricht. Er hat das Grauen von Stalingrad nie überwinden können. Heiligabend hat ihm für einen Augenblick die Zunge gelöst. Die Zeit verging wie im Flug, noch eine halbe Stunde bis Feierabend. Irgendwie beschäftigt es mich: Bei uns daheim die Forellen, – in Stalingrad kochten die Landser Katzenknochen aus! „So Johann, jetz john ech heem. Frohe Weihnachten noch ens on danke dofür, dat du mir esu lang zojehuët häß. Ech moot et äwwer eenfach ens quitt were“. (jetzt gehe ich heim, danke dafür, daß du mir so lange zugehört hast. Ich mußte es aber einfach mal loswerden). Das war ein ungewöhnliches Wort von einem ungewöhnlichen Mann, der übrigens auch Johann hieß. Im nächsten Jahr kam er am Heiligabend wieder. Danach kam er nicht mehr, Johann war seinem Kameraden Franz aus Stalingrad gefolgt. Ich bin dankbar dafür, daß ich ihm zuhören durfte. |
|||||||