|
Durch kniehohen Schnee zur Christmette
„Herbstgebäck“ stand auf einem Schild im Supermarkt zu lesen. Es prangte über einem Berg von Plätzchen, Spekulatius, Printen und Dominosteinen. Das war im September, einen Monat später hatten sich die herbstlichen Leckereien in „Weihnachtsgebäck“ verwandelt. Jetzt geht der November bereits zu Ende und die Kaufhäuser platzen bald vor lauter „Weihnachtsfreuden“. Wurde ja auch Zeit, am 30. November ist der 1. Adventssonntag und die „Lichterwochen“ brechen an. Fast einen Monat lang tagein tagaus Lichterbäume, Lichterketten, Lichterschläuche, – Lichterspektakel, wohin man auch schaut. Die Weihnachtsbeleuchtung wird zur banalen Alltäglichkeit, man nimmt sie schließlich gar nicht mehr zur Kenntnis. In der Heiligen Nacht endlich, wenn doch eigentlich der Lichterbaum zur Geltung kommen sollte, ist er bedeutungslos geworden, zu viele Lichter mussten wir in den zurückliegenden Wochen verkraften. Als Kinder freuten wir uns wochenlang auf den Lichterbaum, dessen Kerzen erstmals in der Heiligen Nacht angezündet wurden.
„Et jeht langsam op Weihnachten aan“, meinte früher Ohm Mattes (Matthias) im Spätherbst, wenn morgens das Gras auf dem Peisch (Wiese) vor unserem Haus weiß überfroren war. Beim Sonntagsspaziergang in der Hardt schauten wir intensiv nach einem angemessenen Tannenbäumchen aus und merkten uns den Standort. Geschlagen wurde der Baum nämlich erst an Heiligabend, damit er ganz frisch war und möglichst lange „halten“ würde. Das ist heute nur noch von geringer Bedeutung, viele Weihnachtsbäume haben schon zwei Tage nach dem Fest „ausgedient“ und warten in Vorgärten und Hofeinfahrten auf die Entsorgung. Bei uns daheim standen der Christbaum und die von Pap (Vater) gebastelte kleine Krippe zumindest bis Drieköninge (Dreikönigen, 06. Januar) in der Stube. Das Moos zum Auslegen der Krippe suchten wir ebenfalls in der Hardt, etliche Tage vor dem Fest, weil es meistens hart gefroren war und auftauen mußte. Oft genug mussten wir es unter dem Schnee hervor scharren, wir kannten aber unseren „Moosplatz“ genau und brauchten nicht lange zu suchen. Auf einem großen Bauernhof in Mehr (bei Kleve, Niederrhein) habe ich einmal eine Weihnachtskrippe bewundern können, die das halbe Wohnzimmer ausfüllte. Dagegen war unser Krippchen daheim ein Spielzeug.
Nur ein geklauter (gestohlener) Baum sei ein guter Weihnachtsbaum, lautete früher – und lautet auch heute noch gelegentlich – eine Faustregel, obwohl dieser Standpunkt sich mit dem christlichen Hintergrund des Festes nicht so recht vereinbaren lässt. Klauen muß aber heutzutage eigentlich niemand mehr seinen Tannenbaum, das Kaufangebot ist groß. Freilich blättern wir etliche Euros auf den Tisch, dafür vermeiden wir aber das Risiko des Erwischtwerdens beim Klauen, was uns empfindlich teurer zu stehen käme. Viele Kommunen bieten Weihnachtsbäume zu humanen Preisen an, beispielsweise die Gemeinde Blankenheim, in deren Wald der Käufer seinen Baum selber schlagen kann. Noch vor wenigen Jahren stellte hier der Forstbetrieb die benötigten Bäume den einzelnen Ortschaften zu, bei Ankunft der Lieferung kam es beinahe zu „Kämpfen“ um den schönsten Baum.
Zu meiner Kinderzeit war es daheim selbstverständlich, daß wir unseren Chreßboum in der Hardt holten. Das wurde vom Forstmann stillschweigend geduldet, solange sich unser mehr oder weniger „verbotenes“ Geschäft auf Wildwuchs beschränkte. Den gab es massenhaft, die schönsten Bäumchen standen oft direkt am Wegrand. Wenn aber in der jungen Fichtenkultur ein Baum abgesägt und wenige Schritte weiter weggeworfen wurde, weil dort ein noch schönerer stand, dann konnte die friedlichste Försterseele sehr unfriedlich werden und das mit Recht. Ein vernünftiges Wort mit dem Föeschter (Forstbeamten) verhilft auch heute noch zum schnittfrischen, selbst ausgesuchten und selbst geschlagenen Weihnachtsbaum. Es gibt genug Laubholzaufforstungen, in denen die wildwachsenden Fichtenbäumchen ohnehin entfernt werden müssen, – man muß nur fragen. Unseren allerschönsten Weihnachtsbaum hatten wir im Jahr 1996: Die zwei Meter lange Spitze einer mittleren Fichte, ein Geschenk des Forstbeamten, das er uns sogar ins Haus brachte. Das Besondere daran war der natürliche Baumschmuck in Gestalt von mehr als 100 Fichtenzapfen. Wegen der Last der harzigen Dännebetze mussten wir die Äste einzeln hochbinden. Viel Christbaumschmuck war da überflüssig und unser Wohnzimmer duftete köstlich nach Fichtenharz.
 Zurück in die Kinderzeit. Christbaum und Krippe wurden also an Heiligabend aufgestellt. Wir Kinder wurden frühzeitig zu Bett geschickt weil wir gegen 23 Uhr, – je nach Witterung auch früher –, startklar sein mussten für den Besuch der Christmette in Blankenheimerdorf. Viel geschlafen haben wir in der Heiligen Nacht allerdings nie, vor Aufregung: Wenn wir wieder aufstehen mussten, war das Christkind dagewesen, der Lichterbaum strahlte, die Geschenke lagen bereit und in den bunten Weihnachtstellern prangten die herrlichsten Leckereien. So war es bei uns daheim Tradition und von den Eltern in bester Absicht eingeführt. Heute denke ich aber, daß es nicht gerade die gescheiteste Verfahrensweise war. Zurück in die Kinderzeit. Christbaum und Krippe wurden also an Heiligabend aufgestellt. Wir Kinder wurden frühzeitig zu Bett geschickt weil wir gegen 23 Uhr, – je nach Witterung auch früher –, startklar sein mussten für den Besuch der Christmette in Blankenheimerdorf. Viel geschlafen haben wir in der Heiligen Nacht allerdings nie, vor Aufregung: Wenn wir wieder aufstehen mussten, war das Christkind dagewesen, der Lichterbaum strahlte, die Geschenke lagen bereit und in den bunten Weihnachtstellern prangten die herrlichsten Leckereien. So war es bei uns daheim Tradition und von den Eltern in bester Absicht eingeführt. Heute denke ich aber, daß es nicht gerade die gescheiteste Verfahrensweise war.
Selbstverständlich wie der Gottesdienstbesuch an sich, war auch der Empfang der Komniuën (Kommunion) in der Christmette. Darauf hatten wir uns schon Tage vorher durch die Bich (Beichte) vorbereiten müssen und uns eifrig bemüht, „sündenfrei“ zu bleiben. Hierunter fiel unter anderem auch die absolute Einhaltung des Nüchternheitsgebots. Nach katholischem Kirchenrecht war ab drei Stunden vor dem Kommunionempfang der Genuss von Speisen und Alkohol verboten, für alkoholfreie sonstige Getränke war eine Stunde vorgeschrieben, nur Wasser durfte man beliebig trinken. Die Missachtung dieser Bestimmungen bedeutete für uns eine schwere Sünde, von der man sich nur durch eine erneute Beichte befreien konnte. Mit einer solchen Sündenlast auf dem Gewissen durfte man nicht kommunizieren, das wäre geradezu eine Todsünde gewesen. Bei uns daheim war das Nüchternheitsgebot noch drastisch erweitert worden. Die Eltern erlaubten sich und uns innerhalb der Abstinenzphase nicht einmal den kirchlicherseits zugestandenen Schluck Wasser und erweiterten von sich aus die Dauer der Enthaltsamkeit auf sechs Stunden. Die Mette begann um Mitternacht, wir mußten ab 18 Uhr nüechter (nüchtern) bleiben und durften weder Essen noch Getränke zu uns nehmen. Bei einem Kirchweg von mehr als zwei Kilometern trat allgemein das Nüchternheitsgebot außer Kraft, nicht aber bei uns, obwohl wir mehr als drei Kilometer bis Blankenheimerdorf zu marschieren hatten.
Für uns Kinder war es hart, geradezu unmenschlich: Da lockten auf den bunten Tellern Plätzchen und Süßigkeiten, – in den Kriegsjahren ohnehin seltene Freuden –, und durften nicht angerührt werden, bis wir gegen 02 Uhr morgens von der Mette zurück waren. Unsere Andacht beim Gottesdienst hatte da arg zu leiden, hatten wir doch dauernd die Köstlichkeiten vor Augen. Und auch die Geschenke durften erst nach der Rückkunft ausgepackt werden, damit wir in der Kirche nicht unandächtig wären. Gerade dieses Rätsele (Rätselraten) um den Inhalt der Pakete hat uns indessen von den kirchlichen Handlungen abgelenkt. Ich denke aber, das Christkind hat uns unsere „Unandacht“ verziehen.
Mette, das Wort ist dem lateinischen „matutina“ entlehnt und bezeichnet insbesondere den einem hohen kirchlichen Fest vorangehenden Gottesdienst in der Nacht oder am Vorabend. Damals wussten wir nicht, was „Mette“ bedeutete, wir wussten nur, daß wir an diesem Gottesdienst teilnehmen mussten, egal unter welchen Umständen. So stapften wir also nicht selten bei klirrender Kälte in kniehohem Neuschnee durch die Nacht, manchmal im Schneetreiben, das uns in lebendige Schniemänn (Schneemänner) verwandelte. Einen Räumdienst gab es bei uns nicht, die Eltern marschierten vor uns Kindern her und trampelten eine Spur in den Schnee. Es gab weder Straßenbäume noch Telefonmasten als Orientierung, manchmal gerieten wir in der Finsternis vom Trampelpfad der Erwachsenen ab und versanken im Straßengraben bis zum Buch (Bauch) im Schnee. Für die drei Kilometer Weg nach Blankenheimerdorf brauchten wir je nach Witterung gut eine Stunde. In der überfüllten und schlecht geheizten Kirche stand oder kniete man dicht an dicht nebeneinander im unangenehmen Schwallek (Dunst) der sich erwärmenden Kleidung. Kaum war man einigermaßen „opjetüüt“ (aufgetaut), da war die Feier zu Ende und es ging wieder hinaus in Dunkelheit, Kälte und Schnee, drei Kilometer bis nach Schlemmeschhoff (Schlemmershof). Was für die Christmette galt, traf bei uns auch für alle Sonn- und Feiertage zu, auch da nämlich war der Kirchgang Pflicht.
 An ein ganz bestimmtes Weihnachtsfest erinnere ich mich, als wäre es erst im vergangenen Jahr gewesen: Kriegsweihnachten 1944. Ardennenoffensive, im „Hinterland“ sammelten sich die deutschen Truppen, die Dörfer waren mit Soldaten und Gerät überbelegt und ständiges Angriffsziel feindlicher Flugzeuge. In unserem Schopp (Holzschuppen) hatte sich eine Reparaturstaffel der Wehrmacht etabliert, die Soldaten kampierten auf dem Heuboden. Vater war auf Urlaub, an Neujahr mußte er wieder fort. Wir beide hatten morgens im hohen Schnee in der Hardt unseren Weihnachtsbaum geholt, nachmittags wurde er mit der Krippe aufgestellt. Weihnachtskerzen gab es nicht, wir hatten im blechernen Wichsdosendeckel auf dem Herd den unansehnlichen Inhalt von Bunkerlichtern erhitzt und im Pappröhrchen „Kerzen“ gegossen. Am heißen Bleich (Blech) verbrannten wir uns die Finger. Der Docht unserer Kerzen war ein Wollfaden, von Jött aus dem Nähkasten gestiftet. Die fast schwarzen Kerzen funzelten trübe vor sich hin, mir scheint aber, sie strahlten heller als tausend elektrische Watt. An ein ganz bestimmtes Weihnachtsfest erinnere ich mich, als wäre es erst im vergangenen Jahr gewesen: Kriegsweihnachten 1944. Ardennenoffensive, im „Hinterland“ sammelten sich die deutschen Truppen, die Dörfer waren mit Soldaten und Gerät überbelegt und ständiges Angriffsziel feindlicher Flugzeuge. In unserem Schopp (Holzschuppen) hatte sich eine Reparaturstaffel der Wehrmacht etabliert, die Soldaten kampierten auf dem Heuboden. Vater war auf Urlaub, an Neujahr mußte er wieder fort. Wir beide hatten morgens im hohen Schnee in der Hardt unseren Weihnachtsbaum geholt, nachmittags wurde er mit der Krippe aufgestellt. Weihnachtskerzen gab es nicht, wir hatten im blechernen Wichsdosendeckel auf dem Herd den unansehnlichen Inhalt von Bunkerlichtern erhitzt und im Pappröhrchen „Kerzen“ gegossen. Am heißen Bleich (Blech) verbrannten wir uns die Finger. Der Docht unserer Kerzen war ein Wollfaden, von Jött aus dem Nähkasten gestiftet. Die fast schwarzen Kerzen funzelten trübe vor sich hin, mir scheint aber, sie strahlten heller als tausend elektrische Watt.
Die Soldaten hatten ein wahres Wunderwerk geschaffen. In ihrer Werkstatt gab es ein Niedervolt - Stromaggregat zum Aufladen von Autobatterien, – für uns eine Wundermaschine. Die Männer bastelten aus fadendünnen Drähten und winzigen Lämpchen eine Kette und hängten sie in unseren Weihnachtsbaum. Sie verlegten aus dem Schuppen ein paar Drähte in die Stube, verbanden sie mit der Lichterkette, und unser Weihnachtsbaum erstrahlte in nie gesehener Pracht, winzige Lichtchen zwar, aber unvergleichlich schön. Gemeinsam mit den Soldaten sangen wir „Stille Nacht“, zwei Strophen, dann schauten die Männer lange Zeit still vor sich hin. Erstaunt bemerkte ich, daß einer sich ein paar Tränen abwischte. Auf einen Wink von Mam (Mutter) schlichen wir leise aus der Stube. Im Schuppen ratterte das Aggregat.
Auch in dieser Heiligen Nacht marschierten wir zur Mette ins Pfarrdorf. Es war mondhell und bitter kalt, der Schnee auf der Straße war durch die Militärfahrzeuge festgefahren, wir kamen gut voran. Von Westen her hörten wir fernen Kanonendonner,– Ardennenschlacht. Am Himmel dröhnten die Motoren der Nachtflieger. Über dem Freuschberch (Froschberg, Flurname) stieg eine Kette bunter Leuchtkugeln hinter dem Dännebösch (Fichtenwald) herauf, „stand“ ein paar Sekunden am Himmel und verlosch langsam. Es wurde taghell, erschrocken hatten wir uns in den Schnee neben der Straße geworfen.
Die Kirche war überfüllt, wir kamen nicht mehr bis vorne durch. Die Fenster waren verdunkelt, ein paar Kerzen spendeten trübes Licht, den elektrischen Strom hatte uns ja längst der Krieg genommen. Nachtjäger heulten über das Dorf, die Leute in der Kirche schauten immer besorgt nach der Decke. Als dann aber „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen wurde, hörten wir keine Flugzeuge mehr, die eindrucksvolle Melodie übertönte das Todeslied am Himmel, die Heilige Nacht ließ für Augenblicke den Krieg und seine Schrecken vergessen. Niemals zuvor und wohl auch selten danach, hat die Pfarrkirche von Blankenheimerdorf eine so ergreifende Christmette erlebt.
Noch ein Erlebnis erinnert mich an die Jahreswende 1944/45. Es war wenige Tage nach Neujahr, Vater war wieder zurück gefahren, in den Krieg, dessen Ende bereits abzusehen war. Besonnene Dorfbewohner und sogar Soldaten rieten ihm, daheim zu bleiben, sich zu verstecken und das Kriegsende abzuwarten. Das tat er aber nicht, weniger aus Pflichttreue seinem „Führer“ gegenüber, als vielmehr aus Angst vor Repressalien besonders auch gegen uns, seine Familie. Sein Sammeltransport startete in Blankenheim, ich marschierte mit ihm durch den Schnee über die Hardt. Am Russenkreuz (Ortsbezeichnung) verabschiedeten wir uns. In dem Moment begann in Sichtweite auf Geißhausen (Flurname) eine 8,8 Zentimeter Flakbatterie zu feuern. Der Kanonendonner hat mich wochenlang verfolgt.
 Wenige Tage danach, es war ein strahlender Wintertag und allerbestes Fliegerwetter, rodelten wir Pänz auf der schneeglatten Straße bei unserem Haus, einer der Soldaten von der Reparaturstaffel war mit von der Partie. Die Straße weist hier auf eine Länge von gut 400 Metern etwa fünf Prozent Gefälle auf, damals die ideale Rodelbahn. Auf dem Weg zum Startpunkt waren wir gerade oberhalb von Kaue (Hausname), als ein einzelner Jabo (Jagdbomber) über der Hardt auftauchte und gemächlich über den Himmel zuckelte. Wir schenkten ihm keine Beachtung, weil die feindlichen Flugzeuge uns in unserem kleinen Dörfchen bisher in Ruhe ließen. Plötzlich hörten wir das fürchterliche Heulen, das immer dann hörbar war, wenn sich ein Jabo „auf den Kopf stellte“. Ich hörte unseren Soldaten noch „hinlegen“ schreien, dann war donnernder Motorenlärm und schreckliches Krachen über uns. Um uns herum stoben kleine Schneefontänen hoch. Noch einmal heulte und krachte es über uns, dann war der Spuk vorbei, der Jabo verschwand über dem Eichholz (Waldbereich) in Richtung Schmidtheim. In Todesangst rannten wir heimzu, dort stürzte uns Mam entgegen, schreckensbleich. Keinem von uns war ein Haar gekrümmt worden. Als der Schnee weggetaut war, fanden wir im Feld 27 leere Bord-MG-Hülsen. Wir haben dem Christkind in unserer Krippe gedankt. Wenige Tage danach, es war ein strahlender Wintertag und allerbestes Fliegerwetter, rodelten wir Pänz auf der schneeglatten Straße bei unserem Haus, einer der Soldaten von der Reparaturstaffel war mit von der Partie. Die Straße weist hier auf eine Länge von gut 400 Metern etwa fünf Prozent Gefälle auf, damals die ideale Rodelbahn. Auf dem Weg zum Startpunkt waren wir gerade oberhalb von Kaue (Hausname), als ein einzelner Jabo (Jagdbomber) über der Hardt auftauchte und gemächlich über den Himmel zuckelte. Wir schenkten ihm keine Beachtung, weil die feindlichen Flugzeuge uns in unserem kleinen Dörfchen bisher in Ruhe ließen. Plötzlich hörten wir das fürchterliche Heulen, das immer dann hörbar war, wenn sich ein Jabo „auf den Kopf stellte“. Ich hörte unseren Soldaten noch „hinlegen“ schreien, dann war donnernder Motorenlärm und schreckliches Krachen über uns. Um uns herum stoben kleine Schneefontänen hoch. Noch einmal heulte und krachte es über uns, dann war der Spuk vorbei, der Jabo verschwand über dem Eichholz (Waldbereich) in Richtung Schmidtheim. In Todesangst rannten wir heimzu, dort stürzte uns Mam entgegen, schreckensbleich. Keinem von uns war ein Haar gekrümmt worden. Als der Schnee weggetaut war, fanden wir im Feld 27 leere Bord-MG-Hülsen. Wir haben dem Christkind in unserer Krippe gedankt.
Was war das für ein Mensch, der da auf Kinder schoß! Oder galt sein Angriff der Uniform unseres Landsers? War es Zufall, daß keiner von uns getroffen wurde? Hat nicht vielleicht ein Unsichtbarer die Geschosse von uns abgelenkt? Einer, der in brenzligen Verkehrssituationen hilfreich die Hand über uns hält, der dem Chirurgen das Skalpell führte und den Knochenmann wegschickte, der auf der Intensivstation an meinem Bett stand und mich holen wollte! Es gibt ihn, den unsichtbaren Helfer, den wir Schutzengel nennen.
|
|
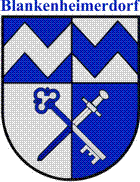

 Zurück in die Kinderzeit. Christbaum und Krippe wurden also an Heiligabend aufgestellt. Wir Kinder wurden frühzeitig zu Bett geschickt weil wir gegen 23 Uhr, – je nach Witterung auch früher –, startklar sein mussten für den Besuch der Christmette in Blankenheimerdorf. Viel geschlafen haben wir in der Heiligen Nacht allerdings nie, vor Aufregung: Wenn wir wieder aufstehen mussten, war das Christkind dagewesen, der Lichterbaum strahlte, die Geschenke lagen bereit und in den bunten Weihnachtstellern prangten die herrlichsten Leckereien. So war es bei uns daheim Tradition und von den Eltern in bester Absicht eingeführt. Heute denke ich aber, daß es nicht gerade die gescheiteste Verfahrensweise war.
Zurück in die Kinderzeit. Christbaum und Krippe wurden also an Heiligabend aufgestellt. Wir Kinder wurden frühzeitig zu Bett geschickt weil wir gegen 23 Uhr, – je nach Witterung auch früher –, startklar sein mussten für den Besuch der Christmette in Blankenheimerdorf. Viel geschlafen haben wir in der Heiligen Nacht allerdings nie, vor Aufregung: Wenn wir wieder aufstehen mussten, war das Christkind dagewesen, der Lichterbaum strahlte, die Geschenke lagen bereit und in den bunten Weihnachtstellern prangten die herrlichsten Leckereien. So war es bei uns daheim Tradition und von den Eltern in bester Absicht eingeführt. Heute denke ich aber, daß es nicht gerade die gescheiteste Verfahrensweise war. An ein ganz bestimmtes Weihnachtsfest erinnere ich mich, als wäre es erst im vergangenen Jahr gewesen: Kriegsweihnachten 1944. Ardennenoffensive, im „Hinterland“ sammelten sich die deutschen Truppen, die Dörfer waren mit Soldaten und Gerät überbelegt und ständiges Angriffsziel feindlicher Flugzeuge. In unserem Schopp (Holzschuppen) hatte sich eine Reparaturstaffel der Wehrmacht etabliert, die Soldaten kampierten auf dem Heuboden. Vater war auf Urlaub, an Neujahr mußte er wieder fort. Wir beide hatten morgens im hohen Schnee in der Hardt unseren Weihnachtsbaum geholt, nachmittags wurde er mit der Krippe aufgestellt. Weihnachtskerzen gab es nicht, wir hatten im blechernen Wichsdosendeckel auf dem Herd den unansehnlichen Inhalt von Bunkerlichtern erhitzt und im Pappröhrchen „Kerzen“ gegossen. Am heißen Bleich (Blech) verbrannten wir uns die Finger. Der Docht unserer Kerzen war ein Wollfaden, von Jött aus dem Nähkasten gestiftet. Die fast schwarzen Kerzen funzelten trübe vor sich hin, mir scheint aber, sie strahlten heller als tausend elektrische Watt.
An ein ganz bestimmtes Weihnachtsfest erinnere ich mich, als wäre es erst im vergangenen Jahr gewesen: Kriegsweihnachten 1944. Ardennenoffensive, im „Hinterland“ sammelten sich die deutschen Truppen, die Dörfer waren mit Soldaten und Gerät überbelegt und ständiges Angriffsziel feindlicher Flugzeuge. In unserem Schopp (Holzschuppen) hatte sich eine Reparaturstaffel der Wehrmacht etabliert, die Soldaten kampierten auf dem Heuboden. Vater war auf Urlaub, an Neujahr mußte er wieder fort. Wir beide hatten morgens im hohen Schnee in der Hardt unseren Weihnachtsbaum geholt, nachmittags wurde er mit der Krippe aufgestellt. Weihnachtskerzen gab es nicht, wir hatten im blechernen Wichsdosendeckel auf dem Herd den unansehnlichen Inhalt von Bunkerlichtern erhitzt und im Pappröhrchen „Kerzen“ gegossen. Am heißen Bleich (Blech) verbrannten wir uns die Finger. Der Docht unserer Kerzen war ein Wollfaden, von Jött aus dem Nähkasten gestiftet. Die fast schwarzen Kerzen funzelten trübe vor sich hin, mir scheint aber, sie strahlten heller als tausend elektrische Watt.  Wenige Tage danach, es war ein strahlender Wintertag und allerbestes Fliegerwetter, rodelten wir Pänz auf der schneeglatten Straße bei unserem Haus, einer der Soldaten von der Reparaturstaffel war mit von der Partie. Die Straße weist hier auf eine Länge von gut 400 Metern etwa fünf Prozent Gefälle auf, damals die ideale Rodelbahn. Auf dem Weg zum Startpunkt waren wir gerade oberhalb von Kaue (Hausname), als ein einzelner Jabo (Jagdbomber) über der Hardt auftauchte und gemächlich über den Himmel zuckelte. Wir schenkten ihm keine Beachtung, weil die feindlichen Flugzeuge uns in unserem kleinen Dörfchen bisher in Ruhe ließen. Plötzlich hörten wir das fürchterliche Heulen, das immer dann hörbar war, wenn sich ein Jabo „auf den Kopf stellte“. Ich hörte unseren Soldaten noch „hinlegen“ schreien, dann war donnernder Motorenlärm und schreckliches Krachen über uns. Um uns herum stoben kleine Schneefontänen hoch. Noch einmal heulte und krachte es über uns, dann war der Spuk vorbei, der Jabo verschwand über dem Eichholz (Waldbereich) in Richtung Schmidtheim. In Todesangst rannten wir heimzu, dort stürzte uns Mam entgegen, schreckensbleich. Keinem von uns war ein Haar gekrümmt worden. Als der Schnee weggetaut war, fanden wir im Feld 27 leere Bord-MG-Hülsen. Wir haben dem Christkind in unserer Krippe gedankt.
Wenige Tage danach, es war ein strahlender Wintertag und allerbestes Fliegerwetter, rodelten wir Pänz auf der schneeglatten Straße bei unserem Haus, einer der Soldaten von der Reparaturstaffel war mit von der Partie. Die Straße weist hier auf eine Länge von gut 400 Metern etwa fünf Prozent Gefälle auf, damals die ideale Rodelbahn. Auf dem Weg zum Startpunkt waren wir gerade oberhalb von Kaue (Hausname), als ein einzelner Jabo (Jagdbomber) über der Hardt auftauchte und gemächlich über den Himmel zuckelte. Wir schenkten ihm keine Beachtung, weil die feindlichen Flugzeuge uns in unserem kleinen Dörfchen bisher in Ruhe ließen. Plötzlich hörten wir das fürchterliche Heulen, das immer dann hörbar war, wenn sich ein Jabo „auf den Kopf stellte“. Ich hörte unseren Soldaten noch „hinlegen“ schreien, dann war donnernder Motorenlärm und schreckliches Krachen über uns. Um uns herum stoben kleine Schneefontänen hoch. Noch einmal heulte und krachte es über uns, dann war der Spuk vorbei, der Jabo verschwand über dem Eichholz (Waldbereich) in Richtung Schmidtheim. In Todesangst rannten wir heimzu, dort stürzte uns Mam entgegen, schreckensbleich. Keinem von uns war ein Haar gekrümmt worden. Als der Schnee weggetaut war, fanden wir im Feld 27 leere Bord-MG-Hülsen. Wir haben dem Christkind in unserer Krippe gedankt.